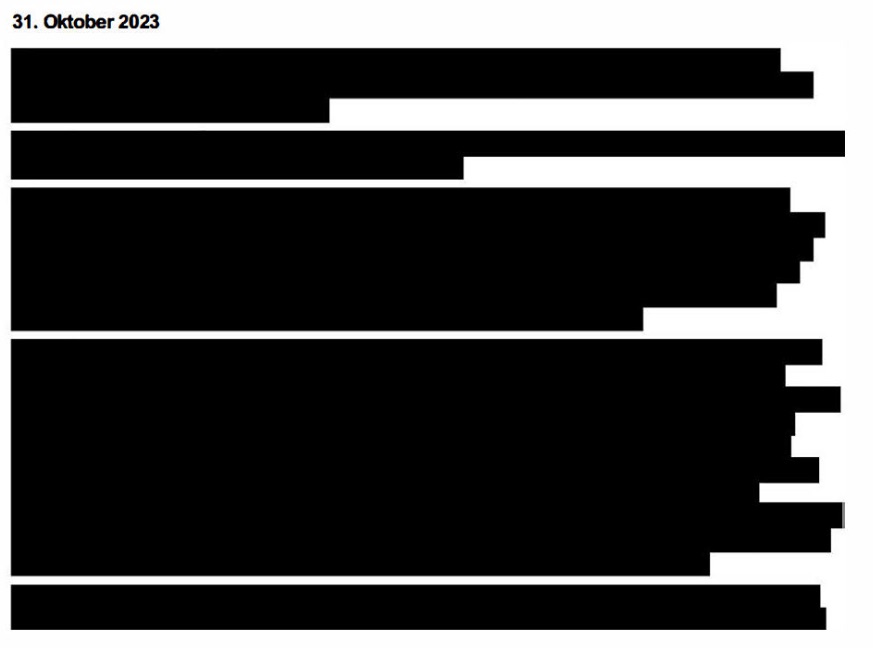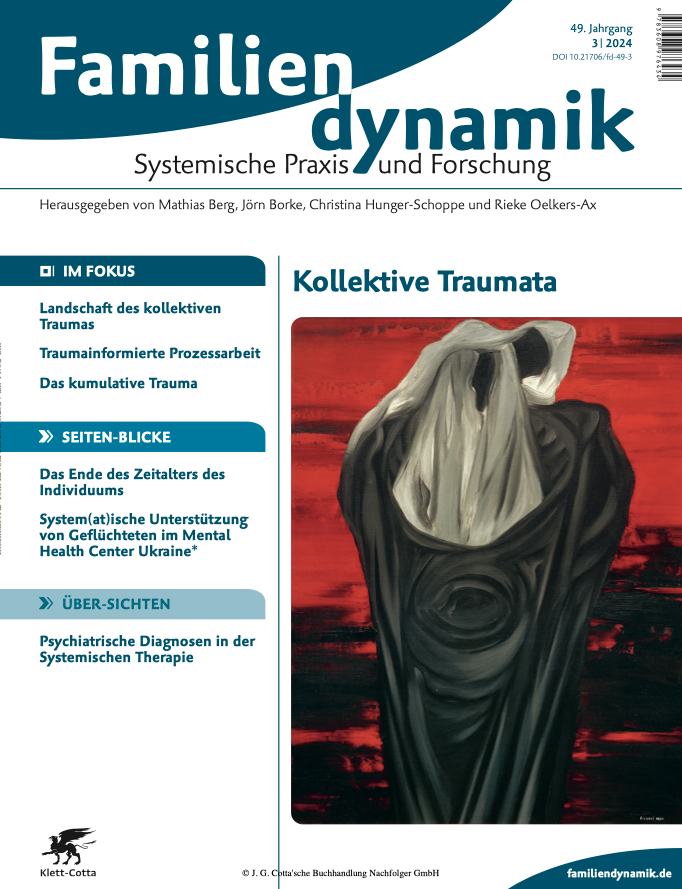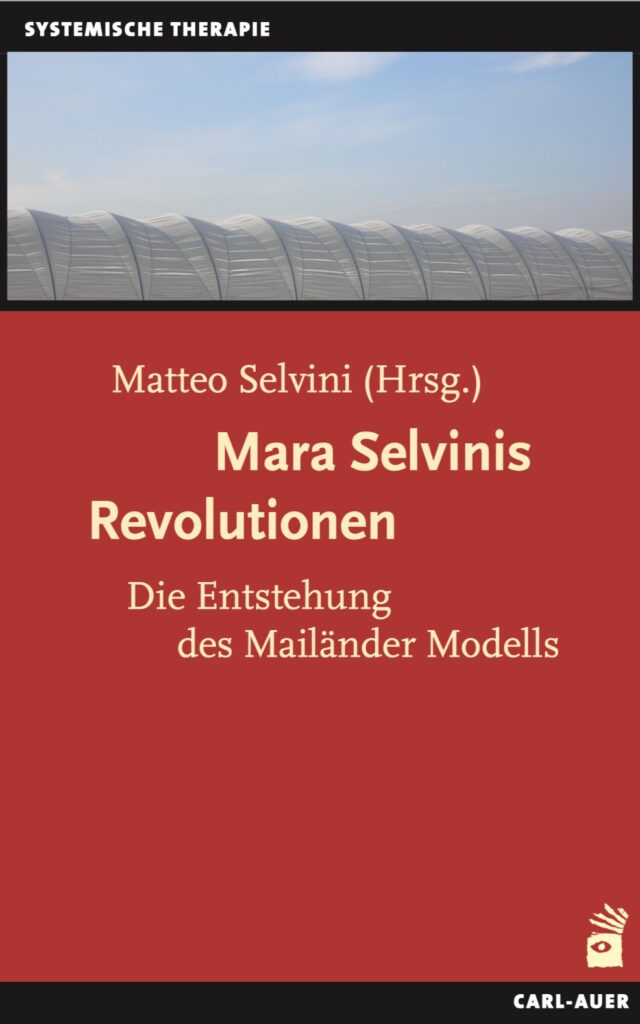Das aktuelle Heft von Organisationsberatung, Supervision, Coaching setzt sich mit einem Thema auseinander, dem schon in 2022 und 2023 Themenhefte der Zeitschrift gewidmet waren – ein Zeichen für die Dringlichkeit der Befassung auch auf Seiten der Berater, Coaches und Supervisoren. Im Editorial schreiben Silja Kotte und Thomas Webers: „Digitalisierung hat sich in Organisationen zum Dauerthema entwickelt. Schon mehrfach hat diese Zeitschrift sich mit den Auswirkungen beschäftigt. Das OSC-Heft 4/2022 hat die Auswirkungen der Digitalisierung auf virtuelles Arbeiten und Führung auf Distanz beleuchtet. „Digitalisierung in der Beratung“ lautete der Titel des OSC-Hefts 1/2023. Das aktuelle Themenheft „Digitale Transformation in Organisationen“ nimmt eine breitere organisationale Perspektive ein: Wie transformiert Digitalisierung Organisationen? Wie gestalten Organisationen die damit verbundenen Change-Prozesse? Welche neuen Formen der Kooperation bilden sich dadurch heraus? Wie kann digitale Arbeit gut gestaltet werden?
Digitalisierung ist ein Querschnittsthema, das alle Funktionsbereiche und Prozesse in Organisationen grundsätzlich transformiert – von der Produktion bis zum Controlling, von den Kern- bis zu den Unterstützungsprozessen. Auch das neuerdings People- statt HR- genannte Management und die Beratung sind davon nicht ausgenommen (Strohmeier 2022): Von der Personalauswahl über die Arbeitsgestaltung, die Zusammenarbeit in Organisationen, Führung, Personalentwicklung und -beurteilung bis hin zur Organisationsentwicklung – alle Bereiche sind von der Digitalisierung betroffen.
Organisationen müssen sich mit den technologischen Entwicklungen auseinandersetzen und sich positionieren. Sie sehen sich derzeit vielen Ideen und Initiativen gegenüber, von denen nicht immer absehbar ist, ob sie sich als nützlich herausstellen und einen Mehrwert generieren können. Neuen Möglichkeiten stehen auch Skepsis und Vorbehalte gegenüber. Nicht alles, was (technisch) machbar erscheint, ist auf den zweiten Blick betrachtet sinnvoll – und findet auch nicht immer Akzeptanz. Nicht zuletzt stehen Fragen des Datenschutzes und der Ethik auf der Agenda, die nicht immer angemessen beantwortet werden. Organisationen gehen diese Transformation mehr oder weniger strategisch an: Sie entwickeln Digitalisierungsstrategien, setzen zentrale Stabsstellen oder cross-funktionale Teams ein, die diese umsetzen sollen, und schreiben Stellen wie „Digital Transformation Manager“ oder „Digital Transformation Specialist“ aus, für die ein unternehmerisches Verständnis der Zusammenhänge zwischen Business, IT und Digitalisierung sowie Erfahrung in der Umsetzung von Transformationsprojekten gefordert wird.“