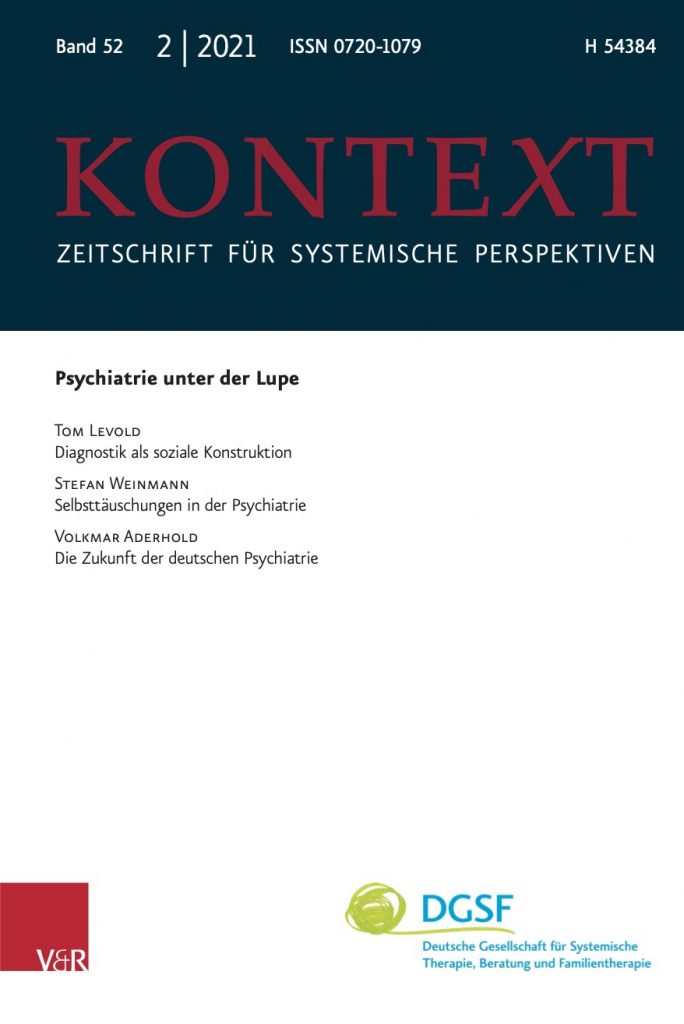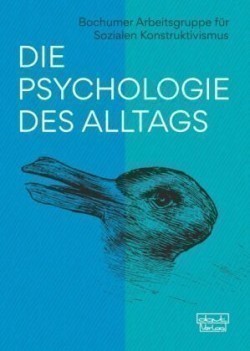Vor kurzem erschien an dieser Stelle ein Rezensionsessay von Wolfgang Loth über Texte der BochumerArbeitsgruppe für Sozialen Konstruktivismus, über Die Psychologie des Alltags. Ebenfalls im dgvt-Verlag ist mit gleichem, aber spiegelverkehrten Cover, ein 444 Seiten starker, bereits 2009 im englischen Original veröffentlichter Band von Ken Gergen über Die Psychologie des Zusammenseins erschienen, in dem er die Abkehr von der individualistische Tradition, das autonome Selbst in den Mittelpunkt der Psychologie zu stellen, begründet. Wolfgang Loth hat auch dieses Buch für systemagazin gelesen und steuert folgenden Rezensionsessay bei:
Wolfgang Loth, Niederzissen: Vision einer relational aufmerksamen Welt
Kraft und Bedeutung des Gemeinschaftlichen sind Ken Gergens Thema seit vielen Jahren. Das Gemeinschaftliche in den Vordergrund zu rücken gegenüber der in unseren Breiten dominierenden individualistischen Weltsicht ist sein Anliegen, und er hat das konsequent weiterverfolgt auch gegen Widerstände. Der Begriff des Sozialen Konstruktionismus ist untrennbar mit ihm und seiner Frau Mary verbunden[1]. Das nun vorliegende Buch erschien im Original vor etwas mehr als 10 Jahren unter dem Titel Relational Being: Beyond Self and Community (2009[2]). Trotz der Prominenz, die die Gergens auch im deutschsprachigen Raum genießen, war es bis jetzt nicht ins Deutsche übersetzt worden. Thorsten Padberg hat diese Lücke nun geschlossen, er hat das Buch übersetzt und ihm ein ausführliches Vorwort gewidmet: „Aufforderung zum Tanz – Kenneth Gergens Psychologie des Zusammenseins“.
Das Vorwort führt auf ansprechende Art in Gergens Denkweise und in die Absicht ein, die dieses Buch trägt[3]. Doch lässt der Titel des Vorwortes, wie eben auch der Titel der übersetzten Buchausgabe bei mir eine Irritation entstehen, die sich auch nach der an sich erhellenden und im Wesentlichen sehr anregenden Lektüre nicht auflöst. Was hat Padberg bewegt, das spielraumeröffnende relational being für eine bestimmte Fachdisziplin zu reklamieren? Da sich Padberg – exzellent auch in seinen erläuternden Fußnoten – als ein sprachlich versierter und desgleichen in Übersetzungsdingen sattelfester Autor erweist, vermute ich hier einen Zusammenhang, der eher nichts mit Gergen zu tun hat, sondern mit einem spezifischen akademischen Kontext, der mir ebenfalls in dem Band der Bochumer Arbeitsgruppe für Sozialen Konstruktivismus über die „Psychologie des Alltags“ aufgefallen ist[4]. Das hier besprochene Buch und das zur Psychologie des Alltags sind gemeinsam herausgekommen, auch optisch als Zwillinge kenntlich gemacht (gleiche Aufmachung, gleiche Coverfarbe), verbindend unterschieden durch die spiegelbildliche Wiedergabe des bekannten Hase-Ente-Kippbildes auf dem Cover (im vorliegenden Buch schaut „der Hase“ nach links). Ich komme auf den irritierenden Psychologie-Fokus am Ende noch einmal zu sprechen.
Weiterlesen →