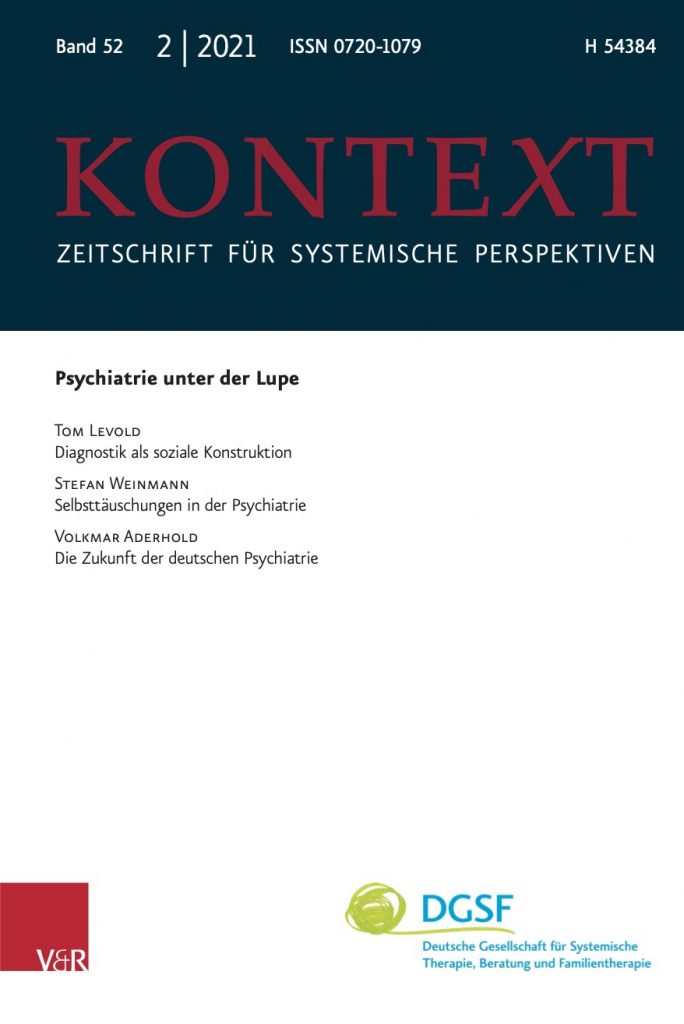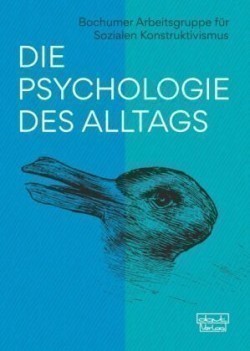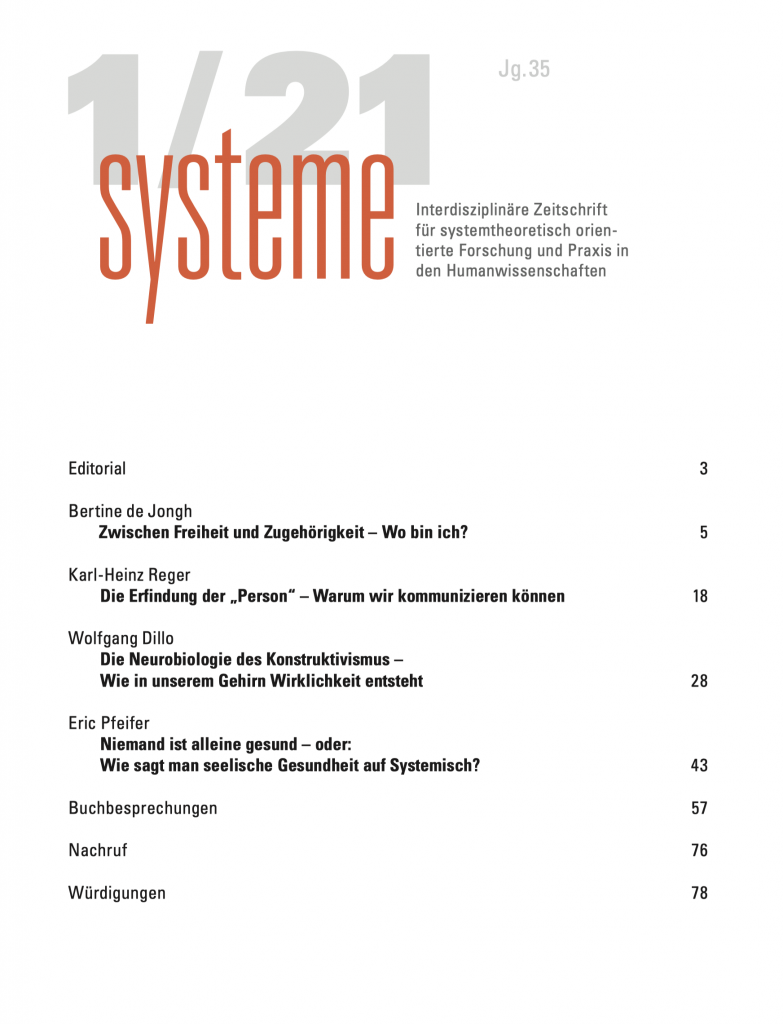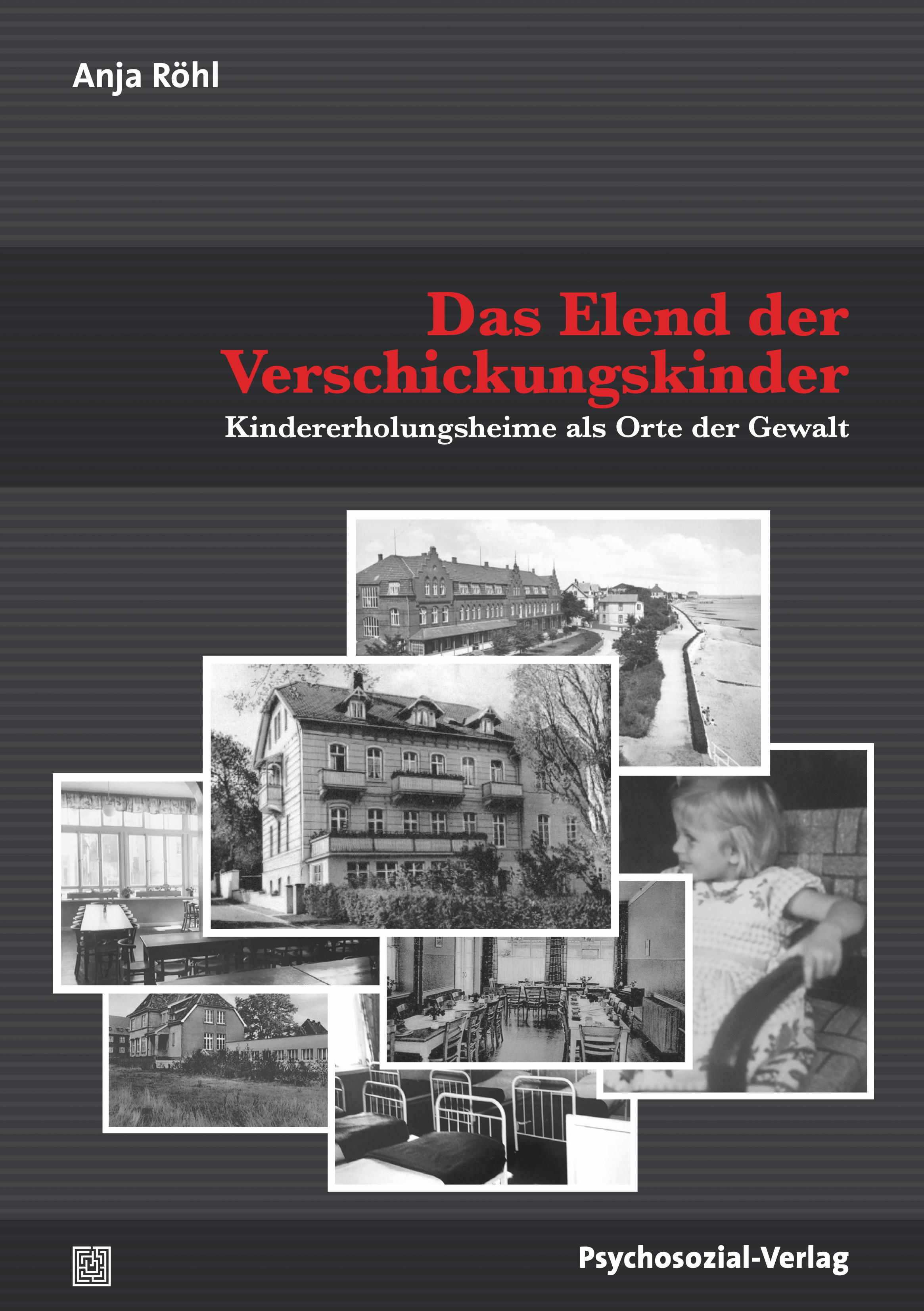Noa Zanolli ist eine Schweizer Sozialanthropologin und Mediatorin und lebt in Bern. In den USA arbeitete sie mehrere Jahre als Mediatorin in einem kommunalen Mediationszentrum, war Ausbildungsleiterin am Iowa Peace Institute und ist international als Mediatorentrainerin tätig. Heute ist sie Mitglied des Redaktionsbeirats der deutsch/schweizerisch/österreichischen Vierteljahreszeitschrift perspektive mediation. Im Wolfgang Metzner-Verlag hat sie 2020 ein kleines Büchlein über „Mediatives Denken“ veröffentlicht. Wolf Ritscher hat es gelesen und empfiehlt die Lektüre.
Wolf Ritscher, Unterreichenbach: Mit feinen Strichen und überaus verständlich
Noa Zanolli ist eine Expertin der Mediation, die in dieser Landschaft theoretisch und praktisch vielseitig unterwegs ist. Sie hat entschieden, kein Buch für Fachleute zu schreiben, die sich im Feld der Mediation noch weiter bilden bzw. ausbilden wollen, sondern einen Text für Menschen, die in ihrem Alltag mit schwierigen oder tagtäglichen zwischenmenschlichen Krisen zurechtkommen müssen und dafür Handwerkszeuge, Handlungskonzepte und möglicherweise neue Sichtweisen über Funktion, Sinn und Lösungsmöglichkeiten von Konflikten benötigen.
Das setzt voraus, für den Text keine Fachsprache zu benutzen, sondern den Leser/innen einen Text anzubieten, der trotz des Verzichts auf differenzierte theoretische und begriffliche Exkurse einlädt, über die in der Lebenswelt von Menschen, Gruppen, sozialen Gemeinschaften auftretenden Konflikte nachzudenken und miteinander nach möglichen Lösungen zu suchen. Ihre wichtigste Intention dabei ist, dass ihnen dieses Buches hilft, einen veränderten und ressourcenorientierten Blick auf die anstehenden Probleme zu werfen.
Die Autorin versteht Mediation als eine Kunst, bei allem was Menschen in Konflikten trennt doch das Verbindende zu suchen und zu finden. Ich würde es eher als Kunsthandwerk bezeichnen, um zu betonen, dass es eben doch auch methodischer Fertigkeiten bedarf, um Konflikte nachhaltig lösen zu können. Die Vision, der sie in ihrem Buch folgte, formuliert sie schon in der Einführung: »Warum sollten nicht möglichst viele Menschen mediativ denken lernen können, sodass sie ihre kleinen und größeren Konflikte angstfrei und zuversichtlich selbst angehen können – so wie es ganz normal ist, bei kleineren Verletzungen zunächst die Hausapotheke zu nutzen oder bei einem Regenguss einfach zum Schirm zu greifen?« (S. 11). Das finde ich so sympathisch an diesem Buch: Mithilfe ganz einsichtiger Formulierungen und Metaphern wird die Welt der Theorien in die Welt alltäglicher Kommunikation überführt und kann alltagspraktisch der Lösung zwischenmenschlicher Konflikte dienen.