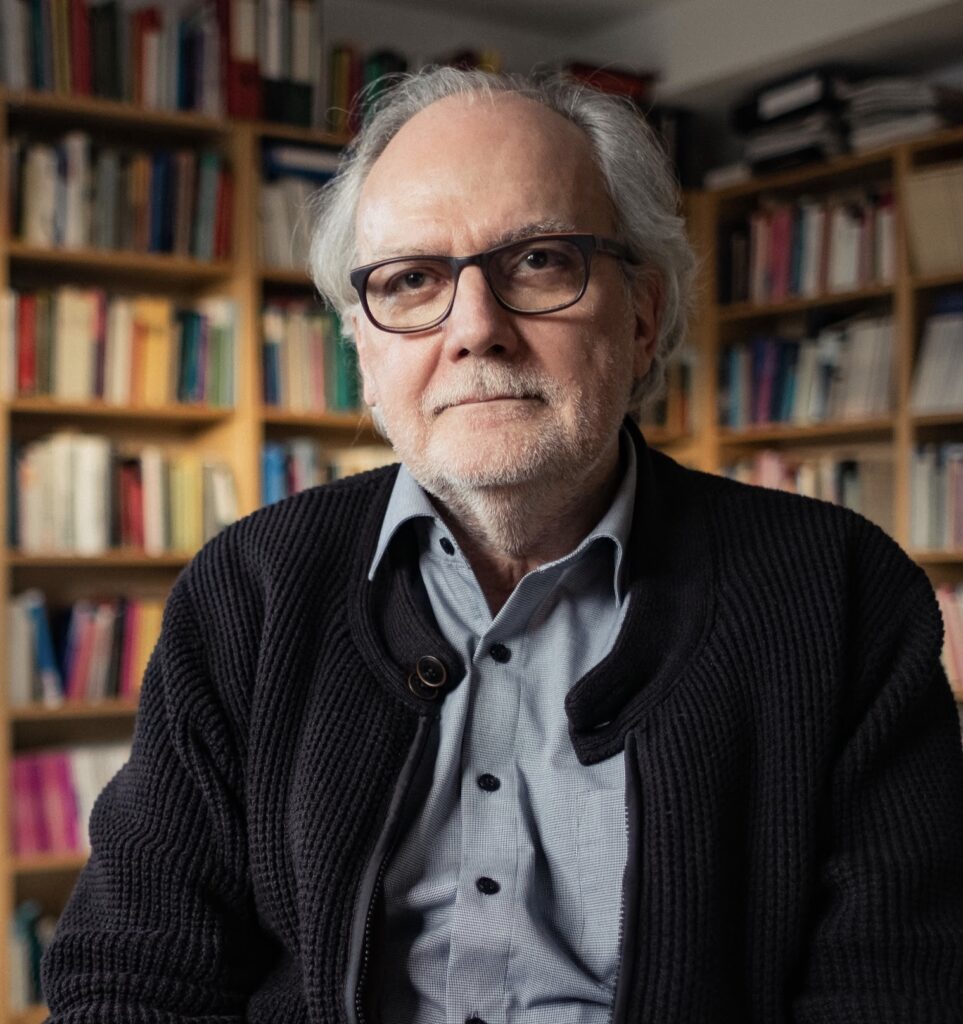
Heute wird Tom Levold 70 Jahre alt. So oft hat er an dieser Stelle auf die Geburtstage von Kolleginnen und Kollegen hingewiesen, Sträuße gebunden und aus der Fülle seines Wissens und seiner Erfahrungen deren unverwechselbare Persönlichkeiten gewürdigt und gratuliert. Jetzt ist er selbst dran! Zu diesem Zweck haben wir für einen Tag das systemagazin gekapert, das Forum, das als eines der Geschenke Toms an die systemische Gemeinschaft gelten kann. Er hat dieses Online-Journal gegründet, seinen Weiterbestand gesichert, und dafür gesorgt, dass es seit bald 20 Jahren durchgängig die Entwicklungen im Feld des Systemischen dokumentiert und nicht selten befeuert hat. Seinem souveränen Umgang mit digitalen Medien ist unter anderem die „Geschichtswerkstatt“ zu verdanken. Als eine offen zugängliche Quelle liefert dieses Kompendium eine „nicht-lineare visuelle Darstellung der Geschichte des systemischen Ansatzes und seiner theoretischen und praktischen Vorläufer“. Nicht nur eine Chronik, sondern auch ein Vernetzungswunder. Eine wahre Fundgrube, die nicht genug empfohlen werden kann.
Das publizistische Engagement ist nicht Toms einziger Dienst für das Systemische im deutschsprachigen Raum. Seine unverwechselbare Präsenz und sein ebenso fundiertes wie unbestechliches Beisteuern zu Wachheit, Innovation, Klärung und auch Ermutigung systemischer Diskurse sind Legion. Davon wird heute sicher in vielfältiger Weise die Rede sein. Zu Recht! Und es wird vermutlich nur ein Ausschnitt sein aus dem Vielen, was da zu sagen wäre.
Nicht nur der publizistisch herausragende, in seiner Schreibe ungemein präzise und weiterführende Autor, der Mitherausgeber von Zeitschriften und eines großen Lehrbuchs der systemischen Therapie und Beratung, oder der Historiograph der bereits erwähnten Geschichtswerkstatt ist zu würdigen. Es gilt auch, den Autor herauszuheben, der dem systemischen Denken aus der Kognitionslastigkeit herausgeholfen hat, der dem Kognitiven das Affektive, das Nonverbale und Vorsprachliche wieder zur Seite gestellt hat, der mit dazu beigetragen hat, das Bewusstsein für die Körpergebundenheit jeder Bedeutung zu schärfen. Auf die Relevanz ‚affektiver Kommunikation‘ auch in der systemischen Praxis hat er immer wieder hingewiesen. Das Transdisziplinäre hat er als ein Basismerkmal systemischer Praxis und systemischen Denkens gegen jeden Versuch der Fraktionierung verteidigt.
Weiterlesen →







