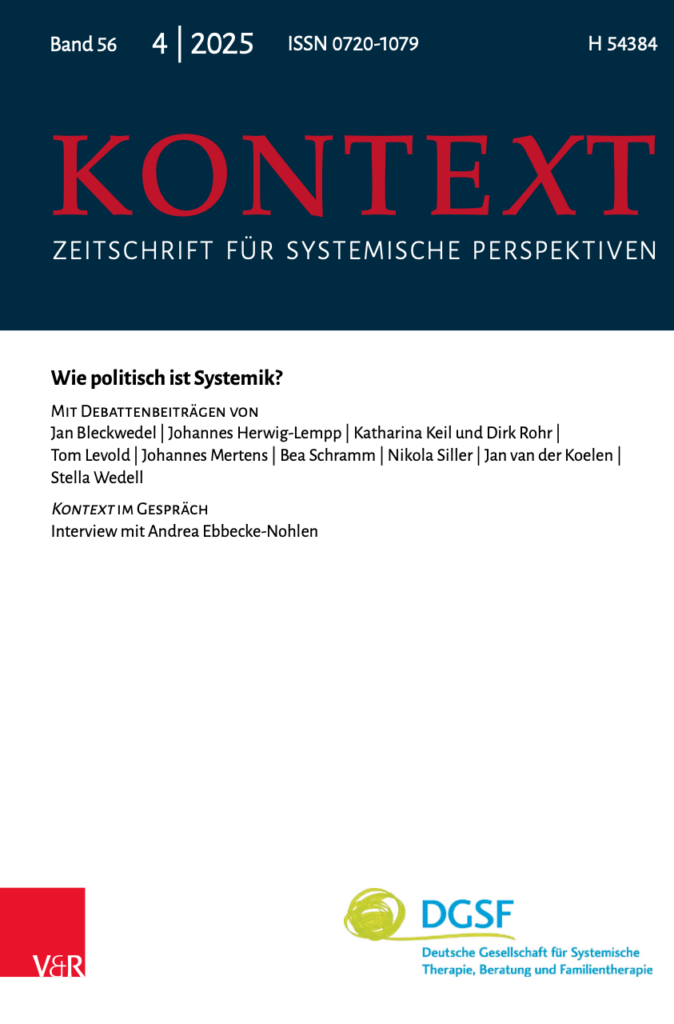24. Dezember 2025
von Tom Levold
6 Kommentare
Liebe Leserinnen und Leser,
Zunächst möchte ich bei Ihnen allen herzlich für Ihr Interesse und Ihre Treue, die dieses Projekt nun seit bald 21 Jahren begleiten. Ihr Engagement für das Nachdenken über systemische Praxis, Ihre kritischen Leserbriefe, Ihre persönlichen Geschichten und Ihre Bereitschaft, sich auf kontroverse Diskussionen einzulassen – das alles macht das systemagazin neben seinen sonstigen Informationen und Beiträgen zum systemischen Diskurs zu dem, was es sein soll: ein Ort für nicht-triviales Denken.
Besonders danken möchte ich wieder allen Autorinnen und Autoren des aktuellen Adventskalenders. Sie haben das Thema „Systemischer Umgang mit Unterschieden, Ambivalenzen und Widersprüchen” auf vielfältige Weise reflektiert und uns mehr als nur unterhaltende Lektüre, geschenkt, nämlich Impulse, die wirken und nachwirken.
Das Thema dieses Adventskalenders ist auf bemerkenswerte Resonanz gestoßen. Es entstanden intensive, teilweise heftig geführte Diskussionen. Es wurde gestritten – um Worte, um Konzepte, um die Frage, wie sich der systemische Ansatz in Zeiten politischer Polarisierung verstehen und verhalten sollte. Es gab Kontroversen über die Vereinbarkeit von Allparteilichkeit mit politischer Klarheit; über das Verhältnis von Ambivalenztoleranz und moralischer Eindeutigkeit; über die Gefahr einer Ideologisierung des Systemischen; über die Frage, ob und wie systemische Therapeutinnen und Therapeuten sich gesellschaftspolitisch positionieren sollten.
Weiterlesen →