Thomas Friedrich-Hett, Essen:
 Kann systemisch Alter? Oder vielleicht etwas klarer formuliert, widmen sich systemische Beraterinnen/Berater und Therapeutinnen/Therapeuten älteren Menschen und den damit zusammenhängenden Fragen und Ängsten?
Kann systemisch Alter? Oder vielleicht etwas klarer formuliert, widmen sich systemische Beraterinnen/Berater und Therapeutinnen/Therapeuten älteren Menschen und den damit zusammenhängenden Fragen und Ängsten?
Beim Aufruf zum Adventskalender 2014 zu überlegen, was im systemischen Feld vielleicht fehlt, wo blinde Flecken sind oder was zu kurz kommen könnte, war meine spontane innere Antwort sofort formuliert: das Alter.
„Dem Leben das Alter geben“, hat es Klaus Zitt einmal in einem Interview formuliert (Friedrich-Hett, 2005, a). In systemischer Fachliteratur wird das Thema kaum fokussiert, auf Tagungen und Kongressen fristet es auch eher noch (zumindest hoffe ich dies!) ein Schattendasein, das kaum Interessenten anzieht. Wer nach systemischen Kolleginnen und Kollegen sucht, die mit älteren Menschen arbeiten, mag sich an die Suche nach der Nadel im Heuhaufen erinnert fühlen.
Woran könnte dies liegen? In Zeiten des demografischen Wandels müsste doch hinreichendes Interesse bestehen, oder?
Wagen wir ein kleines, selbstreflexives Experiment, um die „Woran-Frage“ auszuloten (vgl. Friedrich-Hett, 2010):
Teil 1: Bitte stellen Sie sich vor, sie wären 75 Jahre alt. Wie werden Sie sich fühlen? Mit welchen körperlichen Einschränkungen und Schmerzen werden Sie leben müssen? Werden Sie Pflege benötigen? Was oder wen werden Sie alles verloren haben? Werden sie einsam oder arm sein? – Und was denken Sie nach diesen Fragen über das Älterwerden?
Teil 2: Bitten stellen Sie sich erneut vor, 75 Jahre alt zu sein. Aber konzentrieren Sie sich nun auf den Reichtum an Freiheiten und Möglichkeiten, der noch vor Ihnen liegen wird. Was werden Sie tun, wofür Sie früher nie Zeit hatten? Von welchen Lasten und ungeliebten Pflichten werden Sie befreit sein? Welchen Dingen werden Sie sich gerne zuwenden? Wohin werden Sie gerne reisen? Mit wem werden Sie gerne zusammen sein? – Und was denken und fühlen Sie nach diesen Fragen über das Älterwerden? Weiterlesen →

 Die Frage „was fehlt?“ ist in vielen Hinsichten ambivalent. Ich frage mich beispielsweise, ob klare Begriffe wirklich fehlen, wenn diese bestimmte Problemlösungen oder Therapieerfolge nur stören würden. Ich will nicht von notwendig falschem Bewusstsein sprechen, sondern nur fragen, inwiefern ein je bestimmtes kontingentes Bewusstsein fehlt oder einfach nur – fast zum Glück für die Sache – nicht vorhanden ist. Ich habe also keine Ahnung, ob ein allenfalls fehlender Systembegriff einer systemischen Therapie fehlen würde. Ich bin kein Therapeut und schon gar kein systemischer und kann die Frage, was der systemischen Therapie fehle, deshalb nur in einer – systemtheoretischen – Aussensicht angehen.
Die Frage „was fehlt?“ ist in vielen Hinsichten ambivalent. Ich frage mich beispielsweise, ob klare Begriffe wirklich fehlen, wenn diese bestimmte Problemlösungen oder Therapieerfolge nur stören würden. Ich will nicht von notwendig falschem Bewusstsein sprechen, sondern nur fragen, inwiefern ein je bestimmtes kontingentes Bewusstsein fehlt oder einfach nur – fast zum Glück für die Sache – nicht vorhanden ist. Ich habe also keine Ahnung, ob ein allenfalls fehlender Systembegriff einer systemischen Therapie fehlen würde. Ich bin kein Therapeut und schon gar kein systemischer und kann die Frage, was der systemischen Therapie fehle, deshalb nur in einer – systemtheoretischen – Aussensicht angehen. Die Frage ist verführerisch, gewiß. Zumindest für mich, der sich im systemischen Mainstream nicht mehr so ganz beheimatet fühlt. Ich könnte sie also als willkommene Einladung nützen, vieles zu kritisieren, zu bemängeln. Doch das wäre nicht fair. Verdanke ich doch der systemischen Therapie so vieles in meiner persönlichen und professionellen Entwicklung.
Die Frage ist verführerisch, gewiß. Zumindest für mich, der sich im systemischen Mainstream nicht mehr so ganz beheimatet fühlt. Ich könnte sie also als willkommene Einladung nützen, vieles zu kritisieren, zu bemängeln. Doch das wäre nicht fair. Verdanke ich doch der systemischen Therapie so vieles in meiner persönlichen und professionellen Entwicklung. Als Vertreterin eines aus meiner Sicht vom Systemischen Ansatz noch vernachlässigten Anwendungsgebiets, spüre ich die Unzulänglichkeiten der dort noch vorherrschenden linear-kausalen Denkansätze in meiner täglichen Arbeit.
Als Vertreterin eines aus meiner Sicht vom Systemischen Ansatz noch vernachlässigten Anwendungsgebiets, spüre ich die Unzulänglichkeiten der dort noch vorherrschenden linear-kausalen Denkansätze in meiner täglichen Arbeit. In der Mongolei gibt es ein Sprichwort dass heißt: Ein ehrlicher Mensch braucht ein schnelles Pferd.
In der Mongolei gibt es ein Sprichwort dass heißt: Ein ehrlicher Mensch braucht ein schnelles Pferd. Das Thema des Adventskalenders hat mich in diesem Jahr sofort angesprochen, gibt es doch eine Zugangsmöglichkeit zu Kindern (und Familien), die mir in der systemischen Therapie seit langem schon zu kurz kommt: das Spiel.
Das Thema des Adventskalenders hat mich in diesem Jahr sofort angesprochen, gibt es doch eine Zugangsmöglichkeit zu Kindern (und Familien), die mir in der systemischen Therapie seit langem schon zu kurz kommt: das Spiel. Einer der bekanntesten Vertreter des systemischen Ansatzes und des systematischen Querdenkens ist sicherlich Heiz von Foerster. Durch ihn hat die Physik eine gewisse Prominenz in der Welt der Systemiker erfahren, ohne dort wirklich präsent zu sein. Woher kommt dieser Zugang, habe ich mich gefragt, denn bin selbst über die Denkwelt Physik zu Management, Organisation gekommen und schließlich in der Welt des systemischen Beratungsansatzes gelandet. Sicherlich hat es mit dem Abstraktionsvermögen, dem Denken in Strukturen und Wechselwirkungen zu tun, so ist zumindest meine (erste) Hypothese.
Einer der bekanntesten Vertreter des systemischen Ansatzes und des systematischen Querdenkens ist sicherlich Heiz von Foerster. Durch ihn hat die Physik eine gewisse Prominenz in der Welt der Systemiker erfahren, ohne dort wirklich präsent zu sein. Woher kommt dieser Zugang, habe ich mich gefragt, denn bin selbst über die Denkwelt Physik zu Management, Organisation gekommen und schließlich in der Welt des systemischen Beratungsansatzes gelandet. Sicherlich hat es mit dem Abstraktionsvermögen, dem Denken in Strukturen und Wechselwirkungen zu tun, so ist zumindest meine (erste) Hypothese. Als Beitrag zur Frage „systemisch – was fehlt?“ möchte ich auf eine Lücke hinweisen, mit der ich selbst mich schon seit vielen Jahren herumschlage: Was genau ist der Stellenwert von Gefühlen in der systemischen Theorie und Praxis? Oder, etwas spezifischer gefragt: Wie lässt sich mein Ansatz der Affektlogik (die Lehre vom obligaten Zusammenwirken von Emotion und Kognition) mit der klassischen Systemtheorie vereinen?
Als Beitrag zur Frage „systemisch – was fehlt?“ möchte ich auf eine Lücke hinweisen, mit der ich selbst mich schon seit vielen Jahren herumschlage: Was genau ist der Stellenwert von Gefühlen in der systemischen Theorie und Praxis? Oder, etwas spezifischer gefragt: Wie lässt sich mein Ansatz der Affektlogik (die Lehre vom obligaten Zusammenwirken von Emotion und Kognition) mit der klassischen Systemtheorie vereinen?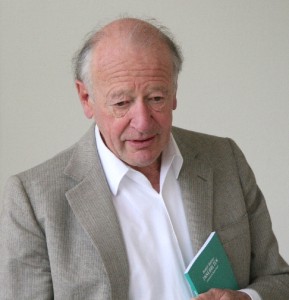
 „Systemisch – was fehlt?“ ist eine scheinbar simpel daherkommende Frage. Sie impliziert Wünsche und dies scheint durchaus in einen Adventskalender zu passen. An Weihnachten darf man schließlich wünschen. Als Kind war das einfach. Mir fehlte immer etwas: Rollschuhe, Tretroller, Fußbälle, Schienbeinschoner. Aber klappt das Wünschen bei diesem Thema auch?
„Systemisch – was fehlt?“ ist eine scheinbar simpel daherkommende Frage. Sie impliziert Wünsche und dies scheint durchaus in einen Adventskalender zu passen. An Weihnachten darf man schließlich wünschen. Als Kind war das einfach. Mir fehlte immer etwas: Rollschuhe, Tretroller, Fußbälle, Schienbeinschoner. Aber klappt das Wünschen bei diesem Thema auch? Was mich als Systemiker ein wenig bekümmert, ist, dass bisher so wenig davon im öffentlichen Bewusstsein und Diskurs angekommen ist, was systemisches Denken und Handeln ausmacht und leisten kann. Dabei könnten Politik und Gesellschaft sich ja durch sie für anstehende Probleme zu konstruktiven und kreativen Lösungsvorschlägen inspirieren lassen.
Was mich als Systemiker ein wenig bekümmert, ist, dass bisher so wenig davon im öffentlichen Bewusstsein und Diskurs angekommen ist, was systemisches Denken und Handeln ausmacht und leisten kann. Dabei könnten Politik und Gesellschaft sich ja durch sie für anstehende Probleme zu konstruktiven und kreativen Lösungsvorschlägen inspirieren lassen.
 Der österreichische Psychiater und Familientherapeut Ludwig Reiter hat vor mehreren Jahrzehnten (1) einmal geäußert, dass so wie die Psychoanalytiker aus dem Bildungsbürgertum und die Verhaltenstherapeuten aus den jungen Technokraten sich die damaligen Familientherapeuten ihre Werte vorwiegend aus der Hippiebewegung speisen würden. Diese Einschätzung war sehr umstritten. Aber in meinem Erleben definierten sich die meisten Familientherapeuten um 1980 herum (sie waren nach meiner Erinnerung damals mehrheitlich im Alter zwischen 25 und 45, und sie lebten in einer Phase ca. 10 Jahre nach der Studentenbewegung, kurz nach dem Höhepunkt der K-Gruppen, erlebten den Beginn von Ökologie-, Friedens- und Alternativbewegung“) in einem diffusen Sinne als „undogmatische Linke“. Noch 1991 haben wir (Arist von Schlippe und ich, mit Zustimmung der anderen Tagungsverantwortlichen) auf dem großen Kongress „Das Ende der großen Entwürfe und das Blühen systemischer Praxis“ in Heidelberg eine Art Teach-In gegen die damalige US-Invasion im Irak veranstaltet. Auch ein Panel über „Ökologische Politik als Interaktionsprozess“ mit Kommunal-, Umwelt- und Gesundheitspolitikern fand damals im Plenum statt.
Der österreichische Psychiater und Familientherapeut Ludwig Reiter hat vor mehreren Jahrzehnten (1) einmal geäußert, dass so wie die Psychoanalytiker aus dem Bildungsbürgertum und die Verhaltenstherapeuten aus den jungen Technokraten sich die damaligen Familientherapeuten ihre Werte vorwiegend aus der Hippiebewegung speisen würden. Diese Einschätzung war sehr umstritten. Aber in meinem Erleben definierten sich die meisten Familientherapeuten um 1980 herum (sie waren nach meiner Erinnerung damals mehrheitlich im Alter zwischen 25 und 45, und sie lebten in einer Phase ca. 10 Jahre nach der Studentenbewegung, kurz nach dem Höhepunkt der K-Gruppen, erlebten den Beginn von Ökologie-, Friedens- und Alternativbewegung“) in einem diffusen Sinne als „undogmatische Linke“. Noch 1991 haben wir (Arist von Schlippe und ich, mit Zustimmung der anderen Tagungsverantwortlichen) auf dem großen Kongress „Das Ende der großen Entwürfe und das Blühen systemischer Praxis“ in Heidelberg eine Art Teach-In gegen die damalige US-Invasion im Irak veranstaltet. Auch ein Panel über „Ökologische Politik als Interaktionsprozess“ mit Kommunal-, Umwelt- und Gesundheitspolitikern fand damals im Plenum statt. Advent und das Fehlende gehören zusammen. Obwohl, genauer natürlich das noch Fehlende. Das noch Fehlende, dessen Kommen erwartet wird. Und dessen Kommen das tragende Motiv eines hoffnungsvollen Narrativs ist. Das gäbe jetzt zwar einen schönen Anfang, doch gerät der ins Wanken, wenn das Fehlende mit Systemischer Therapie zu tun haben soll. Wie das? Mir scheint, Systemische Therapie hat nichts mit Advent zu tun, kann es nicht, jedenfalls dann nicht, wenn sich ihre gedanklichen Begleiterscheinungen systemtheoretisch ableiten und sich auf diese Weise ihrer Funktionalität versichern. Da geht es nicht um Advent, sondern um Adjunkt, sozusagen, Erfolg als Fortsetzungsgeschichte. Was ist, ist auch schon wieder vorbei und nur sinnträchtig als Sprungbrett für Nachfolgendes. Sein als imaginärer Zustand und praktisch ein Reigen laufender Ereignisse. Systemtheorie als Fruchtbarkeitstheorie, um es einmal so zu sagen. Allgemein, als Theorie an sich – oder für sich? Im erlebten Leben ist die Dichotomie nicht so leidenschaftslos: schließt sich an/schließt sich nicht an. Noch ist Erleben keine Frage von 0 oder 1 und Lebenserzählungen noch keine Ausgeburt binärer Codes. Fehlt mir das? Nein, das fehlt mir nicht, was hat das hier zu suchen? Im Ernst, fehlt mir was in der Systemischen Therapie? Und wenn ja, wäre das jetzt ein systemtheoretischer Witz zu fragen: woran mache ich das fest? Was soll als umrissen gelten bei etwas, was permanent ausreißt? Systoria nicht zu vergessen, dass eingeschlafene Projekt, die Entwicklungen systemischen Denkens für psychosoziales Helfen gesammelt festzuhalten. Etwas, was fehlt… Ich nähere mich dem Thema, fürchte ich. Dabei hatte ich vor, diesmal nichts zu schreiben zum Adventskalender, die Frage nach dem Fehlenden in der Systemischen Therapie führte mich zu sehr in Widersprüche, in Unerledigtes und das Fehlen an sich wurde groß. Und doch schien mir, dass mir in Systemischer Therapie wirklich etwas fehlen würde, wenn ich dem nicht nachginge.
Advent und das Fehlende gehören zusammen. Obwohl, genauer natürlich das noch Fehlende. Das noch Fehlende, dessen Kommen erwartet wird. Und dessen Kommen das tragende Motiv eines hoffnungsvollen Narrativs ist. Das gäbe jetzt zwar einen schönen Anfang, doch gerät der ins Wanken, wenn das Fehlende mit Systemischer Therapie zu tun haben soll. Wie das? Mir scheint, Systemische Therapie hat nichts mit Advent zu tun, kann es nicht, jedenfalls dann nicht, wenn sich ihre gedanklichen Begleiterscheinungen systemtheoretisch ableiten und sich auf diese Weise ihrer Funktionalität versichern. Da geht es nicht um Advent, sondern um Adjunkt, sozusagen, Erfolg als Fortsetzungsgeschichte. Was ist, ist auch schon wieder vorbei und nur sinnträchtig als Sprungbrett für Nachfolgendes. Sein als imaginärer Zustand und praktisch ein Reigen laufender Ereignisse. Systemtheorie als Fruchtbarkeitstheorie, um es einmal so zu sagen. Allgemein, als Theorie an sich – oder für sich? Im erlebten Leben ist die Dichotomie nicht so leidenschaftslos: schließt sich an/schließt sich nicht an. Noch ist Erleben keine Frage von 0 oder 1 und Lebenserzählungen noch keine Ausgeburt binärer Codes. Fehlt mir das? Nein, das fehlt mir nicht, was hat das hier zu suchen? Im Ernst, fehlt mir was in der Systemischen Therapie? Und wenn ja, wäre das jetzt ein systemtheoretischer Witz zu fragen: woran mache ich das fest? Was soll als umrissen gelten bei etwas, was permanent ausreißt? Systoria nicht zu vergessen, dass eingeschlafene Projekt, die Entwicklungen systemischen Denkens für psychosoziales Helfen gesammelt festzuhalten. Etwas, was fehlt… Ich nähere mich dem Thema, fürchte ich. Dabei hatte ich vor, diesmal nichts zu schreiben zum Adventskalender, die Frage nach dem Fehlenden in der Systemischen Therapie führte mich zu sehr in Widersprüche, in Unerledigtes und das Fehlen an sich wurde groß. Und doch schien mir, dass mir in Systemischer Therapie wirklich etwas fehlen würde, wenn ich dem nicht nachginge.  K.O., ein erfahrener Psychiater, systemischer Therapeut und langjähriger Kollege, der für die psychiatrische Triage in einem grösseren medizinischen Zentrum zuständig ist, fragt mich tel. an für die Fortsetzung einer Therapie bei Frau B., 32j., Mutter von zwei Kleinkindern. Ihr Ehemann sei vor kurzem vor ihren Augen auf einem Fussgängerstreifen zu Tode gefahren worden. „Hier braucht es wohl mehr „Traumatherapie“ als die zwei, drei Sitzungen, die ich ihr anbieten/durchführen konnte“, in der Hoffnung, dass ich diesen „nicht ganz alltäglichen“ Fall übernehmen/weiterführen und Frau B. bei mir auch Anschluss finden kann.
K.O., ein erfahrener Psychiater, systemischer Therapeut und langjähriger Kollege, der für die psychiatrische Triage in einem grösseren medizinischen Zentrum zuständig ist, fragt mich tel. an für die Fortsetzung einer Therapie bei Frau B., 32j., Mutter von zwei Kleinkindern. Ihr Ehemann sei vor kurzem vor ihren Augen auf einem Fussgängerstreifen zu Tode gefahren worden. „Hier braucht es wohl mehr „Traumatherapie“ als die zwei, drei Sitzungen, die ich ihr anbieten/durchführen konnte“, in der Hoffnung, dass ich diesen „nicht ganz alltäglichen“ Fall übernehmen/weiterführen und Frau B. bei mir auch Anschluss finden kann.