In einem gerade erschienenen Beitrag für das Online-Journal Psychotherapie Wissenschaft stellt Serge Sulz aus der Schweiz, Honorarprofessor für Grundlagen der Verhaltensmedizin und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie an der Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt, noch einmal eine Übersicht über die Argumente vor, dass es sich bei der Psychotherapie nicht um eine Wissenschaft und auch nicht um angewandte Wissenschaft handelt, sondern immer um einen professionellen Prozess einer jeweils individuell einzigartigen Begegnung, der zwar durch wissenschaftliche Erkenntnisse grundiert und angeregt werden kann, aber nicht von diesen determiniert werden kann. Im abstract heißt es: „In Deutschland wird Psychotherapieausbildung in die Hände von Wissenschaftlern gegeben und die praktische Ausbildung hintangestellt. Dies führt zur Frage, inwiefern und in welchem Ausmaß Psychotherapie Wissenschaft ist. Beginnend mit einer Diskussion von Psychologie als Wissenschaft und ihren Fehlentwicklungen und Stagnationen wird zur Frage übergegangen, ob Psychotherapie Wissenschaft ist, die von den Wissenschaftlern bejaht wird. Die praktizierenden Psychotherapeuten dagegen sagen, dass sie eine Kunst ist, die auf Wissenschaft aufbaut, aber mehr ist als diese. Sie leiten daraus ab, dass diese Kunst nicht von Wissenschaftlern gelehrt werden kann. Aber auch unter den Wissenschaftlern herrscht keine Einigkeit. Die einen forschen unter experimentellen, laborähnlichen Bedingungen, während ihre Ergebnisse von den anderen als ungültig für die reale Welt außerhalb des Labors betrachtet werden. Schließlich wird der Frage nachgegangen, wo und wie die Kunst der Psychotherapie gelernt werden kann.“
31. August 2015
von Tom Levold
3 Kommentare



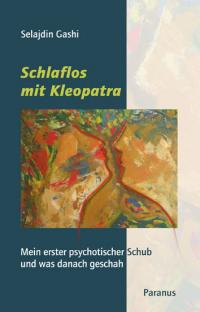
 In der aktuellen Ausgabe von Family Process stehen Forschungsarbeiten im Mittelpunkt, vor allem Arbeiten aus einer Forschungsgruppe, die sich mit familiären Mustern (Gender, Elternschaft, Übertragung kultureller Wertvorstellungen etc.) von Familien in den USA beschäftigen, die einen mexikanischen Migrationshintergrund haben. Eine Arbeit von Conroy Reynolds und Carmen Knudson-Martin thematisiert „Gender and the Construction of Intimacy among Committed Couples with Children“, Luana Ferreira, Peter Fraenkel u.a. finden in einer Studie heraus, dass Autonomie und Veränderung das Begehren in Paarbeziehungen unterstützt, während Konflikte und Kinder beeinträchtigende Faktoren sind (sic!). Ein interessanter Artikel untersucht, inwieweit das Konzept der „Boundary Ambiguity“ Erklärungsmöglichkeiten dafür anbietet, warum misshandelte Frauen ihre Partner nicht verlassen. Christina Hunger, Jan Weinhold et al. präsentieren hier noch einmal die auf Deutsch schon präsentierten Ergebnisse ihrer Untersuchung der Effekte von Aufstellungsseminaren. Bemerkenswert ist vor allem ein sehr offen kritisches Editorial des Herausgebers Jay Lebow über Interessenkonflikte von Autoren bei Veröffentlichungen in Family Process, in dem er deutlich macht, dass viele Familienforschungsprojekte ebenso wie neue Therapiekonzepte in erster Linie den Zweck verfolgen, die Arbeit der AutorInnen bekannt zu machen und zu Erfolg zu verhelfen. Dies gilt natürlich in besonderer Weise für Arbeiten der Selbstbeforschung bzw. Selbstevaluation, die selten den Zweck verfolgen, die eigene Arbeit kritisch unter die Lupe zu nehmen. Gleichwohl dürften, da Lebow zufolge das allgemeine Interesse an diesen Arbeiten eher gering ausfällt, solche Arbeiten kaum das Licht der Welt erblicken, wenn man hier zu strenge Maßstäbe hinsichtlich möglicher Interessenkonflikte anlegen würde. Deshalb plädiert er für eine abgewogene Publikationspolitik. Für die Family Process gelten aber ab 2015 neue Richtlinien für die Veröffentlichung von Interessenkonflikten, die über die Bekanntgabe finanzieller Zuwendungen (die ja eher bei medizinischen Veröffentlichungen seitens der Pharma-Konzerne ein Problem darstellen) auch andere Konflikte benennen müssen.
In der aktuellen Ausgabe von Family Process stehen Forschungsarbeiten im Mittelpunkt, vor allem Arbeiten aus einer Forschungsgruppe, die sich mit familiären Mustern (Gender, Elternschaft, Übertragung kultureller Wertvorstellungen etc.) von Familien in den USA beschäftigen, die einen mexikanischen Migrationshintergrund haben. Eine Arbeit von Conroy Reynolds und Carmen Knudson-Martin thematisiert „Gender and the Construction of Intimacy among Committed Couples with Children“, Luana Ferreira, Peter Fraenkel u.a. finden in einer Studie heraus, dass Autonomie und Veränderung das Begehren in Paarbeziehungen unterstützt, während Konflikte und Kinder beeinträchtigende Faktoren sind (sic!). Ein interessanter Artikel untersucht, inwieweit das Konzept der „Boundary Ambiguity“ Erklärungsmöglichkeiten dafür anbietet, warum misshandelte Frauen ihre Partner nicht verlassen. Christina Hunger, Jan Weinhold et al. präsentieren hier noch einmal die auf Deutsch schon präsentierten Ergebnisse ihrer Untersuchung der Effekte von Aufstellungsseminaren. Bemerkenswert ist vor allem ein sehr offen kritisches Editorial des Herausgebers Jay Lebow über Interessenkonflikte von Autoren bei Veröffentlichungen in Family Process, in dem er deutlich macht, dass viele Familienforschungsprojekte ebenso wie neue Therapiekonzepte in erster Linie den Zweck verfolgen, die Arbeit der AutorInnen bekannt zu machen und zu Erfolg zu verhelfen. Dies gilt natürlich in besonderer Weise für Arbeiten der Selbstbeforschung bzw. Selbstevaluation, die selten den Zweck verfolgen, die eigene Arbeit kritisch unter die Lupe zu nehmen. Gleichwohl dürften, da Lebow zufolge das allgemeine Interesse an diesen Arbeiten eher gering ausfällt, solche Arbeiten kaum das Licht der Welt erblicken, wenn man hier zu strenge Maßstäbe hinsichtlich möglicher Interessenkonflikte anlegen würde. Deshalb plädiert er für eine abgewogene Publikationspolitik. Für die Family Process gelten aber ab 2015 neue Richtlinien für die Veröffentlichung von Interessenkonflikten, die über die Bekanntgabe finanzieller Zuwendungen (die ja eher bei medizinischen Veröffentlichungen seitens der Pharma-Konzerne ein Problem darstellen) auch andere Konflikte benennen müssen.