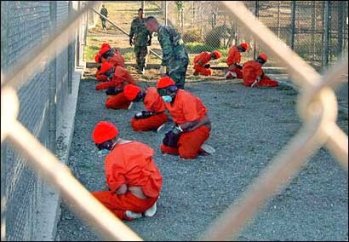Matthias Lauterbach ist in der letzten Zeit durch seine beraterischen und publizistischen Aktivitäten in Sachen Gesundheitscoaching verstärkt in der Öffentlichkeit präsent gewesen. In seinem Aufsatz für die Systemische Bibliothek beschäftigt er sich auf angenehm zu lesende und nachdenklich machende Weise mit der Balance von Arbeit und Leben, neudeutsch auch gerne Work-Life-Balance genannt. Wir sind Lauterbach zufolge ständig auf der Reise zwischen den unterschiedlichen Welten und dabei ist insbesondere die Bewältigung der Übergänge von Interesse. Hierfür„survival kits“ zu entwickeln ist sein Anliegen:„Survival kits nimmt man auf Reisen mit, um für den extremen Notfall gerüstet zu sein (Flugzeugabsturz in der Sahara, Reifenpanne am Nordpol
). Je nach Sicherheit des Reiselandes und der Reiseart und je nach dem Absicherungsbedürfnis des Reisenden kommt das Kit zum Einsatz. Wenn wir die unterschiedlichen Lebenswelten wie Arbeitswelt, Familie, Hobby etc., die von Menschen bevölkert werden, mit geographischen Metaphern beschreiben, bietet sich das Reisen als Metapher für den ständigen Wechsel der Menschen zwischen diesen Welten an. Das ist auch nicht abwegig, da viele Menschen tatsächlich zwischen diesen Welten reisen, seien es Arbeitswege oder die Wege zu einem entfernt stattfindenden Bundesligaspiel. In diesem Bild bleibend stellen sich Fragen nach den notwendigen Vorbereitungen für diese Reisen, nach der Ausstattung, dem Kartenmaterial, den Schutzimpfungen etc. und nicht zuletzt nach der inneren, seelischen Vorbereitung und der Konzentration auf die Reise“
Matthias Lauterbach ist in der letzten Zeit durch seine beraterischen und publizistischen Aktivitäten in Sachen Gesundheitscoaching verstärkt in der Öffentlichkeit präsent gewesen. In seinem Aufsatz für die Systemische Bibliothek beschäftigt er sich auf angenehm zu lesende und nachdenklich machende Weise mit der Balance von Arbeit und Leben, neudeutsch auch gerne Work-Life-Balance genannt. Wir sind Lauterbach zufolge ständig auf der Reise zwischen den unterschiedlichen Welten und dabei ist insbesondere die Bewältigung der Übergänge von Interesse. Hierfür„survival kits“ zu entwickeln ist sein Anliegen:„Survival kits nimmt man auf Reisen mit, um für den extremen Notfall gerüstet zu sein (Flugzeugabsturz in der Sahara, Reifenpanne am Nordpol
). Je nach Sicherheit des Reiselandes und der Reiseart und je nach dem Absicherungsbedürfnis des Reisenden kommt das Kit zum Einsatz. Wenn wir die unterschiedlichen Lebenswelten wie Arbeitswelt, Familie, Hobby etc., die von Menschen bevölkert werden, mit geographischen Metaphern beschreiben, bietet sich das Reisen als Metapher für den ständigen Wechsel der Menschen zwischen diesen Welten an. Das ist auch nicht abwegig, da viele Menschen tatsächlich zwischen diesen Welten reisen, seien es Arbeitswege oder die Wege zu einem entfernt stattfindenden Bundesligaspiel. In diesem Bild bleibend stellen sich Fragen nach den notwendigen Vorbereitungen für diese Reisen, nach der Ausstattung, dem Kartenmaterial, den Schutzimpfungen etc. und nicht zuletzt nach der inneren, seelischen Vorbereitung und der Konzentration auf die Reise“
Zur Systemischen Bibliothek
17. April 2007
von Tom Levold
Keine Kommentare



 Unter diesem Titel versammelt die neue Ausgabe von„perspektive mediation“ Beiträge, die sich mit Fragen der Verbandsgründungen, Ausbildungs- und Anerkennungsstandards in der Mediatorenweiterbildung beschäftigen und bringt Länderberichte aus Kroatien, Tschechien, Polen, Schottland, Italien, Schweden und Frankreich.
Unter diesem Titel versammelt die neue Ausgabe von„perspektive mediation“ Beiträge, die sich mit Fragen der Verbandsgründungen, Ausbildungs- und Anerkennungsstandards in der Mediatorenweiterbildung beschäftigen und bringt Länderberichte aus Kroatien, Tschechien, Polen, Schottland, Italien, Schweden und Frankreich. So lautet der Titel der Dissertation von Brigitte Gemeinhardt, systemische Psychotherapeutin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums HamburgEppendorf aus dem Jahre 2005.„Die zentrale Fragestellung der vorliegenden Arbeit ist die nach der Funktionalität des Symptoms der Alkoholabhängigkeit in der Mehrgenerationenperspektive auf verschiedenen Ebenen des familiären Systems. Die Betrachtung der den familiären Strukturen zugrunde liegenden Muster ist dabei ein wesentlicher Schritt zur Beantwortung dieser Fragestellung. Es wurde erwartet, dass die Ergebnisse zur Formulierung einer Theorie bezüglich der Funktionalitäten der Abhängigkeitserkrankung über die Generationen beitragen können. Zur Beantwortung dieser Fragestellung wurden die Muster in den Herkunftsfamilien von sechs Patienten mit einer Alkoholabhängigkeit betrachtet. Die Betroffenen befanden sich zum Zeitpunkt der Datenerhebung in der stationären Behandlung zum qualifizierten Alkoholentzug. Das Genogramm, ein in Therapie und Diagnostik etabliertes Instrument zur Strukturierung mehrgenerationaler Daten diente als Erhebungsinstrument. Die Ergebnisse zeigen in allen Biografien eine Funktionalität der Alkoholabhängigkeit auf unterschiedlichen Ebenen auf. Diese sind im Gesamtzusammenhang einzigartig, in vielen Facetten jedoch vergleichbar und stellen sich in einer großen Variationsbreite dar. So stellt die Erkenntnis, dass das Symptom der Suchtmittelabhängigkeit im familiär systemischen Kontext sowohl eine individuelle als auch eine familiäre bzw. beziehungsgestaltende Funktion einnehmen kann, ein wichtiges Ergebnis dar. Ein Symptom kann hier auch im systemischen Sinne – generell von anderen Familienmitgliedern übernommen, quasi vererbt werden. In einer Gesamtbetrachtung lassen die Ergebnisse verschiedene Schlüsse zu, die auf andere Familien von alkoholkranken Patienten übertragbar scheinen“
So lautet der Titel der Dissertation von Brigitte Gemeinhardt, systemische Psychotherapeutin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums HamburgEppendorf aus dem Jahre 2005.„Die zentrale Fragestellung der vorliegenden Arbeit ist die nach der Funktionalität des Symptoms der Alkoholabhängigkeit in der Mehrgenerationenperspektive auf verschiedenen Ebenen des familiären Systems. Die Betrachtung der den familiären Strukturen zugrunde liegenden Muster ist dabei ein wesentlicher Schritt zur Beantwortung dieser Fragestellung. Es wurde erwartet, dass die Ergebnisse zur Formulierung einer Theorie bezüglich der Funktionalitäten der Abhängigkeitserkrankung über die Generationen beitragen können. Zur Beantwortung dieser Fragestellung wurden die Muster in den Herkunftsfamilien von sechs Patienten mit einer Alkoholabhängigkeit betrachtet. Die Betroffenen befanden sich zum Zeitpunkt der Datenerhebung in der stationären Behandlung zum qualifizierten Alkoholentzug. Das Genogramm, ein in Therapie und Diagnostik etabliertes Instrument zur Strukturierung mehrgenerationaler Daten diente als Erhebungsinstrument. Die Ergebnisse zeigen in allen Biografien eine Funktionalität der Alkoholabhängigkeit auf unterschiedlichen Ebenen auf. Diese sind im Gesamtzusammenhang einzigartig, in vielen Facetten jedoch vergleichbar und stellen sich in einer großen Variationsbreite dar. So stellt die Erkenntnis, dass das Symptom der Suchtmittelabhängigkeit im familiär systemischen Kontext sowohl eine individuelle als auch eine familiäre bzw. beziehungsgestaltende Funktion einnehmen kann, ein wichtiges Ergebnis dar. Ein Symptom kann hier auch im systemischen Sinne – generell von anderen Familienmitgliedern übernommen, quasi vererbt werden. In einer Gesamtbetrachtung lassen die Ergebnisse verschiedene Schlüsse zu, die auf andere Familien von alkoholkranken Patienten übertragbar scheinen“ Am 2. und 3. März 2007 versammelten sich im Berliner Hotel Alexanderplatz, das sich irritierenderweise nicht am Alexanderplatz, sondern allenfalls in seiner näheren Umgebung befindet, ansonsten aber ein für den Zweck dieser Tagung bestens geeignet war, über 200 Supervisorinnen und Supervisoren der unterschiedlichsten Fachverbände zur zweiten Tagung des Verbändeforum Supervision. Das Verbändeforum ist ein lockerer Zusammenschluss mehrerer Berufs- und Fachverbände, der zur Förderung des Austausches über Verbandsperspektiven hinweg dienen soll. Die Tagung wurde mit einem Vortrag von Rudi Wimmer (Foto) eröffnet. Für den erkrankten Wolfgang Looss sprang spontan und souverän Heidi Möller (Innsbruck) ein. Die Evaluation der Tagung zeigte, dass Thema, Referenten und das Tagungsambiente gut bei den TeilnehmerInnen angekommen sind. Tom Levold hat einen Tagungsbericht geschrieben.
Am 2. und 3. März 2007 versammelten sich im Berliner Hotel Alexanderplatz, das sich irritierenderweise nicht am Alexanderplatz, sondern allenfalls in seiner näheren Umgebung befindet, ansonsten aber ein für den Zweck dieser Tagung bestens geeignet war, über 200 Supervisorinnen und Supervisoren der unterschiedlichsten Fachverbände zur zweiten Tagung des Verbändeforum Supervision. Das Verbändeforum ist ein lockerer Zusammenschluss mehrerer Berufs- und Fachverbände, der zur Förderung des Austausches über Verbandsperspektiven hinweg dienen soll. Die Tagung wurde mit einem Vortrag von Rudi Wimmer (Foto) eröffnet. Für den erkrankten Wolfgang Looss sprang spontan und souverän Heidi Möller (Innsbruck) ein. Die Evaluation der Tagung zeigte, dass Thema, Referenten und das Tagungsambiente gut bei den TeilnehmerInnen angekommen sind. Tom Levold hat einen Tagungsbericht geschrieben. Unter diesem Titel haben die Familiensoziologen Kurt Lüscher und Brigitte Pajung-Bilger 1998 eine ausgezeichnete, wenngleich derzeit nur noch antiquarisch erhältliche Untersuchung vorgelegt, in denen in„Interviews mit Geschiedenen und deren Eltern oder Kindern, ein Dreigenerationenmodell also, in dem immer zwei Generationen aus ihren jeweiligen Perspektiven zu den durch die Scheidung ausgelösten Prozessen befragt werden“ Oliver König schreibt 2000 in einer ausführlichen Besprechung:„Therapeuten wird es nicht verwundern, daß hier schon einige Zugangsprobleme auftauchen, signalisiert doch die Bereitschaft, über eine Scheidung mit einem Forscher zu reden, schon eine in Ansätzen reflexionsbereite Haltung und damit einen bestimmten Umgang mit der Scheidung. Für eine qualitative Forschung, die Struktur und Dynamik und nicht Repräsentativität im Auge hat, ist dies aber zweitrangig. Die zum Teil in direkter Gegenüberstellung dokumentierten Interviews und die in ihnen zur Geltung kommenden Deutungsmuster werden als Handlungsmaximen aufgefaßt, die sich aus der Spannung zwischen ,der normativen, institutionellen und der subjektiven, beziehungsgeschichtlichen Dimension sozialer Beziehungen‘ ergeben. Diese Deutungsmuster werden in einem Vierfelderschema über zwei Dimensionen differenziert“ Nach einer genauen Darstellung dieser Deutungsmuster fasst König resümierend zusammen:„Für die (Familien)Therapie bieten die Überlegungen der Autoren vielfältige anschlussfähige Ideen, z.B. für eine sozialwissenschaftlich, d.h. konsequent interpersonell orientierte Diagnostik, und zudem eine empirische Bestätigung für viele Annahmen der mehrgenerationalen Therapie. Besonders lesenswert sind die vielen Falldarstellungen, die im Gegensatz zu den üblicherweise in der psychotherapeutischen Literatur vorliegenden stark theoriegesättigt sind und in denen dennoch die interpretativen Verdichtungen individueller Geschichten beispielhaft nachvollzogen werden können“
Unter diesem Titel haben die Familiensoziologen Kurt Lüscher und Brigitte Pajung-Bilger 1998 eine ausgezeichnete, wenngleich derzeit nur noch antiquarisch erhältliche Untersuchung vorgelegt, in denen in„Interviews mit Geschiedenen und deren Eltern oder Kindern, ein Dreigenerationenmodell also, in dem immer zwei Generationen aus ihren jeweiligen Perspektiven zu den durch die Scheidung ausgelösten Prozessen befragt werden“ Oliver König schreibt 2000 in einer ausführlichen Besprechung:„Therapeuten wird es nicht verwundern, daß hier schon einige Zugangsprobleme auftauchen, signalisiert doch die Bereitschaft, über eine Scheidung mit einem Forscher zu reden, schon eine in Ansätzen reflexionsbereite Haltung und damit einen bestimmten Umgang mit der Scheidung. Für eine qualitative Forschung, die Struktur und Dynamik und nicht Repräsentativität im Auge hat, ist dies aber zweitrangig. Die zum Teil in direkter Gegenüberstellung dokumentierten Interviews und die in ihnen zur Geltung kommenden Deutungsmuster werden als Handlungsmaximen aufgefaßt, die sich aus der Spannung zwischen ,der normativen, institutionellen und der subjektiven, beziehungsgeschichtlichen Dimension sozialer Beziehungen‘ ergeben. Diese Deutungsmuster werden in einem Vierfelderschema über zwei Dimensionen differenziert“ Nach einer genauen Darstellung dieser Deutungsmuster fasst König resümierend zusammen:„Für die (Familien)Therapie bieten die Überlegungen der Autoren vielfältige anschlussfähige Ideen, z.B. für eine sozialwissenschaftlich, d.h. konsequent interpersonell orientierte Diagnostik, und zudem eine empirische Bestätigung für viele Annahmen der mehrgenerationalen Therapie. Besonders lesenswert sind die vielen Falldarstellungen, die im Gegensatz zu den üblicherweise in der psychotherapeutischen Literatur vorliegenden stark theoriegesättigt sind und in denen dennoch die interpretativen Verdichtungen individueller Geschichten beispielhaft nachvollzogen werden können“ In der Systemischen Bibliothek erscheint heute eine Arbeit von Alexander Trost aus dem Jahre 1998. Der Autor schreibt:„Der folgende Aufsatz ist aus der persönlichen und beruflichen Verknüpfung von TZI und systemischem Denken und Handeln während der letzten 8 Jahre entstanden. Konkreter Anlaß für einen Vergleich war eine Arbeitsgruppe beim Internationalen Austauschworkshop 1995 in Wien. Nach einem kurzen Abriß der Charakteristika von TZI und systemischer Arbeit stelle ich beide Ansätze anhand eines wissenschaftstheoretischen Modells gegenüber, um dann ihren jeweiligen Beitrag zum Erreichen spielerischer Lösungen in Problemsituationen herauszuarbeiten. Den Abschluß bildet eine Darstellung der Lösungsorientierten Kurztherapie nach de Shazer, verbunden mit der Fragestellung, wie diese auch von der TZI genutzt werden kann
(oder schon genutzt wird???)“
In der Systemischen Bibliothek erscheint heute eine Arbeit von Alexander Trost aus dem Jahre 1998. Der Autor schreibt:„Der folgende Aufsatz ist aus der persönlichen und beruflichen Verknüpfung von TZI und systemischem Denken und Handeln während der letzten 8 Jahre entstanden. Konkreter Anlaß für einen Vergleich war eine Arbeitsgruppe beim Internationalen Austauschworkshop 1995 in Wien. Nach einem kurzen Abriß der Charakteristika von TZI und systemischer Arbeit stelle ich beide Ansätze anhand eines wissenschaftstheoretischen Modells gegenüber, um dann ihren jeweiligen Beitrag zum Erreichen spielerischer Lösungen in Problemsituationen herauszuarbeiten. Den Abschluß bildet eine Darstellung der Lösungsorientierten Kurztherapie nach de Shazer, verbunden mit der Fragestellung, wie diese auch von der TZI genutzt werden kann
(oder schon genutzt wird???)“