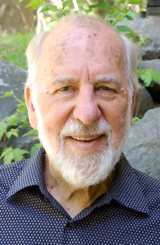
Heute gilt es, den 85. Geburtstag von Norbert Wetzel zu feiern, einem Mitglied der frühen familientherapeutischen Bewegung in Deutschland. In den 70er Jahren arbeitete er am Heidelberger Institut für psychoanalytische Grundlagenforschung und Familientherapie bei Helm Stierlin und war Mitautor des für viele wegweisenden Buches Das erste Familiengespräch. Seine eigene familientherapeutische Ausbildung machte er er u.a. bei Salvador Minuchin, Jay Haley, Kitty LaPerriere, Don Bloch, und Charles Fishman in den USA, in die er Ende der 70er Jahre auswanderte. Neben seiner Hochschullehre widmete er sich in den vergangenen Jahrzehnten vor allem der systemischen Gemeinwesenarbeit, ein Feld, das hierzulande wohl eher stiefmütterlich behandelt wird – jedenfalls was die öffentliche Wahrnehmung betrifft. Von 1994 bis 2014 war er als Mitbegründer Direktor des Weiterbildungsbereiches des Center for Family, Community, and Social Justice in Princeton, New Jersey. In diesem Feld ist Norbert Wetzel nach wie vor – auch als Mitglied des Princeton Family Institutes – engagiert. Sein Schwerpunkt war und ist die Ausbildung von „Minderheiten“-Fachkräften im Bereich der psychischen Gesundheit für die Arbeit mit verschiedenen Bevölkerungsgruppen in unterversorgten städtischen Gebieten. Er hat in diesem Kontext den Ansatz einer „beziehungsorientierten und kontextsensitiven Familiensystemtherapie“ (RCFST: Relationship-oriented and Context-sensitive Family Systems Therapy) als Alternative zu den verbreiteten medikalisierten und pharmakotherapeutischen Ansätzen zur Behandlung „psychischer Krankheiten“ entwickelt. Ein wichtiges Anliegen ist die Integration von Familiensystemtherapie und der Aktivierung von Familienangehörigen in der Primärversorgung und der medizinischen Versorgung chronisch kranker Patienten.
Eine Liste von Veröffentlichungen Norbert Wetzels finden Sie in der Systemischen Geschichtswerkstatt und nachfolgend können Sie die Würdigung von Michael Wirsching lesen, der in den 70er Jahren mit Norbert Wetzel in Heidelberg zusammengearbeitet hat.
Lieber Herr Wetzel, zum Geburtstag wünscht systemagazin Ihnen alles Gute, weiterhin viel Energie und Schaffenskraft und die Gesundheit, die es dazu braucht!
Michael Wirsching, Freiburg: Zum 85. Geburtstag von Norbert Wetzel (Frankfurt, Heidelberg, Princeton)
Ja, ie Systemische Therapie wird älter und mit ihr altern auch die Frauen und Männer der ersten Stunde.
Einer von denen, der uns Allen liebe und wichtige Norbert Wetzel ist in den fernen USA zum 85. Geburtstag zu beglückwünschen. Dort ist er nun schon seit Jahrzehnten das soziale Gewissen der Systemischen Therapie. Schon lange, bevor Trump alles auf die Spitze getrieben hat, hat er das soziale Ungleichgewicht vieler heutiger Gesellschaften am Beispiel seiner Wahlheimat USA angeprangert und tatkräftig bekämpft. Als Hochschullehrer an der Rutgers University sowie als Gründer und Leiter des Zentrums für Familie, Gemeinde und Soziale Gerechtigkeit in New Jersey. Gründer, der er ist, hat er auch noch das bis heute bestehende Princeton Family Institute geschaffen. Der Urzelle, dem New Yorker Ackermann Institut nachfolgend, steht auch hier das soziale Engagement, vor allem der Einsatz für sozial benachteiligte (meist farbige) Jugendliche in den elenden Großstadtslums ganz vorne an. Dazu gehört natürlich auch der Kampf gegen die alltägliche Gewalt, der diese jungen Menschen von Anbeginn ausgesetzt sind. Der Anfang dieser Arbeit war bereits in den 60ern in der Frankfurter Telefonseelsorge und in der ebenfalls von ihm begründeten sozialtherapeutischen Beratungsstelle „Offene Tür“ in Frankfurt am Main gelegt.
Zur Systemischen Therapie, damals noch Familientherapie genannt, kam Norbert Wetzel Mitte der siebziger Jahre in Heidelberg. Helm Stierlin, der gerade aus dem US NIMH als Leiter der Abteilung für psychoanalytische Grundlagenforschung und Familientherapie an die Psychosomatische Uniklinik Heidelberg berufen worden war, hatte ihn schon in den USA „entdeckt“, wo Norbert Wetzel an zwei renommierten Ausbildungs, Forschungs- und Behandlungszentren, dem Menninger Institut und dem Ackermann Institut arbeitete.
Da hatten sich zwei Philosophen gefunden: der bei Jaspers promovierte Arzt Helm Stierlin und der in Theologie und Philosophie promovierte Norbert Wetzel. Zum Heidelberger Team gehörten noch die beiden klinischen Psychologinnen Satuila Stierlin, Helms Ehefrau und Ingeborg Rücker-Emden, die so früh verstarb. Etwas später kam noch der Psychiater Gunthard Weber dazu. Als junger Oberarzt war ich selbst, nach 68er Medizinstudium an der FU Berlin, mittendrin. Jochen Schweitzer war Zivi, Gunther Schmidt und Wolfgang Trenkle Psychologiestudenten. Ab jetzt wurde fleißig theoretisiert und philosophiert, im Kontakt mit vielen internationalen Expert:innen, zu denen Norbert und Helm in USA, Ingeborg in Kanada und Gunthard in Mailand Kontakt hatten. Das Heidelberger Konzept nahm Gestalt an und wurde im „Ersten Familiengespräch“ als Gemeinschaftswerk veröffentlicht, und im gleichen Verlag (Klett) kam noch die Zeitschrift „Familiendynamik“ dazu. Eine immer rappelvolle Vorlesung, zahllose Workshops und ein erstes Ausbildungsprogramm legten den Grundstein für das, was Heidelberg bis heute so wichtig macht. Norbert war in diesen entscheidenden Jahren dabei. Seine Beiträge waren die humanistische Philosophie und die soziale Verantwortung. Beides sind Grundpfeiler, die in der Begeisterung für neue Methoden und Techniken, beinahe zu kurz gekommen wäre, ohne den steten Mahner Norbert Wetzel.
Ende der 70er Jahre trennten sich schon die Wege. Norbert ging mit seiner Frau Hinda nach Princeton, ich machte Fritz Simon Platz und folgte Rufen nach Gießen und Freiburg.
Mit Norbert sind wir alle bis heute sehr herzlich verbunden. Unvergessen sind seine zahlreichen Vorträge und Workshops auf unseren Tagungen, die immer für soziale Gerechtigkeit stritten. Gern gelesen auch seine Lehrbuchbeiträge zur Philosophie der systemischen Familientherapie.
Norbert, lieber älterer Freund, viel Glück und Gesundheit und ein schönes Leben auch im nächsten Abschnitt.
Michael Wirsching






