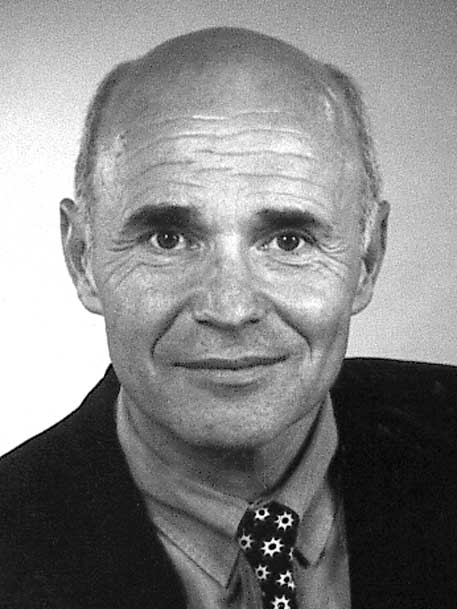Wellenwriter und -reiterinnen
Wie fange ich an?
Schön weit weg – das wird ein „Überblicksartikel“: auf dem Mars und auf der Venus.
Ich bin nämlich „ein Kind der Unterschiedsliteratur“, oder sagen wir besser: Ich ging in die Paartherapeuten-Lehre, als Dr. John Gray aus Kalifornien mit seinem Bestseller auch bei uns Furore machte. Und das mit einer Binsenweisheit, die lautet: Männer sind anders, Frauen auch. Das war der Haupttitel. Aha, das ist ja ’n Ding! Untertitel der damaligen „Pflichtlektüre“: Männer sind vom Mars. Frauen von der Venus. (Also ganz schön weit voneinander getrennt …)
Und weil diese Metapher der verschiedenen Planeten offenbar eine „Erklärungslücke“ schloss, kam natürlich bald danach das praktische Handbuch dazu: Mars, Venus und Partnerschaft mit so wertvollen Tipps wie: Wie er lernt, ihr zuzuhören, ohne aus der Haut zu fahren bzw. Was sie tun muss, damit er ihr zuhört oder Warum Männer so vergesslich sind und Frauen sich an alles erinnern.
Hoch lebe die vereinfachende Schubladen-Welterklärung! Alle Beziehungsprobleme lassen sich lösen, wenn man die Unterschiede kennt, die Frauen und Männer von wo auch immer – sicher schon seit der Steinzeit – mitbringen.
Aber, ich gestehe: Irgendwie hatte das was. Endlich mal ein konkretes Pack-an, warum das oft so kompliziert ist mit der Verständigung zwischen den Geschlechtern. Ich war doch gerade wild entschlossen, als Paar- und Familientherapeut zu eben dieser Verständigung positiv-aufklärend beizutragen. Darüber musste ich doch Bescheid wissen.
Nach oder mit Dr. Gray ging es dann Schlag auf Schlag – ein Markt war gefunden und wurde systematisch erschlossen. Wer will denn nicht wissen, wie sein Mann bzw. seine Frau „wirklich tickt“. Der Alltag ist ja schon anstrengend genug …
Das australische Ehepaar Allan und Barbara Pease – laut Klappentext gehören sie zu den führenden Kommunikationstrainern der Welt – schenkten uns als schnelle Taschenbuch-Lektüre Ganz natürliche Erklärungen für eigentlich unerklärliche Beziehungen. (Auf einer Bahnfahrt Hamburg-Köln durchzuarbeiten!) Der entsprechende Haupttitel aus der legendär gewordenen „Warum-Sparte“ lautete: Warum Männer lügen und Frauen immer Schuhe kaufen.
(Man achte auf das immer im Titel. Laut Manfred Priors MiniMax-Intervention Nummer 4 stimmt Immer in Verbindung mit einem Symptom nie!)
Der erste „Aufklärungs-Knüller“ des Ehepaar Pease half uns schon mit Antworten auf die Frage: Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken: Ein Kasten-Zitat von Seite 232: Ganze Männer weinen auch, allerdings nur, wenn ihr Gefühlssegment in der rechten Gehirnhälfte aktiviert ist. Genau, ahnte ich es doch! Bin ich denn wirklich (schon) ein ganzer Mann?
Oder auf Seite 251 – Achtung Kalauer: Was ist der Unterschied (sic! Anm. d. A.) zwischen einem Mann in der Midlife-Krise und einem Zirkusclown? Antwort: Der Zirkusclown weiß, dass er komische Klamottem anhat … (Okay, ausgesprochen müder Publikums-Applaus!)
Passend zu der aufkommenden „Simplify“-Mode warf auch die amerikanische Seminarleiterin Cris Evatt ihren Hut in den Ring der Unterschiedsliteratur. Laut Klappentext lernt man bei ihr, wie man sich das Leben leichter macht („Simply Organized!“).
So bringt sie naturgemäß ebenso bahnbrechende wie simple Unterschiede zwischen den Geschlechtern auf den Punkt: Respektiert werden ist für Männer wichtiger als für Frauen. (Überschrift auf Seite 46 – Das Zitat zeige ich meiner Frau lieber nicht …) oder auf Seite 82: Recht haben ist Männern wichtiger als Frauen (nach 25 Jahren Paarberatung bin ich da nicht so sicher …).
Ach, das bringt Spaß, die alten Unterschieds-Schinken noch einmal aus dem Regal zu klauben und durchzublättern. Hier ein Schmunzeln, hier ein Kopfschütteln, und dann doch eher der Impuls: Schnell wieder zurück ins Regal!
Damals fand ich das hoch spannend, vor allem weil ich mich und meine Verflossenen tatsächlich immer mal wieder in diesen Simplify-Schubladen wiederentdeckte.
Wir gingen in die Broadway-Theater-Klassiker Caveman und Cavewoman und ich merkte mir zum Beispiel den Unterschieds-Satz vom Kollegen Michael Mary aus seinem Ratgeber Schluss mit dem Beziehungskrampf: Männer leiden in Beziehungen eher unter der Enge, Frauen eher unter dem Mangel.
Den fand ich brauchbar griffig, um ihn in Beratungen im Hinterkopf zu behalten.
Dann betrat auch noch der schreibende Chaot (Selbstbeschreibung in der Buchwidmung) Mario Barth aus Berlin die (Comedy)Bühne. Ich zitiere hier (laut Wikipedia-Eintrag) die Titel seiner Soloprogramme, mit denen er Stadien füllte: 2001: Männer sind Schweine, Frauen aber auch! 2006: Männer sind primitiv, aber glücklich! 2009: Männer sind peinlich, Frauen manchmal auch! 2012: Männer sind schuld, sagen die Frauen! 2015: Männer sind bekloppt, aber sexy! 2018: Männer sind faul, sagen die Frauen! 2022: Männer sind Frauen, manchmal aber auch … vielleicht!
Geht’s denn noch konsequenter (und ermüdender) mit der Schubladen-Zuschreibung?!
Sein Langenscheidt-Bestseller Deutsch-Frau, Frau-Deutsch versprach zudem folgerichtig Schnelle Hilfe für den ratlosen Mann, ein genialer Marketing-Coup. Ich verweigere Ihnen an dieser Stelle die „Erleuchtung“ durch illustre Zitate aus dieser Macho-Fibel (oder -Bibel?).
Als das „Umsatz-Pferd der Unterschiedsliteratur“ zu lahmen begann, weil es – übermäßig beansprucht – schon fast totgeritten worden war, kam eine neue Welle, und die ließ sich mit dem Titel des Mega-Sellers von Beziehungs- und Karrierecoach Eva-Maria Zurhorst auf den Punkt bringen: Liebe dich selbst, und es ist egal, wen du heiratest. Wer hat sich wohl diesen koketten, im Grunde völlig bescheuerten Titel ausgedacht?
Die nächste Stufe wurde gezündet: Unterschiede zwischen Frauen und Männern? Egal, Hauptsache, du weißt, wer du bist und was du willst!
Getoppt dann in den letzten Jahren noch durch die zahlreichen Erfolgs-Titel von Stefanie Stahl unter dem programmatischen Motto: Das Kind in dir muss Heimat finden.
Über die (vermeintlich nachweisbaren oder auch nur vermuteten) Unterschiede zwischen Frauen und Männern war das Publikum jetzt offenbar ausreichend aufgeklärt, jetzt wurde die „persönliche Reise nach innen bzw. in die eigene Kindheit“ (wieder) das Gebot der Stunde.
Jetzt sollte man in seinen Beziehungen selbst „einen Unterschied machen, der einen Unterschied macht“, indem man sich mit den Licht- und Schatten-Erfahrungen der eigenen Vergangenheit konfrontierte. In der Hoffnung, dass es die Partnerin bzw. der Partner auch tun möge.
Da kann ich durchaus mitgehen, dass ist sicher hilfreich für eine verständnisvollere Kommunikation in Beziehungen, wenn ich über mich und meine Prägungen Bescheid weiß.
Aber warum muss das alles immer so kategorisch, ausschließlich, imperativ daherkommen?
Nach der Maxime: Kauf dieses Buch und befolge meine Ratschläge! Dann wirst du (endlich) beziehungsfähig, erfolgreich, zufrieden, glücklich … (Aufzählung bitte selbst fortsetzen)!
Aber auch nur so!
Was kommt wohl als Nächstes? Man darf gespannt sein. Oder auch nicht. (Wählen Sie bitte selbst.)
Ich stelle während dieser reflektierenden Regal-Reise für mich fest: In meinem Hirn-Depot haben sich im Laufe der Jahre durchaus einige „Erkenntnisse aus der Unterschiedsliteratur“ angesammelt, nicht zuletzt u.v.a. auch aus den Büchern von John M. Gottman, Gary Chapmann und David Schnarch, die ich hier natürlich nicht unerwähnt lassen kann. Ich nahm mir vor, sie „privat“ als Optionen abzulegen und sie den ratsuchenden Paaren nicht plump als „empirische Wahrheiten“ auf dem Beratungs-Tablett zu servieren. Immer unter dem Fragen-Motto: Was halten Sie zum Beispiel von der These, dass Frauen und Männer unterschiedlich denken, fühlen, lieben, streiten, trauern? Dass sie Unterschiedliches brauchen, wünschen, anstreben und dass sie dabei unterschiedlich vorgehen? Wie erleben Sie das in Ihrer Beziehung?
Und schon kommt man ins Gespräch, nicht allgemein-vereinfachend, sondern konkret persönlich erlebt und jetzt im gemeinsamen Reflexions-Fokus.
Ein mir eindrücklich erinnnerbares Unterschieds-Beispiel zum Schluss:
Frau A. formuliert in der dritten Beratungssitzung, sie leide sehr darunter, dass sie sich von ihrem Mann nicht ausreichend unterstützt fühle, wenn sie belastet und erschöpft sei. Auch bei der Betreuung ihrer zwei kleinen Kinder, immer sei sie so alleine zu Hause … Ihr kommen die Tränen. Herr A. schaut betroffen auf seine Fußspitzen.
Mein Hirn-Depot liefert mir einen Info-Impuls aus der Vorgeschichte: War da nicht was in der Familie von Herrn A.?
Beide sind bereit, auf mein Angebot einzugehen, die Familiengenogramme aufzumalen.
Und Herr A., 35 Jahre, erzählt: „Ich bin ja der Älteste von drei Geschwistern. Meine kleine Schwester Marie ist sechs Jahre jünger und mein mittlerer Bruder Michael ist zwei Jahre nach mir geboren.“ Pause. „Und Michael ist seit damals behindert geblieben, da ist nach der Geburt was Gravierendes schiefgelaufen im Krankenhaus. Meine Mutter hat ihn achtzehn Jahre zu Hause gepflegt. Vor fünfzehn Jahren ist er dann gestorben.“ Pause. „Das war sehr schwer für meine Mutter.“
Ich frage vorsichtig nach: „Und für Sie?“
Herr A. schaut auf den aufgemalten Genogrammbeginn, dann sagt er zögernd: „Ich glaube, es war gut, dass meine Mutter entlastet wurde …“
„Entlastet …“, wiederhole ich.
„Ja, das war eigentlich zu viel für Mama, achtzehn Jahre Sorge und kein Ende in Sicht … Das war schon sehr schwer für sie.“
Ich schaue zu Frau A., sie weint erneut.
Vielleicht ist es zu früh, aber ich versuche, eine Brücke zu schlagen, indem ich mich an Herrn A. wende: „Was meinen Sie? Kann es sein, dass Ihre Erfahrungen von klein auf an, mit Michael, Marie und Ihrer Mutter – und was hat Ihre Mutter alles geleistet –, dass das alles auch Auswirkungen auf Ihre heutige Beziehung hat?“
Herr A. schaut mich an, dann lange zu seiner Frau, dann wieder auf die ersten Genogramm-Symbole. Schließlich sagt er: „Wahrscheinlich schon – sicher!“
Pause. Ein Anfang ist gemacht.
In der Folgesitzung berichtet das Ehepaar A. von weiteren guten Gesprächen über ihre unterschiedlichen Erfahrungen mit Erschöpfung, Hilflosigkeit und gefühlter Aussichtslosigkeit. Frau A. zeigt sich erleichtert.
Mein Ausbilder Martin Kirschenbaum (1928 – 2012) fasste die Sache mit den Unterschieden wie folgt zusammen: Natürlich geht es in Paarberatungen immer (!) darum, wie die Beteiligten mit den Unterschieden ihrer Prägungen, ihrer Herkünfte, ihrer Wünsche, Erwartungen, Zielen und ihrem unschiedlichem Kommunikations- und Lösungs-Know-how umgehen. Konfrontativ und in Streitschleifen ums Rechthaben gefangen („Mach es doch endlich, wie ich es gewohnt bin!“), oder wohlwollend, respektvoll und mit dem anhaltenden Zugang zu liebenden Gefühlen („Okay, du bist anders, erzähl mir bitte mehr darüber …“).
Also: Die Welt ist Unterschied, Unterschiede sind die Welt.
Da muss ich nicht auf den Mars fliegen, das merke ich schon bei uns im Wohnzimmer. Und im Schlafzimmer. Ach ja, Moment – ich glaube, auch in der Küche … Und beim Autofahren … Und …
Hartwig Hansen, Hamburg
www.beratung-supervision-hamburg.de