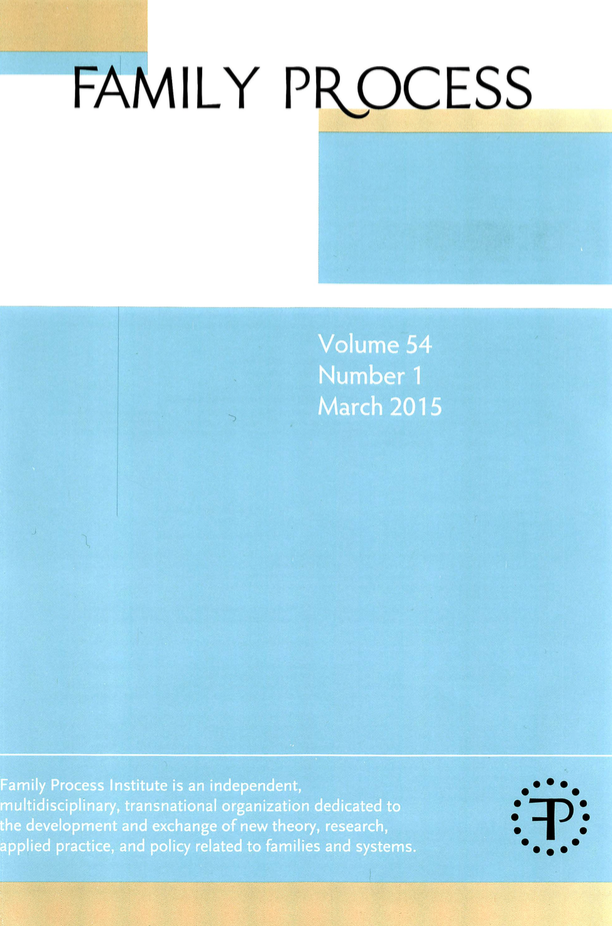Josef Duss-von Werdt (2015)
homo mediator
Unter diesem Titel hat Josef Duss-von Werdt seine Arbeit über „Geschichte und Menschenbilder der Mediation“ 2005 im Klett-Cotta-Verlag veröffentlicht. 2015 ist sie im Schneider-Verlag Hohengehren in einer überarbeiteten Neufassung erschienen. Gerda Mehta aus Wien, Systemische Therapeutin und Mediatorin, hat das Buch für systemagazin rezensiert und resümiert: „Sepps Scharfsinn und Wortpräzision sind nicht nur ein intellektuelles Vergnügen und prosaischer Genuss, sondern auch eine gute Denkschule und Nachdenkmediation. Er führt die Leserin, den Leser zurück zum Sinn von Worten – die Sachverhalte, die Inhalte präzise in „den Griff bekommen versuchen“ und nicht nur einer Gewohnheit folgen, wie Worte und Begriffe und Konzepte zu verstehen sind. Sie werden (wieder) zu eigen gemacht, angeeignet und damit wird Lebendigkeit geschaffen, die berührt, die Begegnung ermöglicht und die Kraft hat, Klüfte überwinden zu können.“ Aber lesen Sie selbst… Weiterlesen →


 In dem Maße, in dem das Wort „systemisch“ immer weitere Verbreitung und Akzeptanz findet, verliert es auch an Aussagekraft. Was ist heute nicht systemisch? Aber wie definiert man den „Wesenskern“ des Systemischen? Und welche Rolle spielt der Rückbezug auf Systemtheorie (in welcher Spielart auch immer)? Zu diesen Fragen hat sich Wolfgang Loth 2010 in einem Aufsatz für die „Zeitschrift für Systemische Therapie und Beratung“ unter dem Titel „Was soll’s? – Eine Annäherung an ,systemisch-plus‘“ Gedanken gemacht. Im abstract heißt es: „Die Prägnanz des Begriffs „systemisch“ vermag zu täuschen. Die Diskussionen um systemisches Störungswissen zeigten das auf. Sowohl ontologistische als auch konstruktivistische Positionen können im Prinzip sinnvoll mit systemischen Perspektiven in Verbindung gebracht werden. Im vorliegenden Beitrag versuche ich daher, die entsprechenden Prämissen zu entwirren. Es lässt sich ein Kern herausfiltern, der systemische Prämissen zusammenfasst und ein weites Feld von Handlungsoptionen eröffnet (das Fokussieren auf Kontexte als notwendiges Bei-Werk von Systemen, sowie auf das Organisieren von Hilfe über das Berücksichtigen von Sinngrenzen als Hort der System-Umwelt-Dynamik). Die jeweilige Auswahl aus diesen Optionen lässt sich aus dem Kern jedoch nicht eindeutig ableiten. Hier wirken andere Orientierungen. Ich bevorzuge daher die Verknüpfung des Begriffs „systemisch“ mit einem „plus“. Das „plus“ stände dann für die Absicht, wie ich zu einem systemisch angelegten Hilfegeschehen beisteuern möchte. Ich bevorzuge dabei eine ,existenzielle‘ Orientierung.“
In dem Maße, in dem das Wort „systemisch“ immer weitere Verbreitung und Akzeptanz findet, verliert es auch an Aussagekraft. Was ist heute nicht systemisch? Aber wie definiert man den „Wesenskern“ des Systemischen? Und welche Rolle spielt der Rückbezug auf Systemtheorie (in welcher Spielart auch immer)? Zu diesen Fragen hat sich Wolfgang Loth 2010 in einem Aufsatz für die „Zeitschrift für Systemische Therapie und Beratung“ unter dem Titel „Was soll’s? – Eine Annäherung an ,systemisch-plus‘“ Gedanken gemacht. Im abstract heißt es: „Die Prägnanz des Begriffs „systemisch“ vermag zu täuschen. Die Diskussionen um systemisches Störungswissen zeigten das auf. Sowohl ontologistische als auch konstruktivistische Positionen können im Prinzip sinnvoll mit systemischen Perspektiven in Verbindung gebracht werden. Im vorliegenden Beitrag versuche ich daher, die entsprechenden Prämissen zu entwirren. Es lässt sich ein Kern herausfiltern, der systemische Prämissen zusammenfasst und ein weites Feld von Handlungsoptionen eröffnet (das Fokussieren auf Kontexte als notwendiges Bei-Werk von Systemen, sowie auf das Organisieren von Hilfe über das Berücksichtigen von Sinngrenzen als Hort der System-Umwelt-Dynamik). Die jeweilige Auswahl aus diesen Optionen lässt sich aus dem Kern jedoch nicht eindeutig ableiten. Hier wirken andere Orientierungen. Ich bevorzuge daher die Verknüpfung des Begriffs „systemisch“ mit einem „plus“. Das „plus“ stände dann für die Absicht, wie ich zu einem systemisch angelegten Hilfegeschehen beisteuern möchte. Ich bevorzuge dabei eine ,existenzielle‘ Orientierung.“ Als Dozent und Lehrtherapeut an unterschiedlichen systemischen Instituten bin ich immer wieder überrascht, dass viele Pioniere der Familientherapie und der Systemischen Therapie allmählich in Vergessenheit geraten oder den TeilnehmerInnen der Weiterbildungen gar unbekannt sind. So wissen viele nichts von Ivan Boszormenyi-Nagy, der seit Ende der 70er Jahre häufig in Deutschland zu Gast war und in vielen Workshops und Tagungen sein Konzept der Kontextuellen Therapie vermittelt hat (
Als Dozent und Lehrtherapeut an unterschiedlichen systemischen Instituten bin ich immer wieder überrascht, dass viele Pioniere der Familientherapie und der Systemischen Therapie allmählich in Vergessenheit geraten oder den TeilnehmerInnen der Weiterbildungen gar unbekannt sind. So wissen viele nichts von Ivan Boszormenyi-Nagy, der seit Ende der 70er Jahre häufig in Deutschland zu Gast war und in vielen Workshops und Tagungen sein Konzept der Kontextuellen Therapie vermittelt hat (