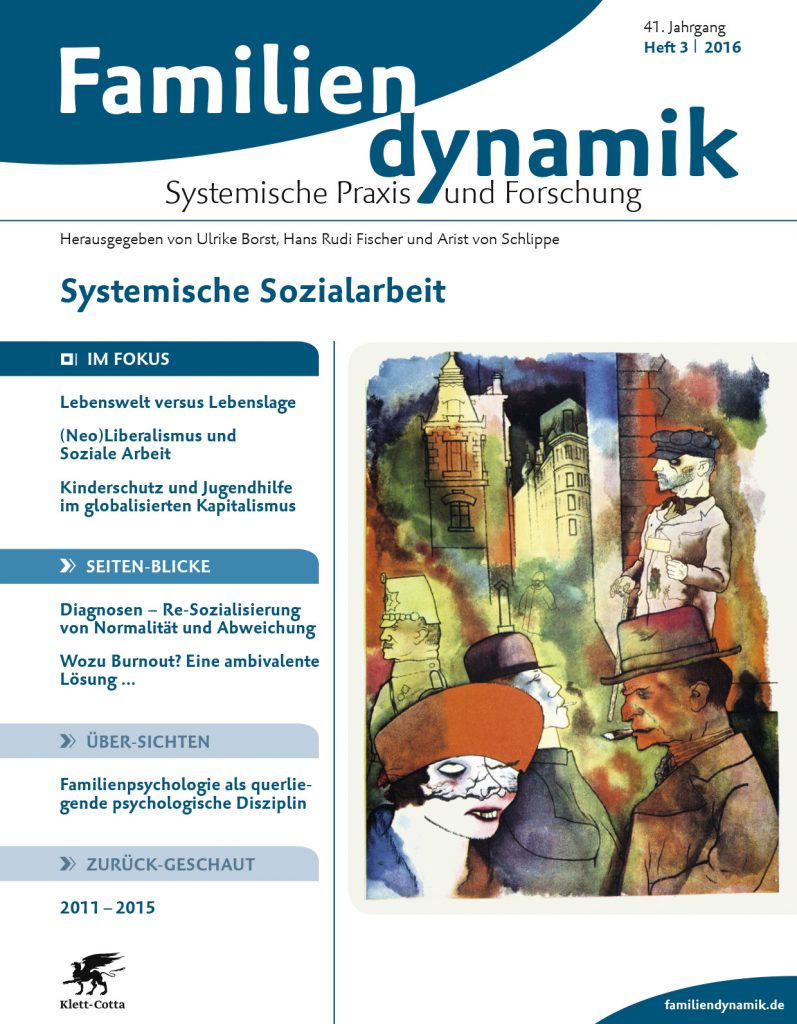Unter der Überschrift „Unser neoliberaler Alltag“ widmet sich die diesjährige wissenschaftliche Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie (DGSF) gesellschaftpolitischen Fragen. „Migration und Flucht“ ist ein weiterer Schwerpunkt des Kongresses vom 22. bis 24. September 2016 in der Frankfurter Goethe-Universität, zu dem rund 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet werden.
Eröffnet wird die Tagung von Armutsforscher Professor Christoph Butterwegge mit dem Vortrag „Armut, Prekarität und soziale Ausgrenzung in Deutschland“. Weitere Vortragende des gesellschaftpolitischen Themenstrangs sind unter anderem die international renommierte Soziologieprofessorin und Wirtschaftwissenschaftlerin Saskia Sassen, der radikale Wachstumskritiker Professor Niko Paech und Professor Claus Leggewie, Direktor des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen.
Der DGSF-Kongress steht unter dem Motto: „Systemisch – Wirksam – Gut“ und thematisiert ein breites Spektrum von bewährten und innovativen Methoden „systemischer Veränderungsarbeit“. Veranstalter der DGSF-Jahrestagung 2016 auf dem Campus Westend der Frankfurter Uni ist die wispo AG – Wissenschaftliches Institut für systemische Psychologie und Organisationsentwicklung, Frankfurt/Wiesbaden.
Das Tagungsprogramm findet sich unter www.dgsf-tagung-2016.de.

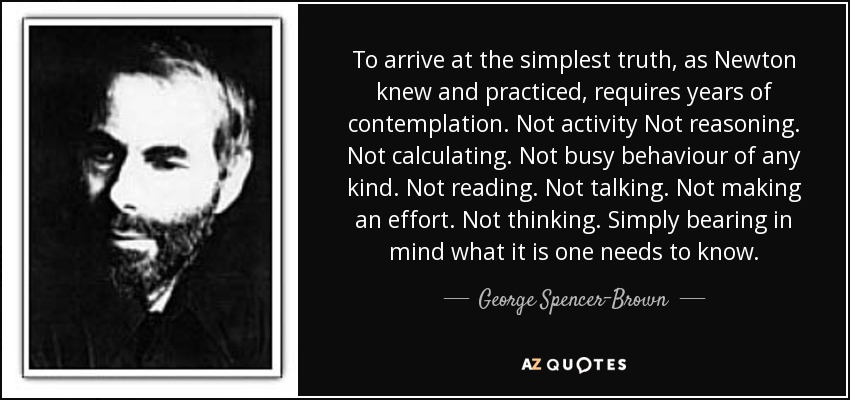

 Heute wäre Mara Selvini Palazzoli 100 Jahre alt geworden. Anfang der 80er Jahre waren sie und ihr Mailänder Team unglaublich berühmt und haben die Entwicklung der Familientherapie und der Systemischen Therapie nachhaltig beeinflusst. Leider ist ihr Name vielen systemischen KollegInnen, die ihre Weiterbildung erst in den vergangenen Jahren gemacht haben, kaum ein Begriff. Die Geschichte des systemischen Ansatzes ist unter Systemikern nicht sehr präsent (wenn man sie nicht selbst erlebt hat). Einen guten Einblick in die Arbeit von Mara Selvini (und ihre Biografie) bietet aber ein Portrait von Edith Zundel aus dem Jahre 1987, das als Beitrag in ihrem Buch „Leitfiguren der Psychotherapie“ im Kösel-Verlag München erschienen ist. In der Zeit gab es damals dieses Kapitel als Vorabdruck, der erfreulicherweise heute auch online zu lesen ist,
Heute wäre Mara Selvini Palazzoli 100 Jahre alt geworden. Anfang der 80er Jahre waren sie und ihr Mailänder Team unglaublich berühmt und haben die Entwicklung der Familientherapie und der Systemischen Therapie nachhaltig beeinflusst. Leider ist ihr Name vielen systemischen KollegInnen, die ihre Weiterbildung erst in den vergangenen Jahren gemacht haben, kaum ein Begriff. Die Geschichte des systemischen Ansatzes ist unter Systemikern nicht sehr präsent (wenn man sie nicht selbst erlebt hat). Einen guten Einblick in die Arbeit von Mara Selvini (und ihre Biografie) bietet aber ein Portrait von Edith Zundel aus dem Jahre 1987, das als Beitrag in ihrem Buch „Leitfiguren der Psychotherapie“ im Kösel-Verlag München erschienen ist. In der Zeit gab es damals dieses Kapitel als Vorabdruck, der erfreulicherweise heute auch online zu lesen ist,