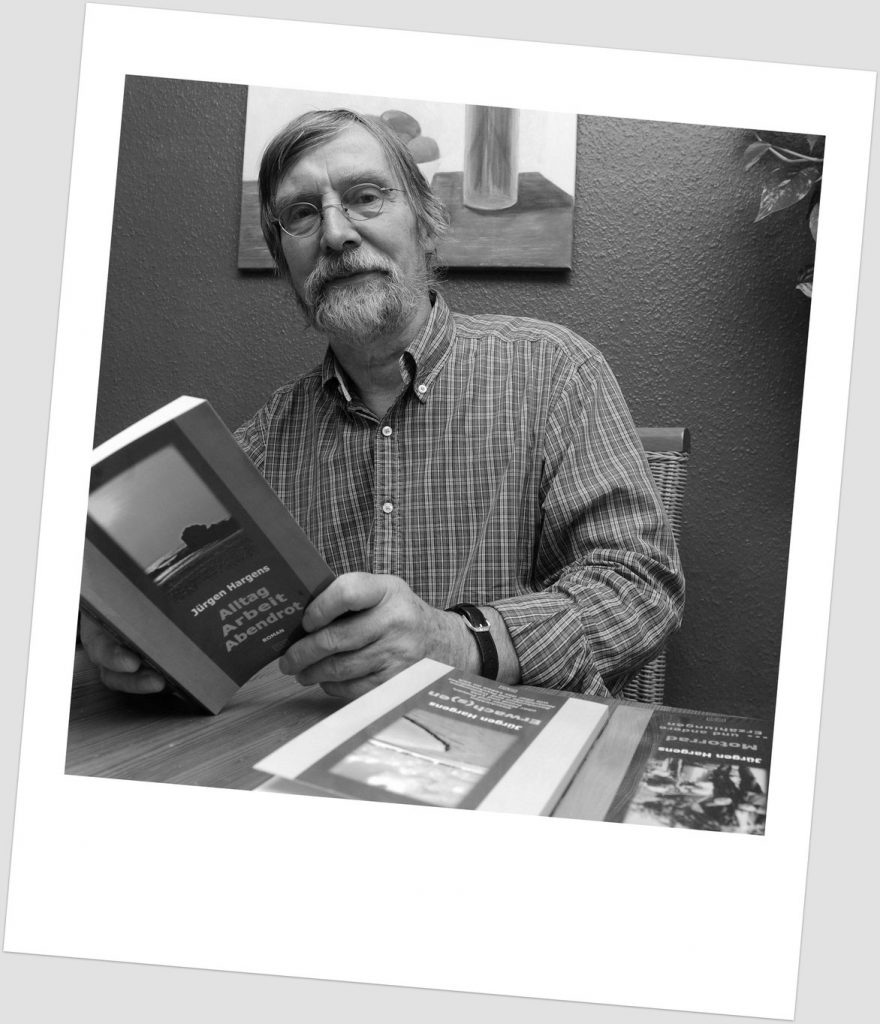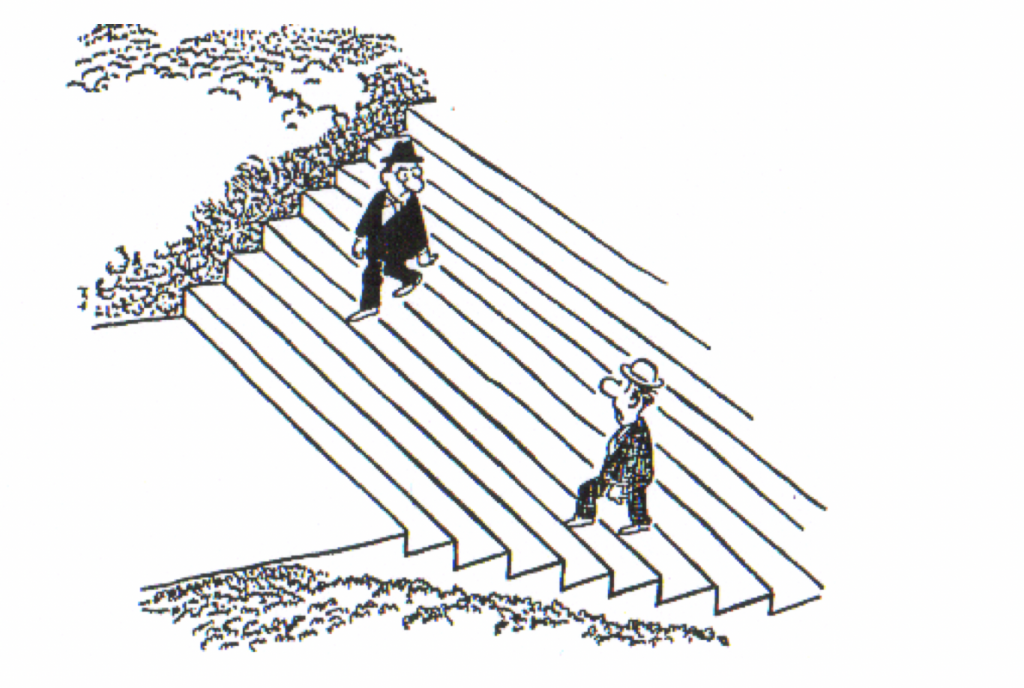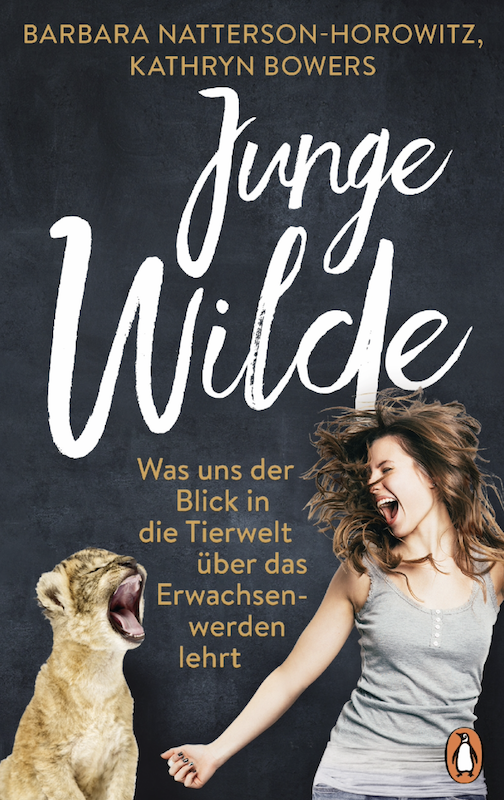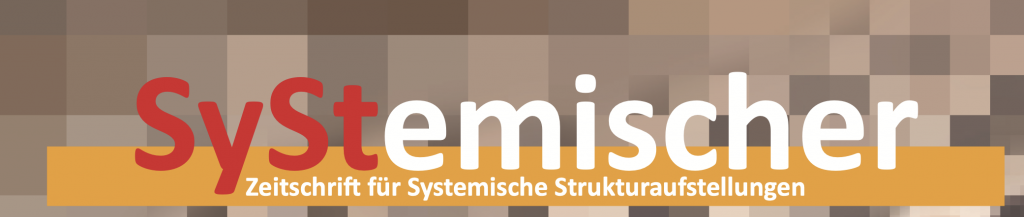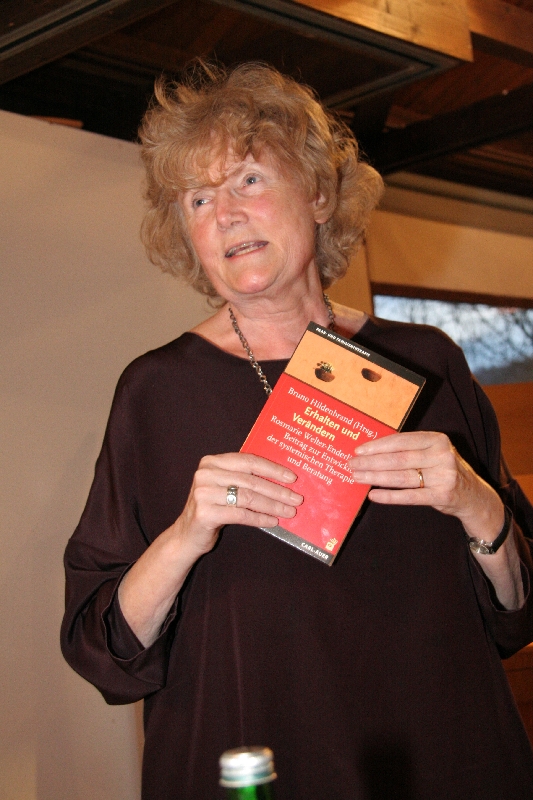Eine aktuelle Übersichtsarbeit aus dem renommierten Lancet über die psychologischen Folgen von Quarantäne und wie diese Folgen abgemildert werden können, ist zur Zeit online frei verfügbar. Wolfgang Loth hat dankenswerterweise die Zusammenfassung, wesentliche Gesichtspunkte und Schlussfolgerungen für die systemagazin-Leserschaft übersetzt:
Zusammenfassung:
Der Ausbruch von Covid-19 im Dezember 2019 führte in vielen Ländern dazu, Menschen, die sich möglicherweise infiziert hatten, anzuweisen, sich selbst zuhause zu isolieren oder spezielle Quarantäne-Unterkünfte aufzusuchen. Entscheidungen bezüglich Quarantäne sollten auf der Grundlage bestmöglicher Evidenz erfolgen. Wir haben eine vergleichende Untersuchung zu den psychologischen Auswirkungen von Quarantäne auf der Basis von drei elektronischen Datenbanken durchgeführt. 24 der 3166 gefundenen Artikel wurden für diese Untersuchung ausgewertet. Die meisten der ausgewerteten Studien berichteten von negativen psychologischen Effekten, einschließlich posttraumatischen Stresssymptomen, Verwirrtheit und Ärger. Zu den Stressoren gehörten die Dauer der Quarantäne, Furcht vor Ansteckung, Frustration, Langeweile, unzureichende Vorräte, unzureichende Information, finanzielle Verluste und Stigmata. Einige der ForscherInnen gingen von längerfristigen Effekten aus. In Situationen, in denen Quarantäne als notwendige Maßnahme angesehen wird, sollten die Behörden Menschen nicht länger als notwendig in Quarantäne schicken, eine verständliche und nachvollziehbare Begründung für die Quarantäne liefern, sowie für die darauf bezogenen Vorschriften, und sie sollten dafür sorgen, dass die notwendigen Mittel in ausreichendem Maß zur Verfügung stehen. Appelle an den Altruismus, etwa durch das Erinnern der Öffentlichkeit an die Vorteile der Quarantäne für die Allgemeinheit können sich positiv auswirken.
Stressoren während der Quarantäne
- Dauer der Quarantäne
- Furcht vor Ansteckung
- Frustration und Langeweile
- Unzureichende Versorgung
- Unzureichende Information
Stressoren nach der Quarantäne
- Finanzielle Verluste
- Stigmata
Was kann getan werden, um die Folgen der Quarantäne abzumildern?
- Die Quarantäne so kurz wie möglich halten
- Den Menschen so viel Information wie möglich zur Verfügung stellen
- Angemessene Versorgung sicherstellen
- Langeweile reduzieren und die Kommunikation verbessern
- Beschäftigte im Gesundheitswesen benötigen besondere Aufmerksamkeit
- Altruismus ist besser als Zwang
Schlussfolgerungen
Alles in allem sprechen die Ergebnisse dieser Übersicht dafür, dass die psychologischen Folgen einer Quarantäne breitgefächert, beträchtlich und möglicherweise länger andauernd sind. Dies soll nicht dafür plädieren, Quarantäne als Vorgehen der Wahl auszuschließen; die psychologischen Folgen davon, die Möglichkeit der Quarantäne nicht zu nutzen und stattdessen der Erkrankung zu erlauben sich auszubreiten, könnten durchaus schlimmer sein. Allerdings ist das Einschränken individueller Freiheit zu Gunsten eines umfassenderen öffentlichen Wohls oft umstritten und bedarf eines sorgfältigen Vorgehens. Für den Fall, dass Quarantäne als unverzichtbar angesehen wird, sprechen unsere Ergebnisse dafür, dass die Behörden alles erdenklich Mögliche dafür tun, dass diese Erfahrung so erträglich wie möglich für die Menschen ist. Dies kann erreicht werden durch:
– den Menschen sagen, was genau warum geschieht,
– ihnen erläutern wie lange das andauern wird,
– sinnvolle Aktivitäten während der Zeit der Quarantäne ermöglichen,
– klare Kommunikation sicherstellen,
– grundlegende Versorgung sicherstellen (wie Nahrung, Wasser, medizinische Mittel), sowie
– altruistische Einstellungen fördern, die die Menschen sinnvollerweise zeigen sollten. MitarbeiterInnen der Gesundheitsbehörden, die für die Durchführung der Quarantäne verantwortlich sind, die eine feste Anstellung und üblicherweise einen sicheren Arbeitsplatz haben, sollten sich auch bewusst sein, dass dies nicht für alle gilt. Falls die Erfahrung der Quarantäne sich negativ gestaltet, dann sprechen die Ergebnisse der vorliegenden Übersicht dafür, dass dies längerfristige Konsequenzen nach sich zieht, die nicht nur die Personen betreffen, die tatsächlich in Quarantäne waren, sondern auch das Gesundheitssystem selbst, das für die Durchführung der Quarantäne verantwortlich war, sowie die PolitikerInnen und Gesundheitsfunktionäre, die sie angeordnet haben.
Der vollständige Artikel kann hier gelesen und heruntergeladen werden.