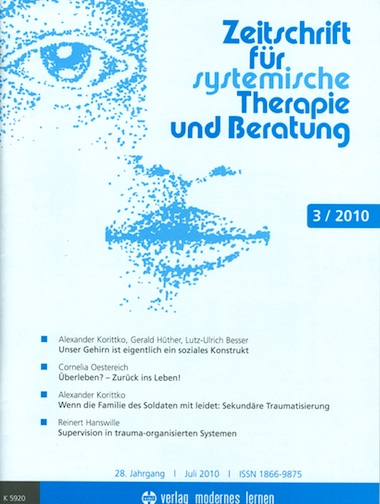20. Juli 2010
von Tom Levold
Keine Kommentare
In seiner 2009 veröffentlichten Dissertation befasst sich der Soziologe Henry Thiele mit der zunehmenden Bedeutung von Organisationen in unserer Gesellschaft unter einer systemtheoretischen Perspektive:„Die meisten Menschen verbringen heutzutage den Großteil ihres Daseins in Organisationen. Sie werden immer häufiger in Organisationen geboren (Krankenhaus), in Organisationen sozialisiert (Kindergärten, Schulen usw.), sind für ihre Existenzsicherung auf Lohnzahlungen von Organisationen angewiesen, und zunehmend fristen sie ihr Lebensende in Organisationen (Krankenhaus, Altenheim etc.). Aus soziologischer Sicht sind Organisationen deshalb besonders interessant und verdienen eine besondere Beachtung in der Gesellschaftsanalyse. In dieser Untersuchung soll nicht der Siegeszug der Organisation in der soziokulturellen Evolution der Gesellschaft im Mittelpunkt stehen, sondern die Frage: Wie kommt das Driften (Maturana, Varela, 1991) der Organisation zustande? Geht man davon aus, dass in der Evolution Aussterben die Regel und Anpassung die Ausnahme ist, scheint der Aspekt des Driftens organisierter Sozialsysteme besonderes Augenmerk zu verdienen. Liest man die für Deutschland veröffentlichten Zahlen der Unternehmensinsolvenzen, gerade in den heutigen Zeiten der Wirtschafts- und Finanzkrise, scheint der Fortbestand einer einmal ins Leben gerufenen Organisation eher ungewiss als gesichert zu sein. Des Weiteren scheint es so zu sein, dass Organisationen gewissen Lebenszyklen (Küpper, Felsch) unterworfen sind. In den älteren Organisationstheorien wurde noch von einem einheitlichen Zweck ausgegangen, der die gesamte Strukturierung der Organisation übergreift. Alle Organisationsmitglieder haben ihr Handeln im Hinblick auf die Verwirklichung dieses spezifischen Zwecks der Intention nach rational zu gestalten. In der Organisationsanalyse stellte man aber fest, dass Zweckverschiebungen innerhalb der formalen Organisationen eher die Regel als die Ausnahme sind. (Mayntz, 1963 u.a.) Dies Problem der rational gestalteten Organisation wurde somit den Organisationsmitgliedern zugeschrieben. Gleichsam als die andere Seite der formalen Organisation agieren die Mitglieder der formalen Organisation in der informellen Organisation als Mikropolitiker (Bosetzky, Heinrich, 1989), die die formalen Strukturen unterminieren, um ihre persönliche Nutzenmaximierung voranzutreiben. Übernimmt man diese Perspektive für die Betrachtung der formalen Organisation, kann man sich schwer der Annahme verweigern, dass die Organisationsmitglieder grundlegend feindlich gegenüber der Organisation gesinnt sind. Mit dieser Perspektive würde man all den freiwilligen Mitgliedern in Hilfsorganisationen, sozialen Vereinen usw. nicht gerecht werden. In der hier durchgeführten Analyse wird die Perspektive der Luhmannschen Systemtheorie eingenommen. Damit sind die Organisationsmitglieder nicht aus der theoretischen Betrachtung eliminiert, sondern im Gegenteil, sie werden in der Umwelt der organisierten Sozialsysteme verortet. Das hat den entscheidenden Vorteil, dass den Organisationsmitgliedern aus der theoretischen Betrachtung heraus mehr Freiheit zugestanden wird als in akteurszentrierten Theorien. Denn Systembildung bedeutet immer die Streichung mindestens eines Freiheitsgrades (Foerster von, 1997). Mit der Luhmannschen Systemtheorie wird des Weiteren davon ausgegangen, dass sich gleichsam unbeobachtet hinter dem Rücken der Anwesenden ein Netzwerk webt, ein soziales System sich bildet. Alle sozialen Systeme beruhen letztlich auf der Unterscheidung von Bewusstsein und Kommunikation. Die Kommunikation selbst kann man nicht beobachten sondern nur erschließen. Solange sie störungsfrei läuft, bleibt sie den Anwesenden unbewusst. Erst bei Störungen des Kommunikationsflusses macht sie sich bemerkbar, obgleich sie fast nie den Anwesenden bewusst wird. Denn die Kommunikation drillt den Menschen auf den Menschen, weil sie sich der Wahrnehmung entzieht (Fuchs, 1998). Die Autopoiesis der Kommunikation ist auf die Anwesenheit zweier psychischer Systeme bzw. Bewusstseinssysteme angewiesen. Sie ermöglichen überhaupt erst den Raum oder den Phänomenbereich, in dem die Autopoiesis sozialer Systeme möglich ist (Luhmann, 1990). Die Autopoiesis der Kommunikation setzt entsprechend immer Interaktion der Anwesenden voraus. In der Interaktion selbst, werden sich die Anwesenden in besonderer Weise wechselseitig bewusst und können sich entsprechend anders zur Geltung bringen, als in den Strukturzwängen einer formalern Organisation. Die Kommunikation selbst gibt den Beteiligten gewisse Changiermöglichkeiten an die Hand, z.B. das An- und Ausschalten verschiedener operativer Displacement (Fuchs, 1993), um ihren störungsfreien Ablauf zu ermöglichen und entsprechende Brüche zu vermeiden. Zum Beispiel den nahtlosen Übergang von einem Thema zu einem anderen. Die Interaktion selbst wird als zeitinstabiles Kontaktsystem (Luhmann, 1997) begriffen, das mit dem Auseinandergehen der Beteiligten erloschen ist. Die hier kurz angerissene Bedeutung der Kommunikation in der Luhmannschen Systemtheorie erklärt, warum ihr in der durchgeführten Analyse ein so breiter Raum eingeräumt wurde. Organisationen sind Sozialsysteme eines anderen Typs und besitzen damit verbunden ganz andere emergente Eigenschaften. Sie können mit der diffusen Kommunikation der Interaktion nichts anfangen. Ihre Operationen basieren auf Entscheidungen. Jede Entscheidung schließt an eine Entscheidungskommunikation an, aber sie selbst ist die Sinnverdichtung dieser Kommunikation. Und eben dieser Sachverhalt stellt ihre Effizienz, ihr Tempovorteil gegenüber allen anderen Typen sozialer Systeme dar. Erst wenn es der Organisation gelingt Entscheidungen an Entscheidungen zu knüpfen, ist sie in der Lage ihr eigenes Netzwerk ihrer eigenen Entscheidungen zu etablieren. Nur in der Form der Entscheidung kann sie ihre für sie selbst nicht weiter hintergehbaren Systemelemente (Entscheidungen) aneinander anschließen, Entscheidungen anhand von Entscheidungen produzieren. Gelingt ihr das, gewinnen die Entscheidungen füreinander Relevanz, können sich wechselseitig stützen, vorbereiten und entlasten. Jede Entscheidung muss jetzt ihre eigene Vorgängerentscheidung und den jeweiligen Kontext anderer Entscheidungen mit berücksichtigen. Es bildet sich ein Zusammenhang der Entscheidungen, der die Grenzen des Systems begründet und bezeichnet. Da jede Organisation sich immer nur jeweils im Moment ihres Entscheidens realisiert, bekommt sie ein Zeitproblem. Man muss nicht nur entscheiden, sondern man muss mit Bezug auf den Entscheidungszusammenhang korrekt und rechtzeitig entscheiden bevor sich das zu entscheidende Problem zu Ungunsten der Organisation von selbst erledigt hat. Alles was jetzt in der Organisation als relevant betrachtet werden soll, muss die Form einer Entscheidung annehmen. Dies bedeutet nicht, dass in der Entscheidungskommunikation nicht Einfluss auf die Entscheidung genommen werden kann, aber zum einen wird man aufgrund des Entscheidungsdrucks versuchen die Entscheidungskommunikation soweit wie möglich zu verkürzen, z.B durch Programmierung. Zum anderen sieht man der Entscheidung ihre Entscheidungskommunikation nicht an. Man kann sie nur noch erahnen. Organisationen kommunizieren am liebsten mit Organisationen in ihrer Umwelt, da diese gezwungen sind, selbst Entscheidungen zu produzieren, mit denen man selbst etwas anfangen kann. Man kann sie entweder in den eigenen Entscheidungszusammenhang übernehmen, oder man kann sie mit einer eigenen Entscheidung ablehnen. Aber jede Entscheidung, die die Organisation trifft bestätigt oder ändert ihre Strukturen. Dieser Gedankengang führte zu der Überlegung, dass informale Strukturen selbst organisierte Interaktionssysteme sein müssen. Sie müssen sich bereits in irgendeiner Form selbst organisieren. Sie stehen unter dem Gesetz des Wiedersehens. Die sozialen Kontakte werden sich in einem absehbaren Zeit- und Interessenhorizont wiederholen, sich verdichten und konfirmieren (Luhmann, 1997) und dies erfordert bereits ein gewisses Maß an Organisation. Man muss die nächsten Treffen pla
nen, ein Thema auswählen usw. Letztlich produzieren sie Entscheidungen mit denen die formale Organisation etwas anfangen kann. Dies ist einer der Gründe, warum sich die formale Organisation zunehmend den Zugriff auf informale Strukturen ermöglicht“
Zum vollständigen Text
 In einem pointierten Text über die„Beobachtung der Beobachtungen durch systemische Berater“, der auf seiner website zu finden ist, hat der Soziologie Stefan Kühl drei blinde Flecke systemischer Beratung ausgemacht:„Jedes System schafft sich dadurch, dass es sich von der Umwelt unterscheidet, blinde Flecken. Glaubt man den neoliberalen und marxistischen Ideologien, dann unterscheidet sich ein Unternehmen von anderen Organisationen dadurch, dass es profitorientiert ist und vieles andere, an dem man sich auch orientieren könnte man denke beispielsweise an Menschheitsbeglückung, Wohlfahrtspflege oder religiöse Verwirklichung in den Bereich des (für das Unternehmen) Unvorstellbaren verschiebt. Die typische Verwaltung ist an einer gesetzeskonformen Prozessierung von Personalausweis-, Bau- und Sozialhilfeanträgen orientiert und jedenfalls in ihrem operativen Kern weitgehend blind für die Effekte, die durch die strikte Anwendung von Wenn-dann-Regeln produziert werden. Die systemische Beratung parasitiert an den blinden Flecken ihrer in der Regel organisierten Klientensysteme. Ein Beobachter, so die Kurzformel Niklas Luhmanns, kann nicht sehen, was er nicht sehen kann, und die systemischen Berater als Beobachter eines Beobachters versprechen dem Beobachteten, etwas zu sehen, was der beobachtete Beobachter nicht sehen kann. Das machen sicherlich auch andere Beratungsansätze; die systemische Beratung zeichnet sich gegenüber anderen Beratungsansätzen aber dadurch aus, dass sie sich ihrer Rolle als Parasit bewusst ist und sich hier ganz in der Tradition der Systemtheorie zur positiven Funktion dieses Parasitentums bekennt. Aber was für die Klientensysteme gilt, gilt natürlich auch für die Beratersysteme. Auch die systemischen Berater produzieren durch ihre Unterscheidungen eigene blinde Flecken. Alles Beobachten auch das Beobachten der Beobachtung durch die systemischen Berater (und natürlich auch die hier vorgenommene Beobachtung der Beobachtungen der systemischen Berater) verfährt mit den eigenen Unterscheidungen naiv und produziert dadurch zwangsläufig eigene blinde Flecken. Welches sind die blinden Flecken der systemischen Beratung, die natürlich dann auf Kosten eigener blinder Flecken beobachtet werden können?“ Kühl verweist hier zumindest auf drei: 1. Macht, 2. Organisation, 3. Misserfolge.
In einem pointierten Text über die„Beobachtung der Beobachtungen durch systemische Berater“, der auf seiner website zu finden ist, hat der Soziologie Stefan Kühl drei blinde Flecke systemischer Beratung ausgemacht:„Jedes System schafft sich dadurch, dass es sich von der Umwelt unterscheidet, blinde Flecken. Glaubt man den neoliberalen und marxistischen Ideologien, dann unterscheidet sich ein Unternehmen von anderen Organisationen dadurch, dass es profitorientiert ist und vieles andere, an dem man sich auch orientieren könnte man denke beispielsweise an Menschheitsbeglückung, Wohlfahrtspflege oder religiöse Verwirklichung in den Bereich des (für das Unternehmen) Unvorstellbaren verschiebt. Die typische Verwaltung ist an einer gesetzeskonformen Prozessierung von Personalausweis-, Bau- und Sozialhilfeanträgen orientiert und jedenfalls in ihrem operativen Kern weitgehend blind für die Effekte, die durch die strikte Anwendung von Wenn-dann-Regeln produziert werden. Die systemische Beratung parasitiert an den blinden Flecken ihrer in der Regel organisierten Klientensysteme. Ein Beobachter, so die Kurzformel Niklas Luhmanns, kann nicht sehen, was er nicht sehen kann, und die systemischen Berater als Beobachter eines Beobachters versprechen dem Beobachteten, etwas zu sehen, was der beobachtete Beobachter nicht sehen kann. Das machen sicherlich auch andere Beratungsansätze; die systemische Beratung zeichnet sich gegenüber anderen Beratungsansätzen aber dadurch aus, dass sie sich ihrer Rolle als Parasit bewusst ist und sich hier ganz in der Tradition der Systemtheorie zur positiven Funktion dieses Parasitentums bekennt. Aber was für die Klientensysteme gilt, gilt natürlich auch für die Beratersysteme. Auch die systemischen Berater produzieren durch ihre Unterscheidungen eigene blinde Flecken. Alles Beobachten auch das Beobachten der Beobachtung durch die systemischen Berater (und natürlich auch die hier vorgenommene Beobachtung der Beobachtungen der systemischen Berater) verfährt mit den eigenen Unterscheidungen naiv und produziert dadurch zwangsläufig eigene blinde Flecken. Welches sind die blinden Flecken der systemischen Beratung, die natürlich dann auf Kosten eigener blinder Flecken beobachtet werden können?“ Kühl verweist hier zumindest auf drei: 1. Macht, 2. Organisation, 3. Misserfolge.


 Auf der website von Siegfried J. Schmid findet sich ein Beitrag von Oliver Jahraus, Professor für Neuere deutsche Literatur und Medien an der Ludwig-Maximilian-Universität in München (Foto: oliverjahraus.de), über„Die Verfügbarkeit und die Unverfügbarkeit des Mediums. Zum Verhältnis von Mensch und Medium“. Darin heißt es:„Die folgenden Überlegungen stehen in einem Spannungsfeld von zwei entgegengesetzten Positionen, die das Verhältnis von Mensch und Medium zueinander jeweils in einem konträr hierarchisierten Verhältnis modellieren. (I) Die erste Position lässt sich beispielhaft mit einem Satz benennen, der lautet: Es sind Menschen, die die Medien benutzen, in und mit Mediensystemen leben und auch durch Medien manipulierbar sind.(II) Die andere Position bringt dagegen zum Ausdruck, dass die Rede von Menschen die Komplexitätsebene des Mediums verfehlt und dass der Mensch, sofern man überhaupt noch vom Menschen sprechen will, eher als Epiphänomen oder als Effekt von Medien zu verstehen ist. Fragt man sich nun nach der entscheidenden Differenz zwischen diesen beiden Positionen, so darf man das Verhältnis nicht vorschnell auf eine Hierarchie zurückführen. Hierarchie würde in diesem Fall und in der ersten Position Verfügbarkeit ausdrücken. Und die entsprechende Frage würde sich darauf konzentrieren, ob Menschen grundsätzlich über Medien verfügen können oder ob das Medium eine Verfügbarkeit über – also eine konstitutive Funktion für – den Menschen in seinem Selbstverständnis und Selbstbewusstsein besitzt: Wer verfügt über wen? Insofern muss man differenzieren: Verfügbarkeit bedeutet nicht ein Herrschaftsverhältnis über und durch Medien, denn auch im Rahmen dieses Modells, das von der Verfügbarkeit der Medien für Menschen ausgeht, kann sehr wohl auch erfasst werden, wie Menschen selbst medialer Manipulation oder Herrschaft unterliegen. Aber das Medium ist grundsätzlich vom Menschen zu differenzieren und kann daher in eine objektive Relation zum Menschen gebracht werden. Demgegenüber wird in der anderen Position die Differenzierung zwischen Mensch und Medium unterlaufen und somit auf einer objektivistischen Basis hinfällig. Vorderhand möchte ich diese beiden Positionen mit der Differenz von Verfügbarkeit bzw. Unverfügbarkeit des Mediums auf den Begriff bringen. Doch die Differenz der Positionen reicht weiter und umfasst verschiedene Faktoren, die ich im folgenden mit einer Reihe von Einzelbeobachtungen eher essayistisch umreißen möchte“
Auf der website von Siegfried J. Schmid findet sich ein Beitrag von Oliver Jahraus, Professor für Neuere deutsche Literatur und Medien an der Ludwig-Maximilian-Universität in München (Foto: oliverjahraus.de), über„Die Verfügbarkeit und die Unverfügbarkeit des Mediums. Zum Verhältnis von Mensch und Medium“. Darin heißt es:„Die folgenden Überlegungen stehen in einem Spannungsfeld von zwei entgegengesetzten Positionen, die das Verhältnis von Mensch und Medium zueinander jeweils in einem konträr hierarchisierten Verhältnis modellieren. (I) Die erste Position lässt sich beispielhaft mit einem Satz benennen, der lautet: Es sind Menschen, die die Medien benutzen, in und mit Mediensystemen leben und auch durch Medien manipulierbar sind.(II) Die andere Position bringt dagegen zum Ausdruck, dass die Rede von Menschen die Komplexitätsebene des Mediums verfehlt und dass der Mensch, sofern man überhaupt noch vom Menschen sprechen will, eher als Epiphänomen oder als Effekt von Medien zu verstehen ist. Fragt man sich nun nach der entscheidenden Differenz zwischen diesen beiden Positionen, so darf man das Verhältnis nicht vorschnell auf eine Hierarchie zurückführen. Hierarchie würde in diesem Fall und in der ersten Position Verfügbarkeit ausdrücken. Und die entsprechende Frage würde sich darauf konzentrieren, ob Menschen grundsätzlich über Medien verfügen können oder ob das Medium eine Verfügbarkeit über – also eine konstitutive Funktion für – den Menschen in seinem Selbstverständnis und Selbstbewusstsein besitzt: Wer verfügt über wen? Insofern muss man differenzieren: Verfügbarkeit bedeutet nicht ein Herrschaftsverhältnis über und durch Medien, denn auch im Rahmen dieses Modells, das von der Verfügbarkeit der Medien für Menschen ausgeht, kann sehr wohl auch erfasst werden, wie Menschen selbst medialer Manipulation oder Herrschaft unterliegen. Aber das Medium ist grundsätzlich vom Menschen zu differenzieren und kann daher in eine objektive Relation zum Menschen gebracht werden. Demgegenüber wird in der anderen Position die Differenzierung zwischen Mensch und Medium unterlaufen und somit auf einer objektivistischen Basis hinfällig. Vorderhand möchte ich diese beiden Positionen mit der Differenz von Verfügbarkeit bzw. Unverfügbarkeit des Mediums auf den Begriff bringen. Doch die Differenz der Positionen reicht weiter und umfasst verschiedene Faktoren, die ich im folgenden mit einer Reihe von Einzelbeobachtungen eher essayistisch umreißen möchte“ Elisabeth Wagner (Foto: Lehranstalt) ist Psychiaterin und Psychotherapeutin in Wien mit forensischen und suchttherapeutischen Schwerpunkten, zudem Lehrtherapeutin an der Lehranstalt für Systemische Familientherapie in Wien. In der aktuellen Ausgabe des von der Lehranstalt herausgegebenen Periodikums„Systemische Notizen“ ist unter dem Titel„Welche Theorie braucht die Systemische Therapie?“ ein Artikel von ihr erschienen, der mit freundlicher Genehmigung der Lehranstalt auch in der
Elisabeth Wagner (Foto: Lehranstalt) ist Psychiaterin und Psychotherapeutin in Wien mit forensischen und suchttherapeutischen Schwerpunkten, zudem Lehrtherapeutin an der Lehranstalt für Systemische Familientherapie in Wien. In der aktuellen Ausgabe des von der Lehranstalt herausgegebenen Periodikums„Systemische Notizen“ ist unter dem Titel„Welche Theorie braucht die Systemische Therapie?“ ein Artikel von ihr erschienen, der mit freundlicher Genehmigung der Lehranstalt auch in der