 Kleiner Nachtrag zur gestrigen Buchvorstellung des„Lexikons des systemischen Arbeitens“: Heute ist noch eine weitere Rezension von Andreas Manteufel hinzugekommen.
Kleiner Nachtrag zur gestrigen Buchvorstellung des„Lexikons des systemischen Arbeitens“: Heute ist noch eine weitere Rezension von Andreas Manteufel hinzugekommen.
Zu den Rezensionen
3. November 2012
von Tom Levold
Keine Kommentare

3. November 2012
von Tom Levold
Keine Kommentare
 Kleiner Nachtrag zur gestrigen Buchvorstellung des„Lexikons des systemischen Arbeitens“: Heute ist noch eine weitere Rezension von Andreas Manteufel hinzugekommen.
Kleiner Nachtrag zur gestrigen Buchvorstellung des„Lexikons des systemischen Arbeitens“: Heute ist noch eine weitere Rezension von Andreas Manteufel hinzugekommen.
Zu den Rezensionen
2. November 2012
von Wolfgang Loth
Keine Kommentare
 Pflegen als Beruf ist so wenig ein Pappenstiel wie die Erkenntnis, selber einmal auf Pflege angewiesen zu sein. Die Zeitungen sind von Zeit zu Zeit voll von beunruhigenden Nachrichten dazu. Und wer es in seinem Umfeld schon einmal erlebt hat, weiß, dass es neben viel Kompetenz und nicht zuletzt materiellen Ressourcen auch noch Glück braucht, wenn ein Pflegetag ein guter Tag sein soll. Kurzum, Pflegen kostet wohl mehr als über Geld zu machen ist. Wenn es bei Altenpflegekräften eine um fast die Hälfte erhöhte Wahrscheinlichkeit für psychosomatische Beschwerden im Vergleich zum Durchschnitt der arbeitenden Bevölkerung gibt, liegt das sicher nicht nur an einer kleinzügigen Entlohnung. Pflegenotstand also auf beiden Seiten der Medaille. Was könnte helfen? Im Jahr 2007 legte Christoph Abel an der Universität Mannheim (Foto: Universität Mannheim) eine Dissertation zum Thema Systemisch-lösungsorientierte Beratung zur Prävention von Stress und Burnout in Pflegeberufen vor. Ziel war die Konzeption und Evaluation eines ressourcenorientierten Trainingsprogramms, basierend auf der Stärkung spezifischer interner Ressourcen gegen Stress und Burnout (S.3). Das Trainingsprogramm firmierte als ein Einführungskurs in systemisch-lösungsorientierte Beratung: Der Kurs sollte systemisch-lösungsorientierte Beratungskompetenz als interne Ressource vermitteln. Daneben sollten kognitive Ressourcen wie Wissen oder allgemeine Selbstwirksamkeit gefördert werden. Außerdem sollten sich die sozialen Beziehungen der Teilnehmer verbessern bzw. die interpersonellen Probleme abnehmen (S.183). Als zusammenfassendes Ergebnis teilt der Autor mit: Die vorliegende Evaluationsstudie konnte zeigen, dass es in nur zehn Kursstunden möglich ist, wesentliche interne Ressourcen zu mobilisieren und zu fördern, welche für die Prävention von Stress und Burnout wesentlich sind. Das Trainingsmanual ist geeignet, diese Ressourcen zu stärken. Hierbei wurde der Ansatz einer Stressprävention durch Förderung interner Ressourcen verfolgt. Die Zielsetzung der Arbeit, nämlich eindeutige Effektivitätsnachweise des Kurses auf die entsprechenden Ressourcen, wurde im Wesentlichen erfüllt (S.195). Es gab im Detail dabei auch Hinweise darauf, dass trotz der pragmatischen Konzentration des Kurses nicht nur Techniken und Wissen gelernt wurden, sondern sich auch Veränderungen in der Haltung zeigten. Abel weist z.B. darauf hin, dass hinsichtlich der Fähigkeit eine kooperative Beziehung mit Gesprächspartnern zu gestalten, die Effektstärken ebenso groß [waren] wie bei den verhaltensnahen Items. Diese eher weichen Faktoren sind im Hinblick auf die alltägliche Anwendung vielleicht ein noch wichtigerer Hinweis auf die Effektivität des Kurses als die Beherrschung der Fragen und Standard-Interventionen, die relativ leicht einstudiert werden können (S.185). Trotz der für Dissertationen mit statistischer Ausrichtung kennzeichnenden Lesemühen könnte diese Arbeit auch für PraktikerInnen in diesem Bereich eine Hilfe sein. Auch die in dieser Arbeit vorgestellten Mittel und Wege garantieren alleine keine Lösung, sind im Gegenteil nach wie vor eingebunden in mehr oder weniger hilfreiche Kontexte. Doch können sie offenbar wirksam dabei helfen, mit einem Bein im Möglichkeitenland verankert zu sein, während man das andere not-falls in jemandes Hölle einen Stand finden lässt (gemäß Bill OHanlons wunderbarem Motto).
Pflegen als Beruf ist so wenig ein Pappenstiel wie die Erkenntnis, selber einmal auf Pflege angewiesen zu sein. Die Zeitungen sind von Zeit zu Zeit voll von beunruhigenden Nachrichten dazu. Und wer es in seinem Umfeld schon einmal erlebt hat, weiß, dass es neben viel Kompetenz und nicht zuletzt materiellen Ressourcen auch noch Glück braucht, wenn ein Pflegetag ein guter Tag sein soll. Kurzum, Pflegen kostet wohl mehr als über Geld zu machen ist. Wenn es bei Altenpflegekräften eine um fast die Hälfte erhöhte Wahrscheinlichkeit für psychosomatische Beschwerden im Vergleich zum Durchschnitt der arbeitenden Bevölkerung gibt, liegt das sicher nicht nur an einer kleinzügigen Entlohnung. Pflegenotstand also auf beiden Seiten der Medaille. Was könnte helfen? Im Jahr 2007 legte Christoph Abel an der Universität Mannheim (Foto: Universität Mannheim) eine Dissertation zum Thema Systemisch-lösungsorientierte Beratung zur Prävention von Stress und Burnout in Pflegeberufen vor. Ziel war die Konzeption und Evaluation eines ressourcenorientierten Trainingsprogramms, basierend auf der Stärkung spezifischer interner Ressourcen gegen Stress und Burnout (S.3). Das Trainingsprogramm firmierte als ein Einführungskurs in systemisch-lösungsorientierte Beratung: Der Kurs sollte systemisch-lösungsorientierte Beratungskompetenz als interne Ressource vermitteln. Daneben sollten kognitive Ressourcen wie Wissen oder allgemeine Selbstwirksamkeit gefördert werden. Außerdem sollten sich die sozialen Beziehungen der Teilnehmer verbessern bzw. die interpersonellen Probleme abnehmen (S.183). Als zusammenfassendes Ergebnis teilt der Autor mit: Die vorliegende Evaluationsstudie konnte zeigen, dass es in nur zehn Kursstunden möglich ist, wesentliche interne Ressourcen zu mobilisieren und zu fördern, welche für die Prävention von Stress und Burnout wesentlich sind. Das Trainingsmanual ist geeignet, diese Ressourcen zu stärken. Hierbei wurde der Ansatz einer Stressprävention durch Förderung interner Ressourcen verfolgt. Die Zielsetzung der Arbeit, nämlich eindeutige Effektivitätsnachweise des Kurses auf die entsprechenden Ressourcen, wurde im Wesentlichen erfüllt (S.195). Es gab im Detail dabei auch Hinweise darauf, dass trotz der pragmatischen Konzentration des Kurses nicht nur Techniken und Wissen gelernt wurden, sondern sich auch Veränderungen in der Haltung zeigten. Abel weist z.B. darauf hin, dass hinsichtlich der Fähigkeit eine kooperative Beziehung mit Gesprächspartnern zu gestalten, die Effektstärken ebenso groß [waren] wie bei den verhaltensnahen Items. Diese eher weichen Faktoren sind im Hinblick auf die alltägliche Anwendung vielleicht ein noch wichtigerer Hinweis auf die Effektivität des Kurses als die Beherrschung der Fragen und Standard-Interventionen, die relativ leicht einstudiert werden können (S.185). Trotz der für Dissertationen mit statistischer Ausrichtung kennzeichnenden Lesemühen könnte diese Arbeit auch für PraktikerInnen in diesem Bereich eine Hilfe sein. Auch die in dieser Arbeit vorgestellten Mittel und Wege garantieren alleine keine Lösung, sind im Gegenteil nach wie vor eingebunden in mehr oder weniger hilfreiche Kontexte. Doch können sie offenbar wirksam dabei helfen, mit einem Bein im Möglichkeitenland verankert zu sein, während man das andere not-falls in jemandes Hölle einen Stand finden lässt (gemäß Bill OHanlons wunderbarem Motto).
Abels Dissertation findet man im Volltext hier
1. November 2012
von Tom Levold
Keine Kommentare
 Für ihr„Lexikon des systemischen Arbeitens. Grundbegriffe der systemischen Praxis, Methodik und Theorie“ haben die Herausgeber Jan V. Wirth eine imposante Zahl bedeutender Autorinnen und Autoren (90!) gewonnen, die eine Fülle von Stichworten und Begriffen aus dem systemischen Feld vorstellen. Nach der„Sprache der Familientherapie“ (Stierlin & Simon) und dem„Handwörterbuch Systemische Theorie und Therapie“ (Böse/Schiepek) aus den 80er Jahren stellt dieser Band nun einen neuen Anlauf dar, systemisches Grundwissen nicht linear wie in einem Lehrbuch, sondern alphabetisch mit zahlreichen assoziativen Querverweisen in Lexikon-Format zusammenzustellen. systemagazin bringt heute zwei Rezensionen (von Jürgen Beushausen und Tom Levold), die das Buch zur Lektüre empfehlen!
Für ihr„Lexikon des systemischen Arbeitens. Grundbegriffe der systemischen Praxis, Methodik und Theorie“ haben die Herausgeber Jan V. Wirth eine imposante Zahl bedeutender Autorinnen und Autoren (90!) gewonnen, die eine Fülle von Stichworten und Begriffen aus dem systemischen Feld vorstellen. Nach der„Sprache der Familientherapie“ (Stierlin & Simon) und dem„Handwörterbuch Systemische Theorie und Therapie“ (Böse/Schiepek) aus den 80er Jahren stellt dieser Band nun einen neuen Anlauf dar, systemisches Grundwissen nicht linear wie in einem Lehrbuch, sondern alphabetisch mit zahlreichen assoziativen Querverweisen in Lexikon-Format zusammenzustellen. systemagazin bringt heute zwei Rezensionen (von Jürgen Beushausen und Tom Levold), die das Buch zur Lektüre empfehlen!
Zu den Rezensionen
31. Oktober 2012
von Wolfgang Loth
Keine Kommentare
 Spinoza, der seinerzeit die eigene Unabhängigkeit einer sicheren, doch abhängigen Anstellung vorzog, beschrieb Reue als ein doppeltes Elend. Sie mache einem nicht nur klar, dass man etwas verschuldet hat, sondern lasse einen auch noch an diesem Umstand leiden. Was also sollte es mit Reue Brauchbares auf sich haben, immerhin hat sie sich als reale Möglichkeit gehalten über all die Zeit, allen Konkurrenzen in Form heiteren Übergehens von Gewesenem zum Trotz. Sie ist nicht ausgemendelt worden, scheint also für etwas gut zu sein. Doch für was nur? Dirk Kranz (Foto: Universität Trier) hat im Jahr 2005 an der Universität Trier eine Dissertation zum Thema vorgelegt: Was nicht mehr zu ändern ist. Eine Untersuchung zur Reue aus bewältigungstheoretischer Sicht. Erstgutachter war Jochen Brandtstädter, Zweitgutachterin war Sigrun-Heide Filipp. Beide stehen für das Forschungsprojekt einer Entwicklungspsychologie der Lebensspanne. Dirk Kranz gehört mittlerweile zum Team an der Universität Trier, dem Jochen Brandtstädter bis zu seiner Emeritierung vorstand. Brandtstädter hat sich in seinem Modell assimilativer und akkomodativer Prozesse intensiv mit der Dynamik zwischen hartnäckiger Zielverfolgung und flexibler Zielanpassung befasst. Kranz greift Brandtstädters Überlegungen auf und diskutiert in seiner Dissertation u.a. die Frage nach der Funktion der Reue im Hinblick auf Selbstregulation und Wohlbefinden. Er fügt der situationalen Unterscheidung zwischen tätiger Reue und lähmender Reue die Frage nach der Disposition hinzu: Ob man es bei irreversiblen Fehlern schafft, diesbezügliche Reuegefühle zu überwinden, hängt maßgeblich davon ab, wie man im Allgemeinen mit Zielen, insbesondere mit bislang unerreichten wie künftig unerreichbaren, umgeht. Zentral ist die Fähigkeit, persönliche Vorhaben mit gegebenen Realisierungsmöglichkeiten abzustimmen und sich nötigenfalls von aussichtslosen Bestrebungen zu trennen. Diese akkommodative Flexibilität sollte gerade im Falle selbstverschuldeter, daher besonders belastender Zielblockaden vor einer lähmenden Reue schützen. So gesehen kann die Reue je nach Randbedingung eine durchaus intelligente Emotion sein (S.145). Die Dissertation endet mit einer existenziell anmutenden Überlegung. Kranz bekennt sich zu der Ansicht, dass Einsicht in eigene Fehler ohne Reue nicht zu haben ist. Emotionen sind eben nicht das mal lästige, mal willkommene Beiwerk unserer Kognitionen, sondern sie sind dringliche Kognitionen, und zwar jene, die primär uns betreffen, unser Handeln, unsere Entwicklung, unsere Beziehungen. Gewiss möchte sich jeder eine konkrete Reue ersparen, aber wünscht man sich ernsthaft, für Reue generell unempfänglich zu sein? Wohl kaum, denn Reue erfüllt wesentliche Aufgaben: Einsicht in das eigene Fehlverhalten und Antrieb zur Wiedergutmachung. Dieser funktionale Aspekt ist der Globalkritik der Reue entgegenzuhalten. Er öffnet vielmehr eine differenziertere Sichtweise auf die Rationalität der Reue: Wir erkennen eine Fehlentscheidung oder -handlung und machen diese wieder gut, indem wir bereuen. Wenn die Einsicht in den eigenen Fehler aber geschehen, dieser jedoch nicht mehr zu beheben ist, bekommt nachhaltige Reue tatsächlich ein irrationales Moment. (S.147).
Spinoza, der seinerzeit die eigene Unabhängigkeit einer sicheren, doch abhängigen Anstellung vorzog, beschrieb Reue als ein doppeltes Elend. Sie mache einem nicht nur klar, dass man etwas verschuldet hat, sondern lasse einen auch noch an diesem Umstand leiden. Was also sollte es mit Reue Brauchbares auf sich haben, immerhin hat sie sich als reale Möglichkeit gehalten über all die Zeit, allen Konkurrenzen in Form heiteren Übergehens von Gewesenem zum Trotz. Sie ist nicht ausgemendelt worden, scheint also für etwas gut zu sein. Doch für was nur? Dirk Kranz (Foto: Universität Trier) hat im Jahr 2005 an der Universität Trier eine Dissertation zum Thema vorgelegt: Was nicht mehr zu ändern ist. Eine Untersuchung zur Reue aus bewältigungstheoretischer Sicht. Erstgutachter war Jochen Brandtstädter, Zweitgutachterin war Sigrun-Heide Filipp. Beide stehen für das Forschungsprojekt einer Entwicklungspsychologie der Lebensspanne. Dirk Kranz gehört mittlerweile zum Team an der Universität Trier, dem Jochen Brandtstädter bis zu seiner Emeritierung vorstand. Brandtstädter hat sich in seinem Modell assimilativer und akkomodativer Prozesse intensiv mit der Dynamik zwischen hartnäckiger Zielverfolgung und flexibler Zielanpassung befasst. Kranz greift Brandtstädters Überlegungen auf und diskutiert in seiner Dissertation u.a. die Frage nach der Funktion der Reue im Hinblick auf Selbstregulation und Wohlbefinden. Er fügt der situationalen Unterscheidung zwischen tätiger Reue und lähmender Reue die Frage nach der Disposition hinzu: Ob man es bei irreversiblen Fehlern schafft, diesbezügliche Reuegefühle zu überwinden, hängt maßgeblich davon ab, wie man im Allgemeinen mit Zielen, insbesondere mit bislang unerreichten wie künftig unerreichbaren, umgeht. Zentral ist die Fähigkeit, persönliche Vorhaben mit gegebenen Realisierungsmöglichkeiten abzustimmen und sich nötigenfalls von aussichtslosen Bestrebungen zu trennen. Diese akkommodative Flexibilität sollte gerade im Falle selbstverschuldeter, daher besonders belastender Zielblockaden vor einer lähmenden Reue schützen. So gesehen kann die Reue je nach Randbedingung eine durchaus intelligente Emotion sein (S.145). Die Dissertation endet mit einer existenziell anmutenden Überlegung. Kranz bekennt sich zu der Ansicht, dass Einsicht in eigene Fehler ohne Reue nicht zu haben ist. Emotionen sind eben nicht das mal lästige, mal willkommene Beiwerk unserer Kognitionen, sondern sie sind dringliche Kognitionen, und zwar jene, die primär uns betreffen, unser Handeln, unsere Entwicklung, unsere Beziehungen. Gewiss möchte sich jeder eine konkrete Reue ersparen, aber wünscht man sich ernsthaft, für Reue generell unempfänglich zu sein? Wohl kaum, denn Reue erfüllt wesentliche Aufgaben: Einsicht in das eigene Fehlverhalten und Antrieb zur Wiedergutmachung. Dieser funktionale Aspekt ist der Globalkritik der Reue entgegenzuhalten. Er öffnet vielmehr eine differenziertere Sichtweise auf die Rationalität der Reue: Wir erkennen eine Fehlentscheidung oder -handlung und machen diese wieder gut, indem wir bereuen. Wenn die Einsicht in den eigenen Fehler aber geschehen, dieser jedoch nicht mehr zu beheben ist, bekommt nachhaltige Reue tatsächlich ein irrationales Moment. (S.147).
Die Dissertation von Dirk Kranz gibts im Volltext hier
30. Oktober 2012
von Tom Levold
Keine Kommentare

In der neuen Ausgabe von Family Process (Heft 3/2012) gibt es Beiträge aus drei spannenden Themenbereichen zu lesen. Sechs Texte widmen sich der Frage der Ko-Elternschaft, d.h. Elternschaft nicht miteinander verheirateter, nicht auf Dauer zusammenlebender Eltern. Gastherausgeber dieser Sektion sind James McHale und Maureen Waller, die selbst einen Überblicksartikel beigesteuert haben, der auch online gelesen werden kann. Zwei weitere Beiträge bearbeiten das Thema Emigration: Ein Text beschäftigt sich mit der Bedeutung von Emigration für die Menschen, welche in der Heimat zurückgeblieben sind, ein weiterer mit der Familientherapie mit Flüchtlingen. Der Schlussteil des Heftes (über„Dialogue and Reflection“) umfasst einen Text über den„Reflecting Process in Teaching Family Therapy“ sowie eine qualitative Untersuchung über Monolog und Dialog in der Paartherapie.
Zu den vollständigen abstracts
29. Oktober 2012
von Wolfgang Loth
Keine Kommentare
 Als im Mai 1981 Mehmet Ali Ağca das Attentat auf Papst Johannes Paul II. verübt hatte, sagte der Vater von Oktay Saydam: Wir Türken werden jetzt darunter leiden!. Oktay Saydam lebte mit seiner Familie, einer Arbeitsmigrationsfamilie, in Tübingen. Gegen die generalisierende Betrachtung der Nachbarn wehrte sich der Junge: Türke ja, aber den Papst habe er doch nicht umgebracht! Oktay Saydam lehrt jetzt an der Trakya Universität in Edirne in der Türkei (Foto: trakya.edu.tr) und hat im Jahr 2009 im Rahmen des XI. Türkischen Internationalen Germanistik-Kongresses in Izmir einen Vortrag über die Orientrezeptionen Ernst Blochs und Bertolt Brechts gehalten, mit dem Untertitel: Ein Beitrag zur Rekontextualisierung oder Kontexterweiterung des globalen Humanismus versus Terrorismus. In diesem Zusammenhang erweist sich der 11. September 2001 als ein weiteres wirkungsmächtiges Kürzel für eine in der Folge ansteigende Islamophobie in der sog. Westlichen Welt. Ein Aspekt der Globalisierung, der unter (nicht seltenen) Umständen mit einer erheblichen Strapazierung menschlicher Alltagsbeziehungen im lokalen Nahraum korrespondiert. Saydam stellt viele Fragen und eröffnet fragend einen Gedankenraum, in dem sowohl zeittypische wie auch zeitraumübergreifende Dynamiken im Umgang mit dem Fremden aufscheinen. Er geht u.a. auf die Versuche Ernst Blochs und Bertold Brechts ein, in der Auseinandersetzung mit orientalischen Philosophen den interkulturellen Blick zu weiten und verhehlt nicht, dass die von Bloch rezipierten Philosophen in der islamischen Welt durchgehend als Häretiker eingestuft wurden. Sie wurden verfolgt, ihre Bücher wurden verbrannt. Dies könnte dafür sprechen, dass die kulturübergreifende Homogenität der allgemeinen Praktiken von Machtausübung der Heterogenität weltbildnerischer Alltagsbezüge und deren Stiftung kultureller Identität vorausgeht. Dem könnte ein erkenntnistheoretisches, schriftstellerisches und/oder philosophisches Interesse an einer Globalisierung einer humanen Werteauffassung entgegengesetzt werden. Oktay Saydam fasst seinen Aufsatz so zusammen, er beschränke sich, weitgehend auf die offene, vorurteilsferne, wache und diesseitige Forscher- und Betrachter-Haltung Blochs und Brechts sowie auf die diesseitig orientierten Vertreter des auch türkisch geprägten heterodoxen Islam gegenüber anderen Kulturen und wolle zeigen, dass diese urteils- oder vorurteilsferne Forscher- und Betrachterhaltung eine existenzielle philosophische sowie literarisch/poetische Notwendigkeit ist, um aus anderen Kulturen, Philosophien, Erkenntnisse zu ziehen. Eine solche Betrachtungsweise oder Forscher-Haltung hegen jedoch diejenigen – ungeachtet ihrer Herkunft – die sich m.E. grundsätzlich als humanistisch bezeichnen, bezeichnet werden (S.142). Der Aufsatz kann hier im Volltext heruntergeladen werden. [Bibliographische Angaben: Der Aufsatz erschien in: Yadigar Eğit (Hg.) (2010) XI. Türkischer Internationaler Germanistik Kongress, 20.-22. Mai 2009. İzmir: Ege Üniversitesi Matbaası (S.140-155)].
Als im Mai 1981 Mehmet Ali Ağca das Attentat auf Papst Johannes Paul II. verübt hatte, sagte der Vater von Oktay Saydam: Wir Türken werden jetzt darunter leiden!. Oktay Saydam lebte mit seiner Familie, einer Arbeitsmigrationsfamilie, in Tübingen. Gegen die generalisierende Betrachtung der Nachbarn wehrte sich der Junge: Türke ja, aber den Papst habe er doch nicht umgebracht! Oktay Saydam lehrt jetzt an der Trakya Universität in Edirne in der Türkei (Foto: trakya.edu.tr) und hat im Jahr 2009 im Rahmen des XI. Türkischen Internationalen Germanistik-Kongresses in Izmir einen Vortrag über die Orientrezeptionen Ernst Blochs und Bertolt Brechts gehalten, mit dem Untertitel: Ein Beitrag zur Rekontextualisierung oder Kontexterweiterung des globalen Humanismus versus Terrorismus. In diesem Zusammenhang erweist sich der 11. September 2001 als ein weiteres wirkungsmächtiges Kürzel für eine in der Folge ansteigende Islamophobie in der sog. Westlichen Welt. Ein Aspekt der Globalisierung, der unter (nicht seltenen) Umständen mit einer erheblichen Strapazierung menschlicher Alltagsbeziehungen im lokalen Nahraum korrespondiert. Saydam stellt viele Fragen und eröffnet fragend einen Gedankenraum, in dem sowohl zeittypische wie auch zeitraumübergreifende Dynamiken im Umgang mit dem Fremden aufscheinen. Er geht u.a. auf die Versuche Ernst Blochs und Bertold Brechts ein, in der Auseinandersetzung mit orientalischen Philosophen den interkulturellen Blick zu weiten und verhehlt nicht, dass die von Bloch rezipierten Philosophen in der islamischen Welt durchgehend als Häretiker eingestuft wurden. Sie wurden verfolgt, ihre Bücher wurden verbrannt. Dies könnte dafür sprechen, dass die kulturübergreifende Homogenität der allgemeinen Praktiken von Machtausübung der Heterogenität weltbildnerischer Alltagsbezüge und deren Stiftung kultureller Identität vorausgeht. Dem könnte ein erkenntnistheoretisches, schriftstellerisches und/oder philosophisches Interesse an einer Globalisierung einer humanen Werteauffassung entgegengesetzt werden. Oktay Saydam fasst seinen Aufsatz so zusammen, er beschränke sich, weitgehend auf die offene, vorurteilsferne, wache und diesseitige Forscher- und Betrachter-Haltung Blochs und Brechts sowie auf die diesseitig orientierten Vertreter des auch türkisch geprägten heterodoxen Islam gegenüber anderen Kulturen und wolle zeigen, dass diese urteils- oder vorurteilsferne Forscher- und Betrachterhaltung eine existenzielle philosophische sowie literarisch/poetische Notwendigkeit ist, um aus anderen Kulturen, Philosophien, Erkenntnisse zu ziehen. Eine solche Betrachtungsweise oder Forscher-Haltung hegen jedoch diejenigen – ungeachtet ihrer Herkunft – die sich m.E. grundsätzlich als humanistisch bezeichnen, bezeichnet werden (S.142). Der Aufsatz kann hier im Volltext heruntergeladen werden. [Bibliographische Angaben: Der Aufsatz erschien in: Yadigar Eğit (Hg.) (2010) XI. Türkischer Internationaler Germanistik Kongress, 20.-22. Mai 2009. İzmir: Ege Üniversitesi Matbaası (S.140-155)].
26. Oktober 2012
von Tom Levold
Keine Kommentare
 Wilhelm Gerl ist ein bekannter Hypnotherapeut, der ein Programm zur hypnotherapeutischen Raucherentwöhnung entwickelt hat, das u.a. auch den Einsatz spezifischer Selbsthypnose-Techniken beinhaltet. Gemeinsam mit Björn Riegel hat er nun im Klett Cotta Verlag das Buch Nachhaltige Raucherentwöhnung mit Hypnose. Therapie-Manual für Einzelne und für Gruppen veröffentlicht. In diesem Buch wird sein manualisiertes Programm für vier Einzelsitzungen oder aber sechs Gruppensitzungen vorgestellt. Auf einer beigefügten CD sind auch die dabei eingesetzten Arbeitsblätter und Materialien verfügbar. Peter Stimpfle aus Eichstätt hat das Buch gelesen und empfiehlt die Lektüre. Er hebt besonders hervor, dass es dabei nicht einfach um ein Weghypnotisieren“ des Rauchzwanges geht, sondern durchaus um einen komplexen und differenzierten Ansatz:„Wer nun angesichts des Titels Raucherentwöhnung mit Hypnose erwartet, die Zigarette bzw. der Rauchzwang würden weghypnotisiert, wird auf angenehme Weise enttäuscht. Denn die Autoren legen ein rationales, sehr differenziertes und praxisorientiertes Konzept vor. Es werden verschiedene Aspekte der Abhängigkeitsentwicklung berücksichtigt: sozialpsychologische, psychodynamische, verhaltenstheoretische, systemische und schließlich die individuelle Perspektive des Rauchers selbst“
Wilhelm Gerl ist ein bekannter Hypnotherapeut, der ein Programm zur hypnotherapeutischen Raucherentwöhnung entwickelt hat, das u.a. auch den Einsatz spezifischer Selbsthypnose-Techniken beinhaltet. Gemeinsam mit Björn Riegel hat er nun im Klett Cotta Verlag das Buch Nachhaltige Raucherentwöhnung mit Hypnose. Therapie-Manual für Einzelne und für Gruppen veröffentlicht. In diesem Buch wird sein manualisiertes Programm für vier Einzelsitzungen oder aber sechs Gruppensitzungen vorgestellt. Auf einer beigefügten CD sind auch die dabei eingesetzten Arbeitsblätter und Materialien verfügbar. Peter Stimpfle aus Eichstätt hat das Buch gelesen und empfiehlt die Lektüre. Er hebt besonders hervor, dass es dabei nicht einfach um ein Weghypnotisieren“ des Rauchzwanges geht, sondern durchaus um einen komplexen und differenzierten Ansatz:„Wer nun angesichts des Titels Raucherentwöhnung mit Hypnose erwartet, die Zigarette bzw. der Rauchzwang würden weghypnotisiert, wird auf angenehme Weise enttäuscht. Denn die Autoren legen ein rationales, sehr differenziertes und praxisorientiertes Konzept vor. Es werden verschiedene Aspekte der Abhängigkeitsentwicklung berücksichtigt: sozialpsychologische, psychodynamische, verhaltenstheoretische, systemische und schließlich die individuelle Perspektive des Rauchers selbst“
zur vollständigen Rezension
25. Oktober 2012
von Tom Levold
Keine Kommentare
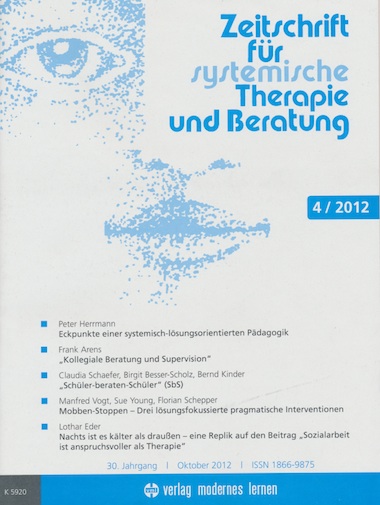
Das aktuelle Heft der„Zeitschrift für Systemische Therapie und Beratung“ kreist ganz um das Thema der Schule und ihrem Umfeld, ein Thema, mit dem sich Herausgeberin Cornelia Tsirigotis bestens auskennt und zu dem sie selbst sechs Rezensionen beisteuert. Peter Herrmann stellt in seinem Beitrag Eckpunkte einer systemisch-lösungsorientierten Pädagogik vor, Frank Arens berichtet über kollegiale Beratung und Supervision im Beratungs-und Unterstützungssystem zum Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement in Schulen und Studienseminaren“. Ein weiterer Artikel stellt ein an systemischen Prinzipien orientiertes Schülerprojekt vor, in dem Schüler Schüler beraten und schließlich gibt es noch einen Beitrag, der sich mit pragmatischen Interventionen bei Mobbing beschäftigt (Manfred Vogt et al.).
Die Provokation von Johannes Herwig Lempp und Ludger Kühling aus dem letzten Heft, dass Sozialarbeit anspruchsvoller als Therapie sei, hat eingeschlagen. Lothar Eder antwortet in einer klugen und differenzierten Replik auf die Thesen der beiden, Ulrich Gehrmann kritisiert den Text auf einer ähnlichen Richtung.
Zu den vollständigen abstracts geht es hier
24. Oktober 2012
von Tom Levold
Keine Kommentare
Heute wird Joseph Duss-von Werdt (Foto: Fernuniversität Hagen) 80 Jahre alt und wir gratulieren von Herzen. Sepp Duss ist Urgestein der Familientherapie und wurde dem deutschsprachigen Publikum schon 1976 durch seine Gründungs-Mitherausgeberschaft der„Familiendynamik“ (gemeinsam mit Helm Stierlin) bekannt, die er bis 1987 innehatte. Sein Studium der Philosophie und Psychologie an der Universität in Löwen (Belgien), wo das Husserl-Archiv untergebracht war, schloss er als Dr. phil. mit einer Arbeit über die »Phänomenologie Alexander Pfänders« ab. Anschließend absolvierte er ein Theologiestudium an der Universität München (u.a. mit dem gegenwärtigen Papst als Kommilitone) und wurde dort 1964 zum Dr. theol. promoviert. 1967 übernahm er die Leitung des von ihm mitgegründeten Institutes für Ehe und Familie in Zürich, die er bis 1987 innehatte. In den 80er und 90er Jahren wandte er sich zunehmend dem Feld der systemischen Mediation zu, die er nicht nur praktizierte, sondern auch an den Universitäten Bern, Genf und Hagen sowie am Frankfurter Institut für Mediation IKOM unterrichtete. Bis heute hat er sich seine Schaffenskraft und Ausdauer erhalten, was sich nicht nur dadurch zum Ausdruck bringt, dass er Jahr für Jahr hunderte von Kilometern in Europa zurücklegt, nicht etwa mit einem GPS-System ausgerüstet, sondern nur mit einer normalen Straßenkarte, auf der die Hochspannungsleitungen eingezeichnet sind, was ihm zur Orientierung ausreicht – einer Herausforderung, der sich die meisten 20jährigen nicht gewachsen fühlen dürften. Zum Geburtstag bringt systemagazin mit freundlicher Erlaubnis des Verlages Vandenhoeck & Ruprecht ein wunderbares Gespräch, das Wolf Ritscher mit Sepp Duss für den„Kontext“ 2010 geführt hat und das in der Systemischen Bibliothek zu finden ist.
systemagazin wünscht Dir, Sepp, zum Geburtstag alles Gute, Gesundheit und Glück, viele weitere Wanderungen und dem Systemischen Feld mehr von Deinen klugen und wohltemperierten Einsichten und Gedanken!
23. Oktober 2012
von Tom Levold
Keine Kommentare
 Günter Rothbauer, (Foto: www.rothbauer.at), Volkswirt und Psychologe mit einer Ausbildung in systemischer Therapie bei der ÖAS in Wien, hat im Rahmen einer Diplomarbeit an der Wiener Universität eine konversationsanalytische Studien angefertigt, die die Methode des Reflecting Team mit der von Ludwig Reiter entwickelten Variante des„Fokussierenden Teams“ verglich und Ähnlichkeiten wie Unterschiede herausarbeitete. In seiner Zusammenfassung stellt er fest, dass„die Ergebnisse (darauf schließen) lassen, dass – bei sauberer Durchführung – zwischen den beiden Methoden ein beträchtlicher Unterschied hinsichtlich Lösungsorientertheit und der Stringenz in der Themenbearbeitung besteht“
Günter Rothbauer, (Foto: www.rothbauer.at), Volkswirt und Psychologe mit einer Ausbildung in systemischer Therapie bei der ÖAS in Wien, hat im Rahmen einer Diplomarbeit an der Wiener Universität eine konversationsanalytische Studien angefertigt, die die Methode des Reflecting Team mit der von Ludwig Reiter entwickelten Variante des„Fokussierenden Teams“ verglich und Ähnlichkeiten wie Unterschiede herausarbeitete. In seiner Zusammenfassung stellt er fest, dass„die Ergebnisse (darauf schließen) lassen, dass – bei sauberer Durchführung – zwischen den beiden Methoden ein beträchtlicher Unterschied hinsichtlich Lösungsorientertheit und der Stringenz in der Themenbearbeitung besteht“
Zum vollständigen Text
22. Oktober 2012
von Tom Levold
Keine Kommentare
21. Oktober 2012
von Tom Levold
Keine Kommentare
 Ein nicht unwesentlicher Aspekt der systemisch-konstruktivistischen Kritik an psychoanalytischen Ansätzen galt schon immer der Deutung im therapeutischen Gespräch. Mit einer Deutung wird das Handeln einer anderen Person in dem Sinne deutet, dass dieser Gründe und Motive für ihr Handeln zugerechnet werden, die die gemeinte Person selbst nicht geltend gemacht hat – oder sogar abstreitet. Wird die Deutung in der Psychoanalyse mit einem Wahrheitsanspruch oder mit überlegenem Experten-Zugriff auf die„eigentliche“ Wirklichkeit ausgestattet, wie es durchaus bei einigen psychoanalytischen Autorinnen und Autoren den Anschein hat, liegt es auf der Hand, damit nicht übereinstimmende andere Wahrnehmungen, Selbsterleben der Klienten etc. als Widerstand gegen die Aufdeckung der eigenen wahren Motive zu verstehen. Mit einer solchen Perspektive kann sich dann der Therapeut gegen die interaktive Zumutung unterschiedlicher Wahrnehmungen immunisieren.„Einer Person Beweggründe zuzuschreiben, die von ihr nicht geteilt werden, bedeutet aber nicht nur, die Ebene der Intersubjektivität zu verlassen und die Person als Objekt zu behandeln, sondern heißt darüber hinaus, in Anspruch zu nehmen, die Beweggründe der Person besser zu kennen als diese selbst“. Nun sind Deutungen aber ja nicht nur eine therapeutische Technik, sondern ein Alltagsphänomen, das immer dann zu finden ist, wenn Verhalten von Menschen von anderen Menschen erklärt bzw. diesen Motive zugeschrieben werden, die sie selbst nicht in Anschlag bringen. In einem sehr lesenswerten Artikel hat Ulrich Streeck (Foto: www.streeck.net), Arzt für Psychiatrie und Psychotherapie und für psychosomatische Medizin und Psychoanalytiker in Göttingen, der von 1985 bis 2011 Ärztlicher Direktor der Klinik Tiefenbrunn war, sich dem Thema Deutungen im sozialen Alltag und in Psychotherapie auseinandergesetzt:„Dass Deutungen im Sinne der Fremdzuschreibung von nicht geteilten Beweggründen im sozialen Alltag häufig als Angriffe und Übergriffe behandelt werden, kann auch Deutungen, die in therapeutischen Kontexten eingesetzt werden, in einem neuen Licht erscheinen lassen. Mutmaßungen über und Zuschreibungen von Motiven, die von der Person, an die sie adressiert sind, nicht ohne Weiteres geteilt werden, sind keine Erfindungen der Psychoanalyse; sie gehören zur Alltagskommunikation. Wie jeder kommunikative Austausch gründet auch das Gespräch, in dem die psychoanalytische Behandlung besteht (
), in alltagssprachlicher Verständigung. Weil wir uns im Alltag wechselseitig Zurechnungsfähigkeit zubilligen müssen, wenn wir uns verständigen wollen, geraten Deutungen hier so leicht zu Attacken: der gemeinten Person wird ihre Zurechnungsfähigkeit momentan bestritten. Das macht verständlich, warum es besonderer Vorkehrungen bedarf, damit Psychoanalytiker in Behandlungen von Deutungen Gebrauch machen können, ohne Gefahr zu laufen, dass der Patient die therapeutischen Interventionen als illegitime Übergriffe von sich weist oder nicht weniger bedenklich sich ihnen als autoritativen Sinnzuschreibungen des Analytikers schweigend unterwirft“ Nun sind Deutungen als Interaktionsangebote nicht nur in der Form von Behauptungen o.ä. vorfindbar, sondern stecken natürlich auch implizit in vielen Fragen oder indirekten Formulierungen. Auch systemische Therapeuten sind vor Deutungen nicht gefeit, da ihre Wirklichkeitskonstruktionen und Annahmen über das Beschaffensein von Problemen und Lösungen in ihre Fragen, Kommentare etc. eingehen. Der Umgang mit Deutungen als kommunikativem Format erfordert in dieser Hinsicht immer ein Einverständnis darüber, wie in der Therapie über eigene Annahmen, Vorstellungen, Phantasien etc. kommuniziert werden kann, ohne dass das als Übergriff erlebt wird:„Manchmal stellen unerfahrene Therapeuten Mutmaßungen über vermeintlich unbewusstes Erleben eines Patienten an, noch ehe sie mit dem Patienten eine Übereinkunft darüber erzielt haben, wie der therapeutische Dialog geführt werden soll, wie der Psychoanalytiker am therapeutischen Gespräch teilzunehmen beabsichtigt und welche Rolle dabei Äußerungen spielen sollen, die dem Patienten selbst vermeintlich nicht zugängliche Gründe seines Handelns benennen. Noch in einer der ersten Stunden des Zusammentreffens und noch bevor der Patient ausreichend darauf vorbereitet ist, wie das therapeutische Gespräch abgewickelt werden soll, deuten sie dessen Verhalten auf dem Patienten vermeintlich nicht zugängliche Beweggründe hin, und an dem Umgang mit dieser Deutung soll sich dann erweisen, ob und wie der Patient in der Lage ist, von Deutungen Gebrauch zu machen. Reagiert der Patient aversiv, wird das unter Umständen statt als Beleg für die Unangemessenheit und Aggressivität der interpretierenden Äußerung des Therapeuten zu diesem Zeitpunkt als Hinweis auf die vermeintlich eingeschränkten selbstreflexiven Fähigkeiten des Patienten behandelt“
Ein nicht unwesentlicher Aspekt der systemisch-konstruktivistischen Kritik an psychoanalytischen Ansätzen galt schon immer der Deutung im therapeutischen Gespräch. Mit einer Deutung wird das Handeln einer anderen Person in dem Sinne deutet, dass dieser Gründe und Motive für ihr Handeln zugerechnet werden, die die gemeinte Person selbst nicht geltend gemacht hat – oder sogar abstreitet. Wird die Deutung in der Psychoanalyse mit einem Wahrheitsanspruch oder mit überlegenem Experten-Zugriff auf die„eigentliche“ Wirklichkeit ausgestattet, wie es durchaus bei einigen psychoanalytischen Autorinnen und Autoren den Anschein hat, liegt es auf der Hand, damit nicht übereinstimmende andere Wahrnehmungen, Selbsterleben der Klienten etc. als Widerstand gegen die Aufdeckung der eigenen wahren Motive zu verstehen. Mit einer solchen Perspektive kann sich dann der Therapeut gegen die interaktive Zumutung unterschiedlicher Wahrnehmungen immunisieren.„Einer Person Beweggründe zuzuschreiben, die von ihr nicht geteilt werden, bedeutet aber nicht nur, die Ebene der Intersubjektivität zu verlassen und die Person als Objekt zu behandeln, sondern heißt darüber hinaus, in Anspruch zu nehmen, die Beweggründe der Person besser zu kennen als diese selbst“. Nun sind Deutungen aber ja nicht nur eine therapeutische Technik, sondern ein Alltagsphänomen, das immer dann zu finden ist, wenn Verhalten von Menschen von anderen Menschen erklärt bzw. diesen Motive zugeschrieben werden, die sie selbst nicht in Anschlag bringen. In einem sehr lesenswerten Artikel hat Ulrich Streeck (Foto: www.streeck.net), Arzt für Psychiatrie und Psychotherapie und für psychosomatische Medizin und Psychoanalytiker in Göttingen, der von 1985 bis 2011 Ärztlicher Direktor der Klinik Tiefenbrunn war, sich dem Thema Deutungen im sozialen Alltag und in Psychotherapie auseinandergesetzt:„Dass Deutungen im Sinne der Fremdzuschreibung von nicht geteilten Beweggründen im sozialen Alltag häufig als Angriffe und Übergriffe behandelt werden, kann auch Deutungen, die in therapeutischen Kontexten eingesetzt werden, in einem neuen Licht erscheinen lassen. Mutmaßungen über und Zuschreibungen von Motiven, die von der Person, an die sie adressiert sind, nicht ohne Weiteres geteilt werden, sind keine Erfindungen der Psychoanalyse; sie gehören zur Alltagskommunikation. Wie jeder kommunikative Austausch gründet auch das Gespräch, in dem die psychoanalytische Behandlung besteht (
), in alltagssprachlicher Verständigung. Weil wir uns im Alltag wechselseitig Zurechnungsfähigkeit zubilligen müssen, wenn wir uns verständigen wollen, geraten Deutungen hier so leicht zu Attacken: der gemeinten Person wird ihre Zurechnungsfähigkeit momentan bestritten. Das macht verständlich, warum es besonderer Vorkehrungen bedarf, damit Psychoanalytiker in Behandlungen von Deutungen Gebrauch machen können, ohne Gefahr zu laufen, dass der Patient die therapeutischen Interventionen als illegitime Übergriffe von sich weist oder nicht weniger bedenklich sich ihnen als autoritativen Sinnzuschreibungen des Analytikers schweigend unterwirft“ Nun sind Deutungen als Interaktionsangebote nicht nur in der Form von Behauptungen o.ä. vorfindbar, sondern stecken natürlich auch implizit in vielen Fragen oder indirekten Formulierungen. Auch systemische Therapeuten sind vor Deutungen nicht gefeit, da ihre Wirklichkeitskonstruktionen und Annahmen über das Beschaffensein von Problemen und Lösungen in ihre Fragen, Kommentare etc. eingehen. Der Umgang mit Deutungen als kommunikativem Format erfordert in dieser Hinsicht immer ein Einverständnis darüber, wie in der Therapie über eigene Annahmen, Vorstellungen, Phantasien etc. kommuniziert werden kann, ohne dass das als Übergriff erlebt wird:„Manchmal stellen unerfahrene Therapeuten Mutmaßungen über vermeintlich unbewusstes Erleben eines Patienten an, noch ehe sie mit dem Patienten eine Übereinkunft darüber erzielt haben, wie der therapeutische Dialog geführt werden soll, wie der Psychoanalytiker am therapeutischen Gespräch teilzunehmen beabsichtigt und welche Rolle dabei Äußerungen spielen sollen, die dem Patienten selbst vermeintlich nicht zugängliche Gründe seines Handelns benennen. Noch in einer der ersten Stunden des Zusammentreffens und noch bevor der Patient ausreichend darauf vorbereitet ist, wie das therapeutische Gespräch abgewickelt werden soll, deuten sie dessen Verhalten auf dem Patienten vermeintlich nicht zugängliche Beweggründe hin, und an dem Umgang mit dieser Deutung soll sich dann erweisen, ob und wie der Patient in der Lage ist, von Deutungen Gebrauch zu machen. Reagiert der Patient aversiv, wird das unter Umständen statt als Beleg für die Unangemessenheit und Aggressivität der interpretierenden Äußerung des Therapeuten zu diesem Zeitpunkt als Hinweis auf die vermeintlich eingeschränkten selbstreflexiven Fähigkeiten des Patienten behandelt“
Der Aufsatz von Ulrich Streeck ist in der Zeitschrift„Psychotherapie & Sozialwissenschaft“ 1/2011 erschienen und in der Systemischen Bibliothek des systemagazin mit freundlicher Erlaubnis des Autors und des Psychosozial-Verlages, in dem die Zeitschrift erscheint, nachzulesen.
Hier geht es zum vollen Text
20. Oktober 2012
von Tom Levold
Keine Kommentare
Für kurze Zeit können alle Beiträge aus der„Family Process“ 1/2012 im Online-Store von Wiley kostenfrei heruntergeladen werden. Das Heft liefert Beiträge zu vier unterschiedlichen Themenbereichen: 1. Narrative and Post-Structural Perspectives, 2. Parenting, 3. The Predictive Power of Family Variables, und 4. Collaborative Family Oriented Services. Autorinnen und Autoren sind u.a. Jay L. Lebow, Harlene Anderson, Laurie L. Charlés, Amy R. Tuttle, Eli Lebowitz, Haim Omer und Yoel Elizur.
Zum Heft geht es hier