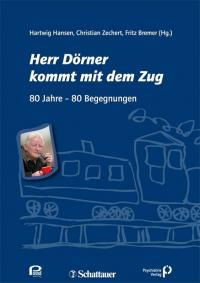Ich kreise um das, was ich suche, finde schließlich Begriffe, formuliere, was ich sagen will, und lege mich damit auf eine bestimmte Ausdrucksweise fest. Ich füge unterschiedliche Begriffswelten zusammen und schütze diese Verknüpfungen, indem ich eine Menge Sätze um sie herum baue und Bilder dazu entwerfe. Ich bahne damit Wege und schaffe einen Schein, den ich mag. Die gewählten Worte und damit verbundenen Assoziationen haben eine Selbstwirksamkeit, eine ihnen immanente, unsichtbare Erwartungsstruktur. Am interessantesten wird es in den Bereichen, wo die Begriffe sich reiben, weil sie sich selbst nicht mehr genügen und auf andere verweisen. Mir kommt vor, dass der Inhalt, den viele Begriffe ansprechen, hinter und zwischen ihnen zu finden ist in der Dynamik der Bedeutungen, die umkreisen, was sich eigentlich nicht sagen lässt.
Ich kreise um das, was ich suche, finde schließlich Begriffe, formuliere, was ich sagen will, und lege mich damit auf eine bestimmte Ausdrucksweise fest. Ich füge unterschiedliche Begriffswelten zusammen und schütze diese Verknüpfungen, indem ich eine Menge Sätze um sie herum baue und Bilder dazu entwerfe. Ich bahne damit Wege und schaffe einen Schein, den ich mag. Die gewählten Worte und damit verbundenen Assoziationen haben eine Selbstwirksamkeit, eine ihnen immanente, unsichtbare Erwartungsstruktur. Am interessantesten wird es in den Bereichen, wo die Begriffe sich reiben, weil sie sich selbst nicht mehr genügen und auf andere verweisen. Mir kommt vor, dass der Inhalt, den viele Begriffe ansprechen, hinter und zwischen ihnen zu finden ist in der Dynamik der Bedeutungen, die umkreisen, was sich eigentlich nicht sagen lässt.
Ich habe die Vorannahme, dass das, was ich zu beschreiben suche, dem entspricht, was der jeweilige Begriff meint. Wenn es meine Vorliebe ist, die diese Vorannahme über die Verwendbarkeit des Begriffs stärkt, dann kann es sein, dass das, was mittels dieses Begriffs im sprachlichen Raum erscheint, mehr mit dieser Vorliebe zu tun hat als mit dem, was ich beschreiben wollte. Da mir andererseits das, was ich zu beschreiben versuche, wichtiger ist als mein dafür gefundener sprachlicher Rahmen und meine Bilder, nehme ich gleichzeitig Abstand davon und versuche herauszufinden, ob ihm andere Formen vielleicht angemessener wären. Im Hinblick auf die jeweils gefundene einzelne sprachliche Form hilft mir Gelassenheit und eine gewisse ironische bzw. humorvolle Distanz. Im Hinblick auf das eigentlich Gemeinte und auf den Versuch, es immer wieder von neuem in Sprache zu fassen, kann und will ich diese Gelassenheit und innere Distanz aber oft nicht aufbringen – denn es ist mir wichtig.
Deshalb versuche ich mich der Verführung zu entziehen, mich an dem einen oder anderen Ruheplatz begrifflicher Festlegungen auf Dauer häuslich niederzulassen. Manchmal schreibe ich  etwas auf, um es dann wieder vergessen und mich mit anderem beschäftigen zu können mit Abzweigungen von den gewohnten Wegen meines Denkens, Wegweisern in eine Richtung, die vielversprechender erscheint, weil sie mir eine andere Haltung zu mir selbst und einen anderen Zugang zu meiner Welt vermittelt. Ich notiere diese Abzweigungen vom Vorgegebenen, weil ich sie beizeiten wieder finden möchte, um sie näher zu erkunden. Leider ist ihre Zahl inzwischen recht groß, so dass es mir schwer fällt, mich zu orientieren. Zehntausend Word-Files umfasst meine Festplatte inzwischen dem gegenüber scheint die Zahl der Texte, die ich veröffentlicht habe, sehr gering zu sein. Das Schreiben dient dem Suchen und bringt das dabei Gefundene in eine nur vorübergehend akzeptable Form. Ich habe damit begonnen, als ich in der Volksschule war zuerst handelte es sich um Geschichten über kleine Mädchen und ihre Abenteuer, dann um Tagebuchtexte, in denen das inzwischen älter gewordene Mädchen in all dem Abenteuerlichen, das sie erlebte, nach Selbstverständnis suchte. Statt als Jugendliche die Lokale unsicher zu machen und mich mit Gleichaltrigen zu vergnügen, verfasste ich einen utopischen Roman. Während meines Zoologiestudiums versuchte ich in einem theoretischen Text Gott und die Evolutionstheorie zu vereinen dies setzte ich zehn Jahre später im Rahmen einer theologischen Diplomarbeit fort, in der es um Gott und den Konstruktivismus ging. Und auch in den letzten Jahren kaue ich in meiner Freizeit an einem Buch über ein ähnliches Thema, das nicht und nicht fertig werden will. Dazwischen habe ich mich um ganz andere Texte bemüht z.B. um Forschungsberichte, Fachartikel oder Skripten für die systemische Ausbildung, in denen ich versuchte, eine mir eigene Sprache für die vermittelten Inhalte zu finden. Glücklicherweise ist mir das Tagebuchschreiben in den letzten Jahren abhanden gekommen hätte ich die Chance, jemals das Interesse einer Biografin zu wecken, dann wäre diese wohl trotzdem sehr beschäftigt und käme vor lauter Lesen zu gar nichts mehr. Ich habe mich in Gesprächen mit einem imaginären Beobachter (in dieser Phase Daimon genannt) aus vielen Problemen herausgeschrieben, habe schreibend die Antwort auf Fragen gesucht und schreibend neue Fragen erfunden. Ich habe Manuskripte von zweihundert Seiten auf ein Viertel zusammengekürzt um sie dann wieder auf das Doppelte zu erweitern. In meinen privaten Dateiordnern finden sich unveröffentlichte Gedichte, ein Theaterstück und ein fast fertiger Roman.
etwas auf, um es dann wieder vergessen und mich mit anderem beschäftigen zu können mit Abzweigungen von den gewohnten Wegen meines Denkens, Wegweisern in eine Richtung, die vielversprechender erscheint, weil sie mir eine andere Haltung zu mir selbst und einen anderen Zugang zu meiner Welt vermittelt. Ich notiere diese Abzweigungen vom Vorgegebenen, weil ich sie beizeiten wieder finden möchte, um sie näher zu erkunden. Leider ist ihre Zahl inzwischen recht groß, so dass es mir schwer fällt, mich zu orientieren. Zehntausend Word-Files umfasst meine Festplatte inzwischen dem gegenüber scheint die Zahl der Texte, die ich veröffentlicht habe, sehr gering zu sein. Das Schreiben dient dem Suchen und bringt das dabei Gefundene in eine nur vorübergehend akzeptable Form. Ich habe damit begonnen, als ich in der Volksschule war zuerst handelte es sich um Geschichten über kleine Mädchen und ihre Abenteuer, dann um Tagebuchtexte, in denen das inzwischen älter gewordene Mädchen in all dem Abenteuerlichen, das sie erlebte, nach Selbstverständnis suchte. Statt als Jugendliche die Lokale unsicher zu machen und mich mit Gleichaltrigen zu vergnügen, verfasste ich einen utopischen Roman. Während meines Zoologiestudiums versuchte ich in einem theoretischen Text Gott und die Evolutionstheorie zu vereinen dies setzte ich zehn Jahre später im Rahmen einer theologischen Diplomarbeit fort, in der es um Gott und den Konstruktivismus ging. Und auch in den letzten Jahren kaue ich in meiner Freizeit an einem Buch über ein ähnliches Thema, das nicht und nicht fertig werden will. Dazwischen habe ich mich um ganz andere Texte bemüht z.B. um Forschungsberichte, Fachartikel oder Skripten für die systemische Ausbildung, in denen ich versuchte, eine mir eigene Sprache für die vermittelten Inhalte zu finden. Glücklicherweise ist mir das Tagebuchschreiben in den letzten Jahren abhanden gekommen hätte ich die Chance, jemals das Interesse einer Biografin zu wecken, dann wäre diese wohl trotzdem sehr beschäftigt und käme vor lauter Lesen zu gar nichts mehr. Ich habe mich in Gesprächen mit einem imaginären Beobachter (in dieser Phase Daimon genannt) aus vielen Problemen herausgeschrieben, habe schreibend die Antwort auf Fragen gesucht und schreibend neue Fragen erfunden. Ich habe Manuskripte von zweihundert Seiten auf ein Viertel zusammengekürzt um sie dann wieder auf das Doppelte zu erweitern. In meinen privaten Dateiordnern finden sich unveröffentlichte Gedichte, ein Theaterstück und ein fast fertiger Roman.
Manchmal frage ich mich, ob dieser Schreibwahnsinn ein Erbe meiner Familie ist. Bei meinem Großvater finden sich neben vielen Gedichten auch gereimte Memoiren, welche die 30er und 40er Jahre in Wien zum Inhalt haben. Mein Vater verfasste ebenfalls Gedichte und von meiner Mutter gibt als Zeitzeugin viele persönliche Erinnerungen in Sammelbänden. Meine Tochter produziert Texte seitdem sie die ersten Buchstaben kritzeln konnte (vor kurzem sagte sie mir, dass das der Grund war, weshalb sie so schnell in die Schule gehen wollte um endlich die Geschichten in ihrem Kopf auf Papier bringen zu können). Inzwischen hat sie die Schriftstellerei zu ihrem Beruf gemacht und hoffentlich bald ihren Platz in der literarischen Szene. Und auch mein Sohn ist seit kurzem angesteckt worden und probiert die Geschichten in Worte zu fassen, die sich oft über Jahre hinweg in seinen Gedanken entfalten.
Meine Schreiberei bläst Begriffswelten auf und macht mich glücklich, hält mich aber auch vom Lesen und vom sonstigen Leben ab, denn sie kostet viel Zeit. Insofern ist sie ein teures Hobby – noch dazu wenn sie keinen unmittelbar in Geld oder Imagegewinn ablesbaren Nutzen bringt, wie bei mir. Wenn ich meine mit viel Mühe geborenen Wortgebilde nach Monaten und Jahren wieder lese, erscheinen sie mir fremd so als hätte sie ein anderer verfasst. Manchmal erkenne ich, dass ich vieles geschrieben habe ohne es wirklich zu verstehen dass ich mich in meine eigenen Worte verliebt und dabei den Inhalt übersehen habe. Dann beginne ich zu streichen und das Unnötige abzulösen. Ich schäle eine Zwiebel und ahne schon, dass letztlich nichts dabei herauskommen wird. Deshalb halte ich zeitweise inne, berge den vorübergehend saftig erscheinenden Kern in meiner Hand und verwende ihn zum Kochen.
4. Dezember 2013
von Tom Levold
Keine Kommentare

 Ich muss gestehen: Als Kind habe ich extrem wenig bis gar nicht gelesen. Mich hat einfach nichts interessiert. Weder Karl May noch Lederstrumpf noch irgendwelche andere sogenannte Kinder- und Jugendliteratur.
Ich muss gestehen: Als Kind habe ich extrem wenig bis gar nicht gelesen. Mich hat einfach nichts interessiert. Weder Karl May noch Lederstrumpf noch irgendwelche andere sogenannte Kinder- und Jugendliteratur.  langsamer, weniger ballgewandt, beherrschten das Dribbeln einfach nicht. Wen wunderts, die lasen halt.
langsamer, weniger ballgewandt, beherrschten das Dribbeln einfach nicht. Wen wunderts, die lasen halt.  Das sagt sich so leicht: Vierteljahrhundert. Doch ist es so. So lange ist es her, dass ich mit dem Schreiben begonnen habe. Natürlich nicht: mit dem Schreiben. Es ist das Schreiben mit der Absicht zu publizieren. Ich entsinne mich nicht mehr, was genau der Anfang war. Jedenfalls gab es irgendwann einige Zettel, vollgeschrieben mit Ideen, Querverbindungen zu anderen Ideen und noch unausgegorenen Skizzen, wie die Dinge zusammenhingen. Die Dinge, von denen mir schien, dass sie den Kern unserer Profession ausmachen. Das war schon so, es sollte das Ganze sein. Vision eben. Der Blick also nach oben, nach unten: nix in der Hand. Es fehlte mir eine Schreibmaschine. Schreib-what?! Ja, so hießen diese Geräte, mit denen man schrieb, wenn man nicht mit der Hand Schrift produzierte. An meiner Arbeitsstelle gab es eine, elektrisch. Die lieh ich mir dann über das Wochenende aus, nahm sie mit nach Hause, wenn ich genügend Gedanken gesammelt, durchgespielt, sortiert, auf Zettel verteilt und diese in Ordnung gebracht hatte. Ein Wochenende, drei Durchschläge per Kohlepapier und einiges mehr an zerknüllten Seiten. Wenn mitten im Text eine Passage nicht stimmte, musste die Seite neu eingespannt und von neuem begonnen werden. Am Montag stand die Maschine wieder in unserem Sekretariat. Schreiben und Schlepperei gehörten zusammen. Ebenso wie Warten. Ich entsinne mich, dass ich fast ein dreiviertel Jahr auf eine Antwort der Familiendynamik wartete, nachdem ich der Redaktion eine Besprechung zu Bill OHanlons Taproots geschickt hatte. An Heiligabend 1987 kam dann die Bestätigung und der Ausblick auf den Abdruck im April des kommenden Jahres. Es wurde dann April des Jahres danach. Grausamkeiten müssten am Anfang geschehen, wird Macchiavelli gerne zitiert, und so hat mir das sicher geholfen dabei, Wartezeiten zu überstehen in den folgenden Jahren. Wartezeiten sind Durststrecken für mich.
Das sagt sich so leicht: Vierteljahrhundert. Doch ist es so. So lange ist es her, dass ich mit dem Schreiben begonnen habe. Natürlich nicht: mit dem Schreiben. Es ist das Schreiben mit der Absicht zu publizieren. Ich entsinne mich nicht mehr, was genau der Anfang war. Jedenfalls gab es irgendwann einige Zettel, vollgeschrieben mit Ideen, Querverbindungen zu anderen Ideen und noch unausgegorenen Skizzen, wie die Dinge zusammenhingen. Die Dinge, von denen mir schien, dass sie den Kern unserer Profession ausmachen. Das war schon so, es sollte das Ganze sein. Vision eben. Der Blick also nach oben, nach unten: nix in der Hand. Es fehlte mir eine Schreibmaschine. Schreib-what?! Ja, so hießen diese Geräte, mit denen man schrieb, wenn man nicht mit der Hand Schrift produzierte. An meiner Arbeitsstelle gab es eine, elektrisch. Die lieh ich mir dann über das Wochenende aus, nahm sie mit nach Hause, wenn ich genügend Gedanken gesammelt, durchgespielt, sortiert, auf Zettel verteilt und diese in Ordnung gebracht hatte. Ein Wochenende, drei Durchschläge per Kohlepapier und einiges mehr an zerknüllten Seiten. Wenn mitten im Text eine Passage nicht stimmte, musste die Seite neu eingespannt und von neuem begonnen werden. Am Montag stand die Maschine wieder in unserem Sekretariat. Schreiben und Schlepperei gehörten zusammen. Ebenso wie Warten. Ich entsinne mich, dass ich fast ein dreiviertel Jahr auf eine Antwort der Familiendynamik wartete, nachdem ich der Redaktion eine Besprechung zu Bill OHanlons Taproots geschickt hatte. An Heiligabend 1987 kam dann die Bestätigung und der Ausblick auf den Abdruck im April des kommenden Jahres. Es wurde dann April des Jahres danach. Grausamkeiten müssten am Anfang geschehen, wird Macchiavelli gerne zitiert, und so hat mir das sicher geholfen dabei, Wartezeiten zu überstehen in den folgenden Jahren. Wartezeiten sind Durststrecken für mich.  Und ich lernte für mich, wie ich es als Redakteur anders machen wollte. Dazu verhalf mir als erster Arist von Schlippe, den ich in der Zwischenzeit für die neugegründete Systhema mit Texten wohl überschüttet hatte. Da zog er es vor, mich dann auch gleich an der Redakteursarbeit zu beteiligen und so wurde ich Mitglied der Redaktion. Arist ist einer von Zweien, an deren redaktionelle Betreuung von AutorInnen ich immer mit Respekt und Freude denke. Der andere ist Jürgen Hargens, der 1983 die Zeitschrift für Systemische Therapie auf den Weg gebracht hatte das für mich einschneidende und wegweisende Ereignis in systemischer Literatur hierzulande. Das erste Jahrzehnt dieser Zeitschrift ist mir immer noch eine Quelle der Inspiration. Beide, Arist und Jürgen, haben stets sehr bald reagiert, ausführlich, wohlwollend, nachvollziehbar sowohl in Zustimmung wie im Vorschlag von Veränderungen. Ich habe bei ihnen Grundlegendes gelernt über kritische Solidarität zwischen AutorInnen und RedakteurIn. Daran habe ich mich in den mittlerweile vielen Jahren als Redakteur und auch als Beiratsmitglied verschiedener Zeitschriften immer orientiert.
Ich frage mich, was solche Erinnerungen heutzutage bedeuten mögen. Was das Ringen mit den Begrenzungen, aber auch das Getragensein auf den Fundamenten einer analogen Welt heute für einen Eindruck zu machen vermöchte. Was solls heute? Einerseits kommt mir die Schnelligkeit der neuen Medien und elektronischen Kommunikationsformen entgegen. Warten muss ich jetzt weniger (und Schleppen auch nicht). Und wenn, dann bin ich zum Zeitpunkt der (aus meiner Sicht) verspäteten Antwort schon wieder weiter, habe neue Quellen angezapft, neues Material rundgeschickt, hier etwas beigesteuert, da etwas zum Rückmelden erhalten. Das geht schnell heute, und manchmal ist es auch hilfreich. Aber manchmal und das ist die andere Seite – frage ich mich schon, ob im Gewusel der Fülle, auch der publizierten Fülle, nicht manchmal die Substanz fehlt, das Durchgearbeitete, die bewältigte Notwendigkeit mit Durststrecken umzugehen. Es ist schon in Ordnung, der fehlenden Zeit der LeserInnen entgegenzukommen, auf Flüssigkeit und Eingängigkeit zu achten, notfalls Häppchen anzubieten, den Lesestoff zu magazinieren. Doch wenn es nur noch darauf ankäme, einen schnellen Eindruck im Vorübereilen zu ermöglichen, und wenn dabei die ZuMUTung gänzlich aufgegeben würde, auch die Auseinandersetzung mit den grundlegenden Fragen und Bedrängnissen erkennbar zu machen, und dazu anzuregen, dann fehlte mir doch etwas. Dann wäre der eingebaute Lese-Scanner in Brille oder Brilli effizienter. Nur die Frage: Wozu?, diese Frage würde dann überflüssig, so scheint mir. Literatur, die anregt, ist immer auch unberechenbar, in ihrer Wirkung offen, insofern ein Risiko ein blühendes allerdings. Literatur, die nur noch als Medium zum Briefing gilt, kann dafür nicht mehr offen sein. Sie soll etwas her-stellen, nicht mehr handeln. Ach ja, Hannah Arendt, Vita activa, nun gut.
Und ich lernte für mich, wie ich es als Redakteur anders machen wollte. Dazu verhalf mir als erster Arist von Schlippe, den ich in der Zwischenzeit für die neugegründete Systhema mit Texten wohl überschüttet hatte. Da zog er es vor, mich dann auch gleich an der Redakteursarbeit zu beteiligen und so wurde ich Mitglied der Redaktion. Arist ist einer von Zweien, an deren redaktionelle Betreuung von AutorInnen ich immer mit Respekt und Freude denke. Der andere ist Jürgen Hargens, der 1983 die Zeitschrift für Systemische Therapie auf den Weg gebracht hatte das für mich einschneidende und wegweisende Ereignis in systemischer Literatur hierzulande. Das erste Jahrzehnt dieser Zeitschrift ist mir immer noch eine Quelle der Inspiration. Beide, Arist und Jürgen, haben stets sehr bald reagiert, ausführlich, wohlwollend, nachvollziehbar sowohl in Zustimmung wie im Vorschlag von Veränderungen. Ich habe bei ihnen Grundlegendes gelernt über kritische Solidarität zwischen AutorInnen und RedakteurIn. Daran habe ich mich in den mittlerweile vielen Jahren als Redakteur und auch als Beiratsmitglied verschiedener Zeitschriften immer orientiert.
Ich frage mich, was solche Erinnerungen heutzutage bedeuten mögen. Was das Ringen mit den Begrenzungen, aber auch das Getragensein auf den Fundamenten einer analogen Welt heute für einen Eindruck zu machen vermöchte. Was solls heute? Einerseits kommt mir die Schnelligkeit der neuen Medien und elektronischen Kommunikationsformen entgegen. Warten muss ich jetzt weniger (und Schleppen auch nicht). Und wenn, dann bin ich zum Zeitpunkt der (aus meiner Sicht) verspäteten Antwort schon wieder weiter, habe neue Quellen angezapft, neues Material rundgeschickt, hier etwas beigesteuert, da etwas zum Rückmelden erhalten. Das geht schnell heute, und manchmal ist es auch hilfreich. Aber manchmal und das ist die andere Seite – frage ich mich schon, ob im Gewusel der Fülle, auch der publizierten Fülle, nicht manchmal die Substanz fehlt, das Durchgearbeitete, die bewältigte Notwendigkeit mit Durststrecken umzugehen. Es ist schon in Ordnung, der fehlenden Zeit der LeserInnen entgegenzukommen, auf Flüssigkeit und Eingängigkeit zu achten, notfalls Häppchen anzubieten, den Lesestoff zu magazinieren. Doch wenn es nur noch darauf ankäme, einen schnellen Eindruck im Vorübereilen zu ermöglichen, und wenn dabei die ZuMUTung gänzlich aufgegeben würde, auch die Auseinandersetzung mit den grundlegenden Fragen und Bedrängnissen erkennbar zu machen, und dazu anzuregen, dann fehlte mir doch etwas. Dann wäre der eingebaute Lese-Scanner in Brille oder Brilli effizienter. Nur die Frage: Wozu?, diese Frage würde dann überflüssig, so scheint mir. Literatur, die anregt, ist immer auch unberechenbar, in ihrer Wirkung offen, insofern ein Risiko ein blühendes allerdings. Literatur, die nur noch als Medium zum Briefing gilt, kann dafür nicht mehr offen sein. Sie soll etwas her-stellen, nicht mehr handeln. Ach ja, Hannah Arendt, Vita activa, nun gut. Heute vor hundert Jahren wurde Mary Ainsworth, die gemeinsam mit John Bowlby die Bindungsforschung populär machte, in Glendale, Ohio, geboren. Sie studierte ab 1929 Psychologie an der University of Toronto, schloss 1936 mit einem M.A. ab und wurde 1939 promoviert. In der kanadischen Armee, in die sie 1942 eintrat, stieg sie bis zum Majorsrang auf. Im Anschluss an ihre Dienstzeit lehrte sie in Toronto Persönlichkeitspsychologie und begann mit eigenen Forschungen auf diesem Gebiet. 1950 begleitete sie ihren Mann Leonard Ainsworth nach London und trat eine Stelle in der von John Bowlby geleiteten Forschungsgruppe an der Tavistock Clinic an, die den Einfluss der Trennung von Mutter und Kind auf die kindliche Entwicklung untersuchte. Gemeinsam mit ihrem Mann, der eine Stelle beim East African Institute of Social Research in Uganda angeboten bekommen hatte, reiste sie nach Afrika und untersuchte dort vorbildliche Mutter-Kind-Beziehungen beim Volk der Ganda, die Grundlage ihres Buches Infancy in Uganda. Sie entwickelte eine Theorie unterschiedlicher Bindungsqualitäten und -muster, die auch heute noch in der Bindungsforschung von zentraler Bedeutung sind. Mit John Bowlby arbeitete sie eng zusammen und hatte zahlreiche Veröffentlichungen. Sie starb am 21.3.1999 im Alter von 85 Jahren in Charlottesville, Virginia. In einem schönen Text für die Zeitschrift„Attachment and Human Development“ haben Karin und Klaus Grossmann, die seit über 40 Jahren das Gesicht der Bindungsforschung in Deutschland prägen, Mary Ainsworth in ihren Todesjahr gewürdigt. Den vollständigen Text
Heute vor hundert Jahren wurde Mary Ainsworth, die gemeinsam mit John Bowlby die Bindungsforschung populär machte, in Glendale, Ohio, geboren. Sie studierte ab 1929 Psychologie an der University of Toronto, schloss 1936 mit einem M.A. ab und wurde 1939 promoviert. In der kanadischen Armee, in die sie 1942 eintrat, stieg sie bis zum Majorsrang auf. Im Anschluss an ihre Dienstzeit lehrte sie in Toronto Persönlichkeitspsychologie und begann mit eigenen Forschungen auf diesem Gebiet. 1950 begleitete sie ihren Mann Leonard Ainsworth nach London und trat eine Stelle in der von John Bowlby geleiteten Forschungsgruppe an der Tavistock Clinic an, die den Einfluss der Trennung von Mutter und Kind auf die kindliche Entwicklung untersuchte. Gemeinsam mit ihrem Mann, der eine Stelle beim East African Institute of Social Research in Uganda angeboten bekommen hatte, reiste sie nach Afrika und untersuchte dort vorbildliche Mutter-Kind-Beziehungen beim Volk der Ganda, die Grundlage ihres Buches Infancy in Uganda. Sie entwickelte eine Theorie unterschiedlicher Bindungsqualitäten und -muster, die auch heute noch in der Bindungsforschung von zentraler Bedeutung sind. Mit John Bowlby arbeitete sie eng zusammen und hatte zahlreiche Veröffentlichungen. Sie starb am 21.3.1999 im Alter von 85 Jahren in Charlottesville, Virginia. In einem schönen Text für die Zeitschrift„Attachment and Human Development“ haben Karin und Klaus Grossmann, die seit über 40 Jahren das Gesicht der Bindungsforschung in Deutschland prägen, Mary Ainsworth in ihren Todesjahr gewürdigt. Den vollständigen Text Liebe Leserinnen und Leser,
Liebe Leserinnen und Leser,
 Kurt Buchinger ist ein wichtiger Wegbereiter für die Theorie und Praxis systemischer Supervision und Organisationsberatung. Er begeht heute seinen 70. Geburtstag und systemagazin gratuliert von Herzen. Kurt Buchinger ist den systemagazin-Lesern durch eine ganze Reihe von Texten bekannt, die in der
Kurt Buchinger ist ein wichtiger Wegbereiter für die Theorie und Praxis systemischer Supervision und Organisationsberatung. Er begeht heute seinen 70. Geburtstag und systemagazin gratuliert von Herzen. Kurt Buchinger ist den systemagazin-Lesern durch eine ganze Reihe von Texten bekannt, die in der  Matthias
Matthias  prominenter Mitbegründer der vergleichenden Verhaltensforschung von sich,„er redete mit dem Vieh, den Vögeln und den Fischen“ (- so der Titel seines Erstlingswerks). Und heute ist es eine Heerschar hochgerüsteter Zoologen, Ethologen, Tierpsychologen, Primatologen und anderer Verhaltensforscher, die sich mit den unterschiedlichsten Aspekten der Mensch-Tier-Kommunikation beschäftigen. Doch die Arbeiten dieser Wissenschaftler lassen immer aufs neue an eine offenbar weitsichtige Bemerkung Montaignes denken, der vor über 400 Jahren im Zweiten Buch seiner Essays schrieb:„Der Mangel, der ein gegenseitiges Verständnis zwischen Tieren und Menschen verhindert, warum sollte der nicht ebensogut bei uns wie bei ihnen zu suchen sein?“. Montaignes Zweifel erhält nämlich gerade dann eine besondere Bedeutung und Aktualität, wenn man ihn auf die Arbeiten dieser modernen Verhaltensforscher bezieht. Nahezu alle diese Arbeiten durchzieht nämlich ein grundsätzlicher Mangel, der signifikant in dem eben zitierten Buchtitel zum Ausdruck kommt: während dort noch die kommunikative Leistung eines Menschen, mit Tieren zu reden, in den Mittelpunkt gerückt und als Thema des Buches avisiert wird, ist davon im Buch selbst, in dem es primär um die Schilderung der Verhaltensweisen verschiedener Tiergattungen geht, kaum mehr die Rede. Das aber kennzeichnet die Arbeiten der modernen Verhaltensforschung zur Mensch-Tier-Kommunikation durchgängig, der Mangel nämlich, daß in ihnen die Funktionsweisen und Organisationsprinzipien der menschlichen Kommunikation als bekannt vorausgesetzt und wie selbstverständlich als Bedingungen der Kommunikation mit Tieren präsupponiert werden. In kaum einem Fall wird es für notwendig befunden, den kommunikativen Part, den Menschen in der Kommunikation mit Tieren spielen, zum Thema der Untersuchung zu machen. Welches kommunikative Verhalten wir Menschen im Umgang mit Tieren zeigen, das wissen diese Forscher immer schon und scheint ihnen jedenfalls irrelevant. Für die Untersuchung der Mensch-Tier-Kommunikation ist das jedoch ein elementares Versäumnis. Denn was immer das Tier als seinen Teil in den Austausch mit einem Menschen einbringt, gewiß verlassen wir uns im Umgang mit Tieren zunächst auf unsere gattungs- und kulturspezifischen Fertigkeiten und Routinen der Kommunikation. Die folgenden Beobachtungen und Überlegungen haben weder das Ziel, die Kritik an der Forschung über Mensch-Tier-Kommunikation im Detail zu belegen und auszuführen; sie beanspruchen auch nicht – einer gewissen Forschungstradition folgend -, Verständigungsmöglichkeiten zwischen Mensch und Tier zu bestimmen, noch geht es in ihnen um die„Sprache der Tiere“. Stattdessen soll an einem kleinen Datenkorpus explorativ verfolgt werden, wie Menschen im häuslichen Bereich kommunikativ mit Tieren – und das heißt hier: mit ihren Haustieren – umgehen. Gefragt wird also nach Strukturen der menschlichen Kommunikation, in deren Verlauf sich Kontakte mit Haustieren realisieren. Zu neuen Erkenntnissen über das Verhalten von Haustieren wird die Untersuchung der Mensch-Tier-Kommunikation nur insoweit führen, als wir darin etwas über uns und unsere Kommunikationspraxis erfahren.
prominenter Mitbegründer der vergleichenden Verhaltensforschung von sich,„er redete mit dem Vieh, den Vögeln und den Fischen“ (- so der Titel seines Erstlingswerks). Und heute ist es eine Heerschar hochgerüsteter Zoologen, Ethologen, Tierpsychologen, Primatologen und anderer Verhaltensforscher, die sich mit den unterschiedlichsten Aspekten der Mensch-Tier-Kommunikation beschäftigen. Doch die Arbeiten dieser Wissenschaftler lassen immer aufs neue an eine offenbar weitsichtige Bemerkung Montaignes denken, der vor über 400 Jahren im Zweiten Buch seiner Essays schrieb:„Der Mangel, der ein gegenseitiges Verständnis zwischen Tieren und Menschen verhindert, warum sollte der nicht ebensogut bei uns wie bei ihnen zu suchen sein?“. Montaignes Zweifel erhält nämlich gerade dann eine besondere Bedeutung und Aktualität, wenn man ihn auf die Arbeiten dieser modernen Verhaltensforscher bezieht. Nahezu alle diese Arbeiten durchzieht nämlich ein grundsätzlicher Mangel, der signifikant in dem eben zitierten Buchtitel zum Ausdruck kommt: während dort noch die kommunikative Leistung eines Menschen, mit Tieren zu reden, in den Mittelpunkt gerückt und als Thema des Buches avisiert wird, ist davon im Buch selbst, in dem es primär um die Schilderung der Verhaltensweisen verschiedener Tiergattungen geht, kaum mehr die Rede. Das aber kennzeichnet die Arbeiten der modernen Verhaltensforschung zur Mensch-Tier-Kommunikation durchgängig, der Mangel nämlich, daß in ihnen die Funktionsweisen und Organisationsprinzipien der menschlichen Kommunikation als bekannt vorausgesetzt und wie selbstverständlich als Bedingungen der Kommunikation mit Tieren präsupponiert werden. In kaum einem Fall wird es für notwendig befunden, den kommunikativen Part, den Menschen in der Kommunikation mit Tieren spielen, zum Thema der Untersuchung zu machen. Welches kommunikative Verhalten wir Menschen im Umgang mit Tieren zeigen, das wissen diese Forscher immer schon und scheint ihnen jedenfalls irrelevant. Für die Untersuchung der Mensch-Tier-Kommunikation ist das jedoch ein elementares Versäumnis. Denn was immer das Tier als seinen Teil in den Austausch mit einem Menschen einbringt, gewiß verlassen wir uns im Umgang mit Tieren zunächst auf unsere gattungs- und kulturspezifischen Fertigkeiten und Routinen der Kommunikation. Die folgenden Beobachtungen und Überlegungen haben weder das Ziel, die Kritik an der Forschung über Mensch-Tier-Kommunikation im Detail zu belegen und auszuführen; sie beanspruchen auch nicht – einer gewissen Forschungstradition folgend -, Verständigungsmöglichkeiten zwischen Mensch und Tier zu bestimmen, noch geht es in ihnen um die„Sprache der Tiere“. Stattdessen soll an einem kleinen Datenkorpus explorativ verfolgt werden, wie Menschen im häuslichen Bereich kommunikativ mit Tieren – und das heißt hier: mit ihren Haustieren – umgehen. Gefragt wird also nach Strukturen der menschlichen Kommunikation, in deren Verlauf sich Kontakte mit Haustieren realisieren. Zu neuen Erkenntnissen über das Verhalten von Haustieren wird die Untersuchung der Mensch-Tier-Kommunikation nur insoweit führen, als wir darin etwas über uns und unsere Kommunikationspraxis erfahren.