 Nachdem das systemagazin krankheitshalber etwas länger als vorgesehen pausiert hat, gibt es heute zwei Rezensionen zu einem Roman von Jürgen Hargens, der sich um einen Psychotherapeuten im Ruhestand dreht, der seinen Ruhestand durch Detektivtätigkeiten etwas unruhiger macht, aber nur ein bisschen. Denn was ist das Chamäleon Prinzip des Therapeuten Suter? Antwort: ,
bei vollständiger Präsenz unsichtbar bleiben. Handeln, ohne dass die Leute das Gefühl haben, von mir beeinflusst zu werden
.ruhig dasitzen, alles registrieren, ohne sofort zu reagieren. Wahrnehmen, abwarten, ruhig bleiben.‘ ,Wenn Du nicht weißt, was Du tun sollst, dann tue am besten gar nichts! Das richtet am wenigsten Schaden an.‘ Fazit: Jürgen Hargens erzählt in ,Suter‘ eine spannende, facettenreiche Geschichte. Jedes Kapitel wirft Fragen auf und weckt Neugierde auf das nächste Kapitel, die nächsten Begegnungen. Ein Lese-Spaß nicht nur für ,Psychos’. Soweit Holger Wetjen. Auch Rezensent Heinz Graumann ist angetan: Jürgen Hargens beschreibt den Charme des Lebens in einer Kleinstadt im Norden, mit der Landschaft der Umgebung und den alten Landhäusern, dem Klima, mit viel Regen, Wind und klarer, frischer Luft. Es geht auch um Themen des Älterwerdens: Alternative Wohnformen in einer Alten-WG und Bedrohung durch Demenz tauchen in der Geschichte auf, aber auch die im Alter nicht versiegende Lust auf Neues, neue Kontakte und unerwartete Begegnungen. Hier und da erhält der Leser Einblick in die Arbeit und das Denken des Therapeuten und Beraters Jürgen Hargens. So gibt er erzählerisch überraschende Antworten auf die Fragen, was eigentlich vor oder nach einer Therapie-Sitzung geschieht, was in den Klienten und was im Therapeuten vor sich geht“
Nachdem das systemagazin krankheitshalber etwas länger als vorgesehen pausiert hat, gibt es heute zwei Rezensionen zu einem Roman von Jürgen Hargens, der sich um einen Psychotherapeuten im Ruhestand dreht, der seinen Ruhestand durch Detektivtätigkeiten etwas unruhiger macht, aber nur ein bisschen. Denn was ist das Chamäleon Prinzip des Therapeuten Suter? Antwort: ,
bei vollständiger Präsenz unsichtbar bleiben. Handeln, ohne dass die Leute das Gefühl haben, von mir beeinflusst zu werden
.ruhig dasitzen, alles registrieren, ohne sofort zu reagieren. Wahrnehmen, abwarten, ruhig bleiben.‘ ,Wenn Du nicht weißt, was Du tun sollst, dann tue am besten gar nichts! Das richtet am wenigsten Schaden an.‘ Fazit: Jürgen Hargens erzählt in ,Suter‘ eine spannende, facettenreiche Geschichte. Jedes Kapitel wirft Fragen auf und weckt Neugierde auf das nächste Kapitel, die nächsten Begegnungen. Ein Lese-Spaß nicht nur für ,Psychos’. Soweit Holger Wetjen. Auch Rezensent Heinz Graumann ist angetan: Jürgen Hargens beschreibt den Charme des Lebens in einer Kleinstadt im Norden, mit der Landschaft der Umgebung und den alten Landhäusern, dem Klima, mit viel Regen, Wind und klarer, frischer Luft. Es geht auch um Themen des Älterwerdens: Alternative Wohnformen in einer Alten-WG und Bedrohung durch Demenz tauchen in der Geschichte auf, aber auch die im Alter nicht versiegende Lust auf Neues, neue Kontakte und unerwartete Begegnungen. Hier und da erhält der Leser Einblick in die Arbeit und das Denken des Therapeuten und Beraters Jürgen Hargens. So gibt er erzählerisch überraschende Antworten auf die Fragen, was eigentlich vor oder nach einer Therapie-Sitzung geschieht, was in den Klienten und was im Therapeuten vor sich geht“
zu den vollständigen Rezensionen
23. Februar 2014
von Tom Levold
Keine Kommentare


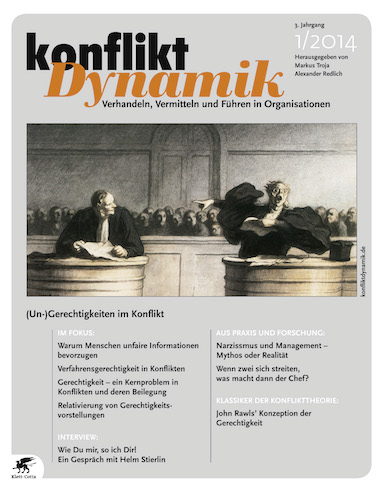
 1976 führte Steward Brand, Begründer und Herausgeber des sagenumwobenen Whole Earth Catalogue der US-amerikanischen Subkultur, der auf vielfältige Weise auch mit Personen aus dem Kreis der Kybernetiker vernetzt war, ein langes Gespräch mit Gregory Bateson und dessen Ex-Frau Margaret Mead, in dem sie sich über die Geschichte der ersten Macy-Konferenz unterhalten, über die Begründer der Kybernetik, die Geschichte der Begriffe Feed-Back und Schismogenese u.v.a. Das Gespräch wurde auf Tonband aufgenommen, transkribiert und erschien
1976 führte Steward Brand, Begründer und Herausgeber des sagenumwobenen Whole Earth Catalogue der US-amerikanischen Subkultur, der auf vielfältige Weise auch mit Personen aus dem Kreis der Kybernetiker vernetzt war, ein langes Gespräch mit Gregory Bateson und dessen Ex-Frau Margaret Mead, in dem sie sich über die Geschichte der ersten Macy-Konferenz unterhalten, über die Begründer der Kybernetik, die Geschichte der Begriffe Feed-Back und Schismogenese u.v.a. Das Gespräch wurde auf Tonband aufgenommen, transkribiert und erschien  in der Zeitschrift CoEvolution Quarterly. Heute ist es im Internet zu lesen, leider in einer nicht besonders gut lesbaren Form mit reichlich Schreibfehlern, was dem Vergnügen an der Lektüre aber keinen Abbruch tut, da beide auch viel aus dem Nähkästchen plaudern und Margaret Mead sowohl ihr gutes Gedächtnis als auch eine gewisse rechthaberische Art zur Geltung bringt. Der Text sei daher allen undingt empfohlen, die sich für die Geschichte der Kybernetik interessieren.
in der Zeitschrift CoEvolution Quarterly. Heute ist es im Internet zu lesen, leider in einer nicht besonders gut lesbaren Form mit reichlich Schreibfehlern, was dem Vergnügen an der Lektüre aber keinen Abbruch tut, da beide auch viel aus dem Nähkästchen plaudern und Margaret Mead sowohl ihr gutes Gedächtnis als auch eine gewisse rechthaberische Art zur Geltung bringt. Der Text sei daher allen undingt empfohlen, die sich für die Geschichte der Kybernetik interessieren. Heute vor 10 Jahren ist Gianfranco Cecchin tödlich verunglückt. Ursprünglich gemeinsam mit Mara Selvini Palazzoli, Luigi Boscolo und Giuliana Prata im„Gründungsteam“ des„Mailänder Ansatzes“, löste er sich dann in den 80er Jahren von Selvini und arbeitete eng mit Luigi Boscolo therapeutisch und als international gefragte Lehrtherapeuten zusammen. Zur Erinnerung an Gianfranco möchte ich heute auf einen schönen Aufsatz von Imelda McCarthy aus Irland hinweisen, den sie über den Einfluss von Cecchin auf ihre eigene Arbeit aus irischer Perspektive im Jahre 2006 geschrieben hat, und der in der Zeitschrift Human Systems: The Journal of Systemic Consultation & Management erschienen ist (Vol. 17, 257-263). Sie schließt mit den Sätzen: Apart from these invitations there would be many more meetings over the next twenty years, at conferences, large and small. The favourite meetings were in my own home when he came to stay. Our learning of the Milan Approach and more particularly Gianfrancos version was in large part through knowing him well, watching him work and lastly reading his works.
Heute vor 10 Jahren ist Gianfranco Cecchin tödlich verunglückt. Ursprünglich gemeinsam mit Mara Selvini Palazzoli, Luigi Boscolo und Giuliana Prata im„Gründungsteam“ des„Mailänder Ansatzes“, löste er sich dann in den 80er Jahren von Selvini und arbeitete eng mit Luigi Boscolo therapeutisch und als international gefragte Lehrtherapeuten zusammen. Zur Erinnerung an Gianfranco möchte ich heute auf einen schönen Aufsatz von Imelda McCarthy aus Irland hinweisen, den sie über den Einfluss von Cecchin auf ihre eigene Arbeit aus irischer Perspektive im Jahre 2006 geschrieben hat, und der in der Zeitschrift Human Systems: The Journal of Systemic Consultation & Management erschienen ist (Vol. 17, 257-263). Sie schließt mit den Sätzen: Apart from these invitations there would be many more meetings over the next twenty years, at conferences, large and small. The favourite meetings were in my own home when he came to stay. Our learning of the Milan Approach and more particularly Gianfrancos version was in large part through knowing him well, watching him work and lastly reading his works.



 Untersuchung der Psychotherapie sowie Fragen der Epidemiologie und Versorgungsforschung. Matthias Ochs ist in der systemischen Szene vor allem durch die gemeinsame Organisation der Systemischen Forschungstagungen in Heidelberg (mit Jochen Schweitzer), als Herausgeber von www.systemisch-forschen.de und als Mitherausgeber des„Handbuches Systemisch Forschen“ bekannt (ebenfalls mit J. Schweitzer), er lehrt im Fachgebiet Psychologie und Beratung am Fachbereich Sozialwesen der Hochschule Fulda. Ihr differenzierter, umfassend informierter Text leistet in aller Kürze einen ausgezeichneten Überblick über die gegenwärtige soziologische Professionalisierungsdebatte und deren Relevanz für die Frage, inwiefern Psychotherapeuten (und insbesondere Psychologische Psychotherapeuten) als Profession zu betrachten sind (und sich selbst so betrachten) und inwieweit unterschiedlichen Professionalisierungskonzepte zu unterschiedlichen Annahmen hinsichtlich der Vollständigkeit von Professionalisierung oder gar einer Deprofessionalisierung von Professionalisierung führen. Im abstract heißt es: Wenn Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten an ihrem Arbeitsauftrag oder der Gültigkeit ihres Fachwissens zweifeln, diagnostiziert die Soziologie den ,Typus des postmodernen Professionellen‘. Dieser bekommt die Folgeprobleme des Modernisierungsprozesses Professionalisierung innerhalb seines Berufsstandes zu spüren und beginnt sie zu reflektieren. So lässt die Professionssoziologie ein alarmierendes Bild der Psychotherapie zeichnen: Ihr gelingt die Professionalisierung nur unvollständig, ihre gesellschaftliche Funktion und Legitimität muss sich infrage stellen lassen, Wissenschaft und die eigene Klientel bedrängen das professionelle Selbstverständnis und das tägliche Handeln wird paradox. Die Entwicklung des psychotherapeutischen Berufsstandes bietet Lesarten, in denen sich diese Hypothesen sowohl bestätigt als auch widerlegt sehen was in seiner Widersprüchlichkeit so zeitgenössisch wie fachlich notwendig und typisch für die Psychotherapeutenschaft sein mag. Der Text ist auch im Netz erschienen, allerdings nicht solo, da das aktuelle Heft als Ganzes im Netz ist,
Untersuchung der Psychotherapie sowie Fragen der Epidemiologie und Versorgungsforschung. Matthias Ochs ist in der systemischen Szene vor allem durch die gemeinsame Organisation der Systemischen Forschungstagungen in Heidelberg (mit Jochen Schweitzer), als Herausgeber von www.systemisch-forschen.de und als Mitherausgeber des„Handbuches Systemisch Forschen“ bekannt (ebenfalls mit J. Schweitzer), er lehrt im Fachgebiet Psychologie und Beratung am Fachbereich Sozialwesen der Hochschule Fulda. Ihr differenzierter, umfassend informierter Text leistet in aller Kürze einen ausgezeichneten Überblick über die gegenwärtige soziologische Professionalisierungsdebatte und deren Relevanz für die Frage, inwiefern Psychotherapeuten (und insbesondere Psychologische Psychotherapeuten) als Profession zu betrachten sind (und sich selbst so betrachten) und inwieweit unterschiedlichen Professionalisierungskonzepte zu unterschiedlichen Annahmen hinsichtlich der Vollständigkeit von Professionalisierung oder gar einer Deprofessionalisierung von Professionalisierung führen. Im abstract heißt es: Wenn Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten an ihrem Arbeitsauftrag oder der Gültigkeit ihres Fachwissens zweifeln, diagnostiziert die Soziologie den ,Typus des postmodernen Professionellen‘. Dieser bekommt die Folgeprobleme des Modernisierungsprozesses Professionalisierung innerhalb seines Berufsstandes zu spüren und beginnt sie zu reflektieren. So lässt die Professionssoziologie ein alarmierendes Bild der Psychotherapie zeichnen: Ihr gelingt die Professionalisierung nur unvollständig, ihre gesellschaftliche Funktion und Legitimität muss sich infrage stellen lassen, Wissenschaft und die eigene Klientel bedrängen das professionelle Selbstverständnis und das tägliche Handeln wird paradox. Die Entwicklung des psychotherapeutischen Berufsstandes bietet Lesarten, in denen sich diese Hypothesen sowohl bestätigt als auch widerlegt sehen was in seiner Widersprüchlichkeit so zeitgenössisch wie fachlich notwendig und typisch für die Psychotherapeutenschaft sein mag. Der Text ist auch im Netz erschienen, allerdings nicht solo, da das aktuelle Heft als Ganzes im Netz ist,