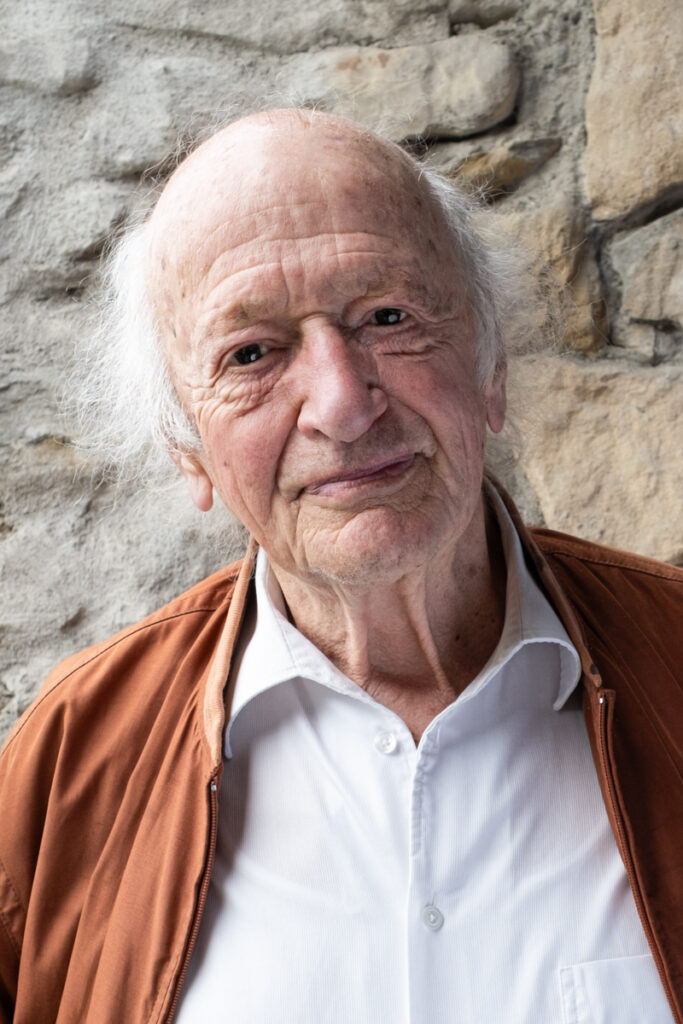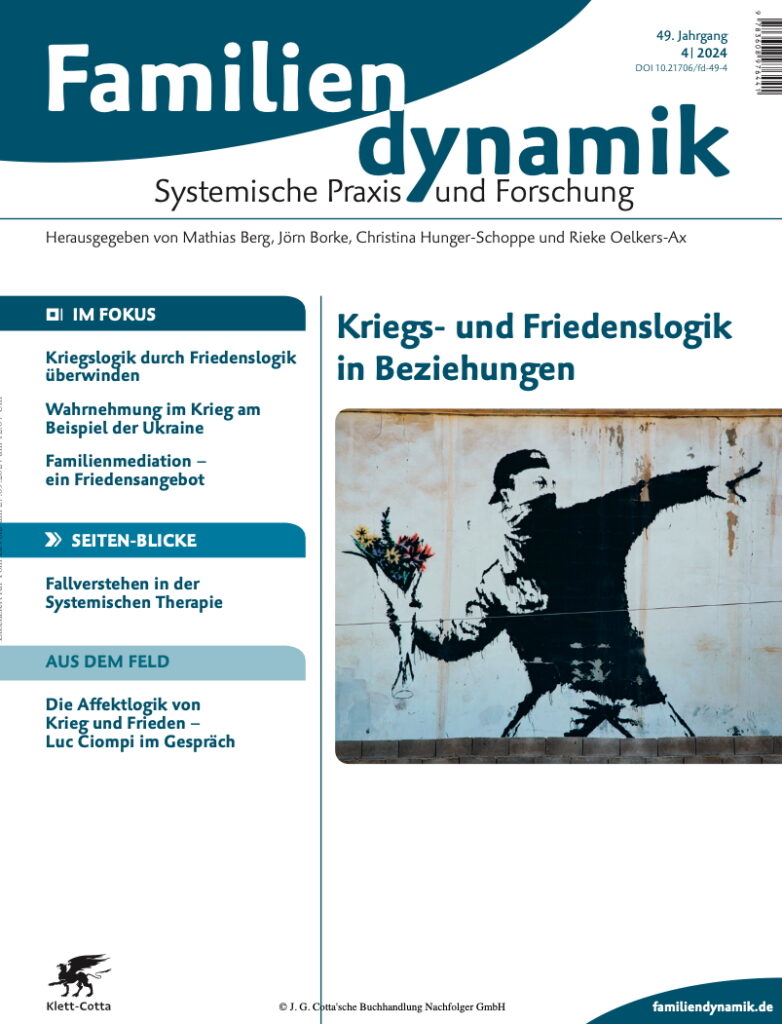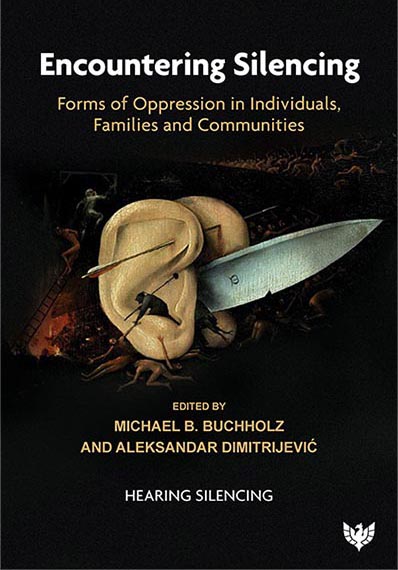Als ich vor 45 Jahren begann, familientherapeutisch zu Arbeiten, waren paradoxe Interventionen schwer angesagt. Dazu gehörten u.a. auch die Verschreibungen eines Symptoms, um durch eine gezielte Anregung die als unwillkürlich und nicht beeinflussbar erlebten Symptome zu einem Ergebnis willkürlichen Handelns zu machen. Das war sehr oft durchaus erfolgreich. Mit der Hinwendung zur Kybernetik 2 gerieten solche Interventionen aber zunehmen in den Hintergrund. Interessanterweise ist nun ein englischsprachiger Text zweier portugiesischer Autorinnen vom „Department of Psychiatry and Mental Health at the Health Unit of the Aveiro Region“ erschienen, der sich mit dem Schicksal der Symptomverschreibung in Literatur und Praxis beschäftigt und die Anwendung wiederbeleben möchte. Im Abstract heißt es:
„Die Symptomverschreibung ist eine Intervention, die von der Schule von Palo Alto beschrieben wurde und in einer Vielzahl von klinischen Kontexten als psychotherapeutisches Instrument eingesetzt wurde. Obwohl ihr Nutzen in der individuellen Psychotherapie in der Literatur untersucht wurde, ist ihre Anwendung in der Familientherapie kaum erforscht und in der Literatur nur wenig beschrieben. Es wurde eine kurze narrative Überprüfung der verfügbaren Literatur und Datenbanken wie PubMed unter Verwendung der folgenden Schlüsselwörter, einzeln oder in Kombination, durchgeführt: Symptomverschreibung, paradoxe Intervention, therapeutisches Paradoxon und Familientherapie. Literatur in englischer Sprache, die als relevant für das untersuchte Thema erachtet wurde, wurde als Referenzmaterial für die Überprüfung ausgewählt. Bei der Suche in Pub-Med wurden 31 Artikel gefunden, von denen acht als relevant ausgewählt wurden. Eine erweiterte Suche wurde mit GoogleScholar durchgeführt, wobei neun Artikel oder Texte aufgrund ihrer Relevanz ausgewählt wurden. Von den ausgewählten Artikeln wurden nur drei nach 2010 verfasst, wobei der Großteil der Literatur in den 80er Jahren produziert wurde. Paradoxe Interventionen sind kontraintuitive Interventionen, die eingesetzt werden, um die verstärkenden Rückkopplungsschleifen zu unterbrechen, die das behandelte Symptom aufrechterhalten. Die Literatur konzentriert sich auf die Definition, die Ethik der Umsetzung und die Techniken in verschiedenen psychotherapeutischen Kontexten. Neuere Studien zu diesem Thema sind rar. Die Autoren wollen dieses scheinbar ruhende Thema wiederbeleben, indem sie eine Beschreibung dieser therapeutischen Technik und ihrer Anwendung in der Familientherapie liefern und ihre potenziellen Vorteile erörtern.“ (Übersetzung TL).
Der vollständige Text ist hier zu finden.