 systemagazin wünscht allen Leserinnen und Lesern frohe Ostern und schöne Feiertage – und ist ein paar Tage mal weg…
systemagazin wünscht allen Leserinnen und Lesern frohe Ostern und schöne Feiertage – und ist ein paar Tage mal weg…
5. April 2015
von Tom Levold
Keine Kommentare

5. April 2015
von Tom Levold
Keine Kommentare
 systemagazin wünscht allen Leserinnen und Lesern frohe Ostern und schöne Feiertage – und ist ein paar Tage mal weg…
systemagazin wünscht allen Leserinnen und Lesern frohe Ostern und schöne Feiertage – und ist ein paar Tage mal weg…
4. April 2015
von Tom Levold
1 Kommentar
„Im Unterschied zu ‚alltäglichen‘ Katastrophen (Unfälle, Krankheit, Trennungen, Tod, Kränkungen etc.), die bei den unmittelbaren Betroffenen (einschließlich des psychosozialen Umfelds) zu einer Beeinträchtigung des Kohärenzgefühls und weitergehend zu einer physischen und/oder psychischen Beeinträchtigung bzw. Erkrankung führen können, werden die durch Medien an jeden Ort der Welt verbreiteten ‚Großschadensereignisse‘ (ein grauenhafter Begriff!) von Großgruppen wahrgenommen, die als Zuschauer ‚teilnehmen‘. Die Erleben der einzelnen Individuen wird dabei durch die (je nach Medium und Redaktion/Eigentümer) unterschiedliche Art der Darstellung beeinflußt und auf bestimmte Details gelenkt oder auch von solchen abgelenkt.
Zunächst konfrontiert uns das Geschehen mit der dem Individuum jederzeit drohenden, nun aber unmittelbar wahrgenommenen Gefährdung unserer Existenz – und weitergehend – auch der Endlichkeit unserer Existenz. Bewußt erlebt wird die Ohnmacht angesichts dessen, was geschieht und was wir nicht oder nur sehr partiell zu beeinflussen vermögen. Um diese Ohnmacht nicht aushalten zu müßen, liegt es nahe, einen Zustand anzustreben, der von der Vorstellung, von der Illusion getragen ist, (wieder) Einfluß nehmen zu können.
Die insbesondere bei Journalisten zu beobachtende Tendenz, sofort nach Ursachen und Schuld zu suchen (und über verschiedenste Möglichkeiten, möglichst mit ‚ExpertInnen‘ verschiedenster Herkunft zu spekulieren) kommt dem Bedürfnis der ‚KonsumentInnen‘ entgegen, möglichst wenig mit der Ohnmacht des Augenblicks und den damit einhergehenden Affekte und Gefühle (Trauer, Wut, Angst und Panik) konfrontiert zu werden.
Nicht anders ist der Versuch zu verstehen, daß PolitikerInnen, betroffenen Verbände, Gewerkschaften und andere Beteiligte Personen und Institutionen sofortige Maßnahmen fordern, die häufig wenig mit den kausalen (zumeist vorerst oder dauerhaft unklaren) Ursachen für das Eintreten des Ereignis zu tun haben. Hinzu kommt, daß einfache Erklärungen kaum zu erwarten sind – meist handelt es sich ja um überaus komplexe und schwer zu durchschauende (psychologische) Vorgänge, die oft schon von den Protagonisten (PolitikerInnen, Journalisten etc.) nur ansatzweise verstanden werden und weder dem Format journalistischer Beiträge (Rundfunk, Fernsehen, Zeitung und Internet) noch dem Interesse und Verständnis der breiten Leser-, Hörer bzw. Seherschaft entsprechen. Daß dabei auch andere Faktoren eine Rolle spielen (narzißtische Bedürfnisse, Machtstreben, Erwartung durch Medienpräsenz den Status und/oder Wahlchancen zu erhöhen) spielt zuweilen wohl auch eine nicht zu unterschätzende Rolle. Nicht zuletzt scheinen gerade PolitikerInnen, aber auch andere Beteiligte auf vermeintliche oder reale Vorwürfe (häufig in Boulevardzeitungen lanciert) zu reagieren, sie würden ‚wieder einmal nichts zu tun‘.
Bei mehr oder weniger namenhaften FachkollegInnen muß man sich schon sehr wundern, mit welcher (vermeintlichen) Selbstsicherheit sie sich mit Erklärungen zu den psychologischen Hintergründen von Handlungen in die Öffentlichkeit wagen, ohne die genauen Tatvorgänge oder die daran beteiligten Personen zu kennen.“
via: http://www.schweigepflicht-online.de/Seite_Aktuelles.htm
3. April 2015
von Tom Levold
3 Kommentare
2. April 2015
von Tom Levold
1 Kommentar

Foto: John H. White
(Flickr Commons)
Das Soziologiemagazin – Publizieren statt archivieren ist ein deutschlandweites Online-Magazin für Studierende und Soziologieinteressierte, das von Soziologiestudenten herausgegeben wird und auch als Printausgabe erhältlich ist. In Heft 8 vom Oktober 2013 (Thema: Kriminalität und soziale Normen: Wer weicht hier eigentlich wovon ab?) schreibt Felicitas Heßelmann lesenswert über Kommunikation und Gewalt im US-amerikanischen Ghetto aus einer systemtheoretischen Perspektive (Dank an Hannah Eller für den Link!). Im abstract heißt es: „Das US-amerikanische Ghetto wurde ethnografisch von zahlreichen Autorinnen und Autoren beschrieben. Hier wird jedoch ein systemtheoretischer Zugang gewählt, der das Ghetto als ein soziales System begreift, das mit dem Medium „Respekt“ und dem dazugehörigen Code erweisen/nicht erweisen operiert. Innerhalb dieses Systems erfüllt Gewaltanwendung eine kommunikative Funktion und tritt als legitimes Kommunikationsmittel im Konfliktfall auf. Damit stellt Gewaltanwendung in der Ghetto-Kommunikation nicht automatisch Devianz dar. Wie jede Kommunikation existiert und entwickelt sich auch diese Gewalt eigenständig von den psychischen Zuständen der kommunizierenden Individuen und ist daher nicht vollständig auf charakterliche oder psychische Dispositionen, wie Gewaltneigung, zurückzuführen. Damit wird Gewalt zum Produkt von Situationen und nicht von Personen. Dieser Erklärungsansatz findet seine Limitation allerdings in Bezug auf die Betrachtung der Inklusion/Exklusion der im Ghetto kommunizierenden Personen aus anderen (Funktions-)Systemen“.
1. April 2015
von Tom Levold
7 Kommentare
Der in der vergangenen Woche vom Co-Piloten der GermanWings-Maschine offenbar absichtlich eingeleitete Flugzeugabsturz mit 150 Toten hat neben einer Welle des Sensationsjournalismus auch eine Diskussion hervorgerufen, wie denn ein solches Unglück zu verhindern sei. Dabei werden bereits – wie leider bei medienwirksamen kriminellen Taten üblich – schon wieder reflexhaft von den relevanten Akteuren und Interessengruppen aus Politik, Medien und Verbänden weitgehende rechtliche Veränderungen gefordert, als ob diese zukünftige ähnliche Ereignisse ausschließen könnten. Da Informationen über eine frühere psychotherapeutische Behandlung aufgrund einer Depressions-Diagnose vorliegen, hört man schon erste Forderungen nach einer Aufweichung der ärztlichen bzw. psychotherapeutischen Schweigepflicht. Auch von Ärzt_innen und Psychotherapeut_innen zirkulieren nun zunehmend Stellungnahmen, die einerseits Zuständigkeit für die Analyse des Geschehens in Anspruch nehmen (und sich als die kompetentesten Fachkräfte zur Früherkennung einer solchen Gefährdungslage ins Spiel bringen), andererseits von der berechtigten Sorge gekennzeichnet sind, dass nun Menschen mit einer psychischen Problematik unter Generalverdacht geraten und noch mehr als bislang stigmatisiert werden. Ein Problem dieser Debatte ist dabei allerdings, dass die Informationen, auf die hierbei Bezug genommen wird, spärlich sind: über die Verlautbarungen in den Massenmedien hinaus wissen wir nicht viel über den Fall Andreas L. Umso spannender ist die Auseinandersetzung um die „richtige“ Konstruktion der Wirklichkeit zu beobachten, die die Öffentlichkeit beschäftigt. War es „Depression”, eine „psychiatrische Erkrankung”, ein „erweiterter Suizid“, „Amoklauf“, ein „Verbrechen“ oder „Attentat“? Und was sind die Gründe für solche Zuschreibungen? Welche Schlüsse lässt eine solche Handlung (wenn sie bewusst unternommen wurde) auf die Persönlichkeit und die Biografie des Handelnden zu (Siehe hierzu auch Fritz B. Simon in seiner Kehrwoche)? Fragen über Fragen. Martin Rufer aus Bern hat dazu eine klare Position bezogen, die ich hier im systemagazin zur Diskussion stellen möchte. Wie ist Ihre Sicht auf die Dinge? Ich freue mich auf Ihre Diskussionsbeiträge!
Tom Levold
31. März 2015
von Tom Levold
1 Kommentar
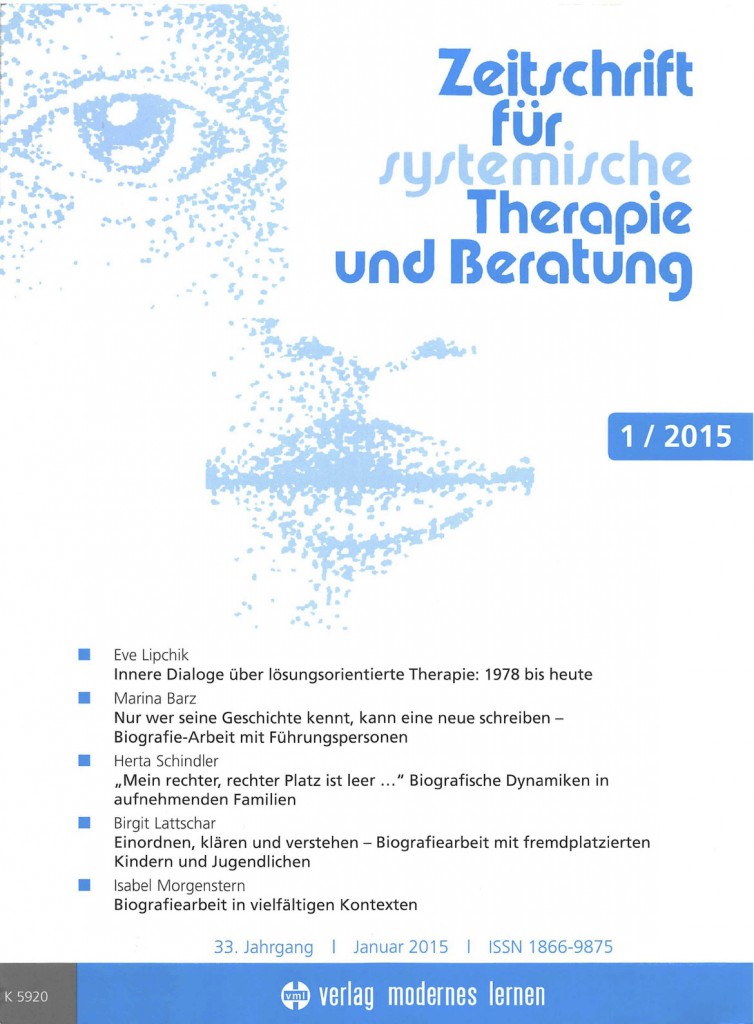
„In Max Frischs Stück ,Biografie: ein Spiel’ erhält der Protagonist die Möglichkeit, an einer Stelle seines Lebens wieder einzusteigen in dessen Fluss und dem Leben eine andere Wendung zu geben. Den Lebenslauf in eine andere Bahn lenken – das geht nur ab Jetzt. Dem bisherigen Lebenslauf eine andere Bedeutung verleihen, seine Herausforderungen als Bewältigungsressourcen erkennen und diese zu nutzen für neue und wenn es gut geht, bessere Wendungen, die Ressourcen am Wegesrand wertschätzen, das macht Sinn. Aus meiner Sicht wäre die ,Reinschrift’ dann das im Reinen Sein mit dem bisherigen Lebensweg, mit seinen guten Bedeutungen, Sinnstiftungen und kraftspendenden Beziehungen“. So leitet Cornelia Tsirigotis das aktuelle Heft der Zeitschrift für systemische Therapie und Beratung ein, das dem Thema Biografiearbeit gewidmet ist und wunderschön eingeleitet wird mit der Niederschrift des Vortrages, den Eve Lipchik, die gemeinsam mit Steve de Shazer und Insoo Kim Berg das Brief Family Therapy Center in Milwaukee gegründet und dieses dann aus vielerlei Gründen später verlassen hat, auf dem Kongress „Fremdgehen“ der ÖAS im vergangenen Frühling in Wien gehalten hat. Zu den vollständigen abstracts geht es hier…
29. März 2015
von Tom Levold
Keine Kommentare
In Saudi-Arabien wurden 2004 verpflichtende Gen- und Gesundheitstests vor der Heirat eingeführt. Jährlich nehmen an dem Programm „Gesunde Heirat“ 270.000 bis 300.000 Menschen teil. 2014 trennten sich aufgrund festgestellter „genetischer Inkompatibilitäten“ 165.000 heiratswillige Menschen nach Angaben von Medien. 60 Prozent der Teilnehmer trennen sich nach dem Test durchschnittlich von ihrem Heiratspartner, weil angeblich großes Risiko für Erbkrankheiten bei möglichen Kindern besteht.
29. März 2015
von Tom Levold
Keine Kommentare
1999 hat Don Coles vom Intensive Family Support Options Projekt auf der Australischen Familientherapie-Konferenz einen Vortrag zum Thema Arbeiten mit Familien mit behinderten Kindern gehalten, der im Australian and New Zealand Journal of Family Therapy erschien und 2003 in einer Übersetzung von Cornelia Tsirigotis auch in der Zeitschrift systhema veröffentlicht wurde. Dabei geht es u.a. um die Arbeit mit einer lösungsfokussierten Perspektive und um den Einsatz der Wunderfrage. Cole resümiert seinen Text folgendermaßen: „Ein lösungsorientierter Ansatz bei Familien, deren Kinder Behinderungen haben, erlaubt Ziele klar zu formulieren und baut auf schon existierenden Stärken und Kompetenzen der Familien auf. Es ermöglicht dem Therapeuten, sich auf die Fähigkeiten des Kindes oder Jugendlichen mit der Behinderung einzustellen und daran zu arbeiten, diese Stärken zu vergrößern (…). Dieser Ansatz schätzt die Erfahrung der Familien und erkennt die vielen Schwierigkeiten und Frustrationen an, denen sie begegnet sind, aber ohne störend den Nachdruck darauf zu legen. Lösungsorientierte Arbeit muss die Lebensumstände der Menschen berücksichtigen und sollte nicht derart erbarmungslos positiv sein, dass es nutzlos und unsensibel ist. Sie ist und war nie ein „Allheilmittel“. Die Wunderfrage produziert keine Wunder. Weiterlesen →
25. März 2015
von Tom Levold
2 Kommentare
Heute vor 35 Jahren starb Milton H. Erickson, der Begründer der modernen Hypnotherapie, der mit seinen unkonventionellen Vorgehensweisen und Interventionen auch ganz maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung der systemischen Therapie genommen hat. Er hinterließ nicht nur ein großes publiziertes Werk, sondern vermittelte sein Wissen und seine Techniken immer auch in Seminaren, von denen viele ihrerseits veröffentlichte Mitschnitte existieren. Eines der Bekannteren ist das von Erickson-Schüler Sidney Rosen herausgegebene Buch „My Voice Will Go With You. The Teaching Tales of Milton H. Erickson“ (Deutsch: „Meine Stimme begleitet Sie überall hin“, das als PDF auf der Seite consciousenergetics.com online gelesen werden kann.
23. März 2015
von Tom Levold
1 Kommentar
https://www.youtube.com/watch?v=ckIrhRKwgCg
22. März 2015
von Tom Levold
1 Kommentar

Wiltrud Brächter (2010) Geschichten im Sand
Am 6. September 2010 stellte ich im systemagazin einen Vorabdruck des Buches „Geschichten im Sand“ von Wiltrud Brächter vor, in dem sie ihre spieltherapeutische Arbeit mit Kindern darlegt. Dazu schrieb ich damals: „Als Dozent und Supervisor hatte ich lange Jahre das Vergnügen, Wiltrud Brächter bei der Entwicklung ihres kongenialen Konzeptes einer systemischen Spieltherapie begleiten zu dürfen. Ihre Arbeit zeichnet sich nicht nur durch eine gründliche theoretische Fundierung, sondern auch durch eine außerordentliche Phantasie und ihre phänomenale Fähigkeit aus, sich voll und ganz – eben spielerisch – auf die Welt der Kinder einzulassen, deren ,Geschichten im Sand’ sie behutsam zur Entfaltung verhilft. Das kann ich hier nur wiederholen. Sie schreibt selbst: „Spieltherapie trägt schon im Namen eine Sicht von Veränderungsprozessen, die der Arbeitsmetapher entgegengesetzt ist. Therapie als »Spiel« zu konzeptualisieren widerspricht gängigen Annahmen unserer Gegenwartskultur. In der Erwachsenenwelt gilt Spiel als (unproduktive) Freizeitbeschäftigung; auch der »Spiel-Raum« vieler Kinder wird zunehmend durch Aktivitäten beschnitten, die Fähigkeiten vermeintlich zielgerichteter fördern sollen. Neurobiologische Forschungen unterstützen dagegen einen spielerischen Weg zur Veränderung. Entwicklungsprozesse gelingen am leichtesten in einer »mood for development«. Systemische Therapie spielt bereits aufgrund ihres konstruktivistischen Hintergrunds mit unterschiedlichen Sichtweisen von Realität. Spiel bietet Kindern ähnliche Möglichkeiten: Beim »Tun als ob« nehmen Kinder eine gewünschte Realität vorweg, experimentieren mit Lösungsideen, ergreifen probeweise die Position anderer Personen und erfahren Zirkularität. Als Konstruktion von Wirklichkeit ist Spiel immer auch ein Spiel mit Möglichkeiten” (S. 232f.). Ein wunderbares Buch! Peter P. Allemann aus der Schweiz hat es gelesen und empfiehlt es ebenfalls wärmstens! Weiterlesen →
20. März 2015
von Tom Levold
Keine Kommentare
In einem sehr spannenden Text für das Online Journal „Forum Qualitative Sozialforschung“ befassen sich Till Jansen, Arist von Schlippe und Werner Vogd, die an der Universität Witten/Herdecke fachgebietsübergreifend kooperieren, mit der Frage, vor dem Hintergrund welcher theoretischer Perspektiven man soziale Praktiken in formalen Organisationen untersuchen kann. Die oft verwendete „dokumentarische Methode“ in der wissenssoziologischen Tradition Karl Mannheims geht z.B. davon aus, dass „soziale Praxen impliziten, verkörperten Wissensstrukturen entspringen, die von bestimmten Gruppen oder Menschen in ähnlichen Lebenskonstellationen geteilt werden“. In Organisationen ist das komplizierter, weil hier sehr unterschiedliche Wissensbestände aufeinandertreffen und auch kultiviert werden. Die Zusammenarbeit unterschiedlicher Disziplinen und die breite Streuung beruflicher Anforderungen und Karrieren machen Organisationen einerseits leistungsfähig, bringen andererseits aber auch ständige Verstehens- und Kommunikationsprobleme mit sich, was wiederum eine Herausforderung für die qualitative Rekonstruktion im Forschungskontext darstellt. Weiterlesen →
19. März 2015
von Tom Levold
2 Kommentare
WIESBADEN – Im Jahr 2013 lebten in Deutschland rund 35 000 gleichgeschlechtliche Paare als eingetragene Lebenspartnerschaft in einem Haushalt zusammen. Dies teilt das Statistische Bundesamt (Destatis) auf der Basis von Ergebnissen des Mikrozensus mit, der größten jährlichen Haushaltsbefragung in Deutschland. Das seit 2001 bestehende Lebenspartnerschaftsgesetz ermöglicht es zwei Menschen gleichen Geschlechts, ihrer Beziehung einen rechtlichen Rahmen zu geben.
Im Mikrozensus wird dieser Familienstand seit 2006 abgefragt. Die Zahl der eingetragenen Lebenspartnerschaften hat sich seitdem fast verdreifacht. 2006 hatte es knapp 12 000 eingetragene Lebenspartnerschaften in Deutschland gegeben.
Die im Jahr 2013 bestehenden eingetragenen Lebenspartnerschaften wurden zu 57 % von Männern geführt, das entspricht 20 000 Paaren. 15 000 Paare beziehungsweise 43 % waren eingetragene Lebenspartnerschaften von Frauen.