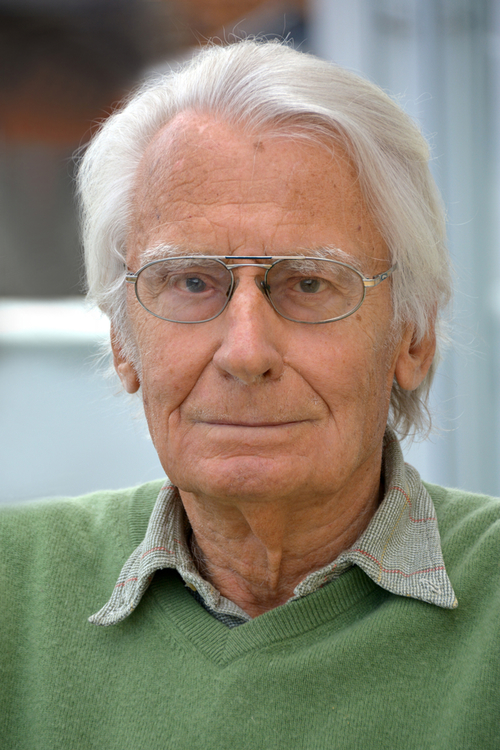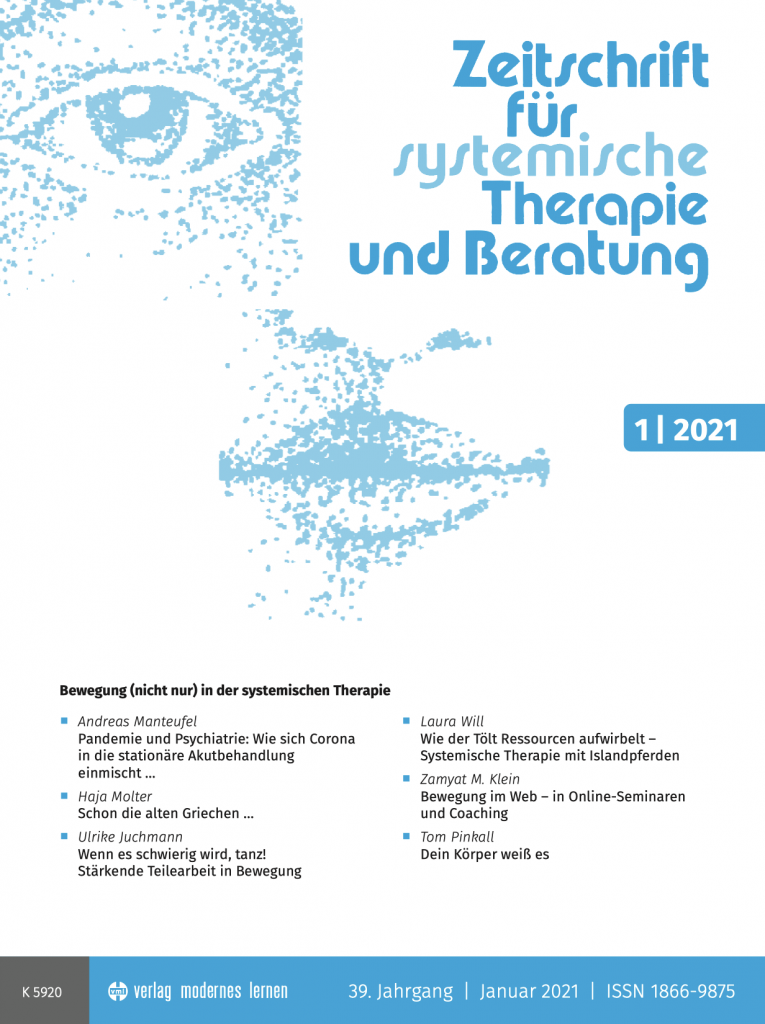Am 16. Februar ist Michael Scholz im Alter von 79 Jahren gestorben. Als langjähriger Direktor der Klinik und Poliklinik für Kinder- und
Jugendpsychiatrie in Dresden prägte die Entwicklung dieses Fachbereiches. Er war zudem hierzulande maßgeblich an der Verbreitung des Konzeptes der Multifamilientherapie beteiligt. Eia Asen, der dieses Konzept in England entwickelte, hat intensiv mit Michael Scholz zusammengearbeitet und einen Nachruf für systemagazin verfasst.
Eia Asen, London: Nachruf auf Michael Scholz
Familie war schon immer wichtig für Michael Scholz – und lange bevor er familientherapeutisch arbeitete. Und doch fing alles recht schwer an: während des 2. Weltkrieges in Berlin geboren, sah er seinen Vater nur einmal bevor dieser fiel. Seine Mutter zog ihn allein auf und floh kurz vor Kriegsende mit dem dreijährigen Kind nach Sachsen-Anhalt, wo beide zuerst allein und ein paar Jahre später bei Michaels Großeltern in Bernburg lebten. Dort lernte seine Mutter ihren zukünftigen Mann kennen, der Michaels (mehr oder weniger gleichaltrige) Stiefgeschwister mit in die Ehe brachte. So wurde seine Familie langsam immer grösser … Da Michaels Eltern nicht in der Partei waren, erhielt er erst einmal keinen Studienplatz in der DDR und machte so sein vorklinisches Medizinstudium in Bulgarien (Sofia) – und die Liebe zu diesem Land, seinen Menschen und seiner Kultur hielt lebenslang. Nach dem Physikum setzte er sein Studium in Leipzig fort, legte dort 1966 sein Staatsexamen ab und absolvierte dann nach und nach seine Psychiatrie- und Neurologie-Facharztausbildung.
Das Interesse an Familientherapie entstand schnell, obschon in der DDR diese Form von Psychotherapie wenig erwünscht war. Dennoch etablierte sich Michael Scholz als Leiter eines langjährigen Forschungsprojekts – „Familiendynamik bei psycho-sozial gestörten Kindern und Jugendlichen“ (1977-1990), 1980 war er Mitherausgeber des ersten familientherapeutischen Buches, das in der der DDR erschien. Nach der Wende und seiner Berufung zum Ordinarius an die Technische Universität Dresden (1994) als Professor für Kinder- und Jugendpsychiatrie wurde Systemische Familientherapie in seiner Klinik zum Grundstein aller klinischen Arbeit gemacht. Michaels wachsendes Interesse an der Multifamilientherapie führte1998 zur Gründung einer Familientagesklinik für Kinder und ihre Eltern; sie wurde schnell zu einem richtungsweisenden Prototyp und hat seitdem viele Kliniker in Deutschland beeinflusst und ermutigt, ähnliche Projekte aufzubauen. Die darauffolgende Einrichtung der Familientagesklinik für Essgestörte Jugendliche (1999) und das entstehende manualisierte Multifamilienarbeitsmodell hat entscheidend die nationale und internationale Behandlung der Anorexia nervosa inspiriert und gilt weiterhin als „Gold Standard“. Michaels zahlreiche Publikationen und Forschungsstudien, wie auch seine vielseitige Lehrtätigkeit, nicht nur in Deutschland, sondern Europa-weit, haben die Verbreitung der Multifamilientherapie und -arbeit maßgeblich gefördert – sowohl in klinischen Bereichen wie auch vor allem in der Jugendhilfe. Michaels mitreißender Enthusiasmus, die warme Ausstrahlung, seine außergewöhnlichen therapeutischen Fertigkeiten und vor allem seine Kollegialität und Freundschaft sind und bleiben unvergesslich. Seine inzwischen riesengroße Familie – 8 Kinder und eine Stieftochter aus 3 Ehen und 8 EnkelInnen, die ihn alle sehr liebevoll auf seinem letzten Weg seit vergangenem Sommer begleitet haben – wird ihn ebenso nie vergessen. Für ihn war und blieb Familie immer wichtiger als alles andere.