10. August 2006
von Tom Levold
Keine Kommentare
Andreas Reckwitz hat seit diesem Jahr eine Professur für Allgemeine Soziologie und Kultursoziologie an der Universität Konstanz. Auf seiner Website stellt er zahlreiche seiner Texte frei zur Verfügung. Ein empfehlenswerter Aufsatz befasst sich mit den Differenzen einer kulturtheoretisch fundierten Sozialtheorie und der Luhmannschen Theorie sozialer Systeme, die sich in Bezug auf eine heutige Lektüre gewissermaßen wechselseitig kontextualisieren:„Die Spezifika von Luhmanns Theorieprogramm werden deutlich, setzt man es genauer in Beziehung zu jenem disparaten Feld der Kulturtheorien, die einen Großteil der zeitgenössischen Theorielandschaft ausmachen. Umgekehrt zeichnen sich die Konturen des kulturtheoretischen Programmes schärfer ab, betrachtet man es vor der Hintergrundfolie der Luhmannschen Theorieoptionen“
Spannend ist vor allem, wie Reckwitz das normative Motiv der Trennung des Sozialen von allen anderen phänomenologischen Sphären bei Luhmann herausarbeitet, während die kulturtheoretisch orientierten Sozialtheorien sich gerade die Grenzüberschreitung zwischen diesen Sphären zum Programm gemacht haben:
„Während Luhmanns Theorie des Sozialen auf einer grundbegrifflichen Separierung von sozialen, psychischen, organischen und mechanischen Systemen, damit auf einer Situierung des Sozialen außerhalb der Körper, des Bewußtseins und der Artefakte basiert, ist für das ‚praxeologische‘ Denken der Kulturtheorien eine Situierung des Sozialen und der Kultur in den Bewußtseinen, Körpern und Artefakten, mithin eine Grenzüberschreitung zwischen dem Kulturell-Symbolischen und den scheinbar asozialen Sphären des Körpers, der Psyche und der Materialität zentral. Wo in Luhmanns Gesellschaftstheorie die Moderne ihre Einheit im Prinzip funktionaler Differenzierung, in den eindeutigen Grenzen zwischen Subsystemen findet, arbeiten die Kulturtheoretiker den konflikthaften, uneinheitlichen Charakter der Moderne angesichts verschiedener kultureller, historischer, klassenspezifischer und geographischer Logiken heraus: Auch hier torpedieren sie die Logik der Grenzerhaltung durch den Verweis auf eine Logik von Grenzüberschreitungen. Es wird sich herausstellen, daß die unterschiedlichen Theorieentscheidungen bei Niklas Luhmann und den Kulturtheoretikern von verschiedenen normativen Grundüberzeugungen motiviert sind, auch wenn die Autoren selbst ihre normativen Motive selten explizit offenlegen“
Der Aufsatz ist 2004 im von Günter Burkart herausgegebenen Sammelband„Niklas Luhmann und die Kulturtheorie“ bei Suhrkamp erschienen und hier online als PDF zu lesen.
 In einem neuen und aktuellen Beitrag für die Systemische Bibliothek befasst sich Cornelia Tsirigotis mit den besonderen besonderen Bedürfnissen von hörgeschädigten Kindern in Regelschulen für ihre psycho-soziale Entwicklung. Einer der wesentlichen Punkte ist der Prozess der »Identitätsarbeit«, die vielfältigen und widersprüchlichen Erfahrungen im Lebensfluss mit eigenen Bedürfnissen und Wünschen auszubalancieren. Wichtig für eine zufriedene psychosoziale Entwicklung ist die Unterstützung des Selbstwirksamkeitserlebens. Der Beitrag unterstreicht die Möglichkeiten sowohl von Lehrern wie von Eltern, hörgeschädigte Kinder dabei zu unterstützen, Erfahrungen von psychischer Stärke und Selbstwirksamkeitserleben zu machen.
In einem neuen und aktuellen Beitrag für die Systemische Bibliothek befasst sich Cornelia Tsirigotis mit den besonderen besonderen Bedürfnissen von hörgeschädigten Kindern in Regelschulen für ihre psycho-soziale Entwicklung. Einer der wesentlichen Punkte ist der Prozess der »Identitätsarbeit«, die vielfältigen und widersprüchlichen Erfahrungen im Lebensfluss mit eigenen Bedürfnissen und Wünschen auszubalancieren. Wichtig für eine zufriedene psychosoziale Entwicklung ist die Unterstützung des Selbstwirksamkeitserlebens. Der Beitrag unterstreicht die Möglichkeiten sowohl von Lehrern wie von Eltern, hörgeschädigte Kinder dabei zu unterstützen, Erfahrungen von psychischer Stärke und Selbstwirksamkeitserleben zu machen.
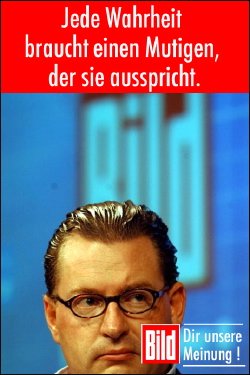
 Bei Vandenhoeck & Ruprecht sind zwei Kongressbände zur Tagung GRENZEN – Psychotherapie und Identität in Zeiten der Globalisierung erschienen, die im Sommer 2005 in Weimar stattfand – herausgegeben von Bernhard Strauß und Michael Geyer. Im vorliegenden Band sind den Herausgebern zufolge die Beiträge zusammengefasst, die sich mehr oder weniger direkt mit der Globalisierungsthematik befassen, der zweite Band (ebenfalls demnächst im systemagazin besprochen) gilt dem Thema der Grenzen psychotherapeutischen Handelns.
Bei Vandenhoeck & Ruprecht sind zwei Kongressbände zur Tagung GRENZEN – Psychotherapie und Identität in Zeiten der Globalisierung erschienen, die im Sommer 2005 in Weimar stattfand – herausgegeben von Bernhard Strauß und Michael Geyer. Im vorliegenden Band sind den Herausgebern zufolge die Beiträge zusammengefasst, die sich mehr oder weniger direkt mit der Globalisierungsthematik befassen, der zweite Band (ebenfalls demnächst im systemagazin besprochen) gilt dem Thema der Grenzen psychotherapeutischen Handelns.  Thomas Keller, Abteilungsarzt an den Rheinischen Kliniken Langenfeld und Lehrtherapeut der Systemischen Gesellschaft, fungiert nach 35 Berufsjahren in der„institutionalisierten Psychiatrie“ erneut als Gastherausgeber der Zeitschrift für Systemische Therapie und Beratung“ (ZSTB) zum Thema„Neuere Entwicklungen“ in der Psychiatrie. Unter anderem präsentiert er den letzten Artikel des im Februar 2004 bei einem Autounfall tödlich verunglückten Gianfranco Cecchin, den dieser gemeinsam mit Gerry Lane und Wendel A. Ray verfasst hat:„Exzentrizität und Intoleranz: Eine systemische Kritik“. Sein eigener Beitrag gilt der„Entfaltung systemischer Ideen und Arbeitsformen in der Praxis psychiatrischer Institutionen“, bei der vor allem dem Begriff der„Kooperation“ eine zentrale Bedeutung zukommt. Eine Autorengruppe um Jochen Schweitzer aus Heidelberg
Thomas Keller, Abteilungsarzt an den Rheinischen Kliniken Langenfeld und Lehrtherapeut der Systemischen Gesellschaft, fungiert nach 35 Berufsjahren in der„institutionalisierten Psychiatrie“ erneut als Gastherausgeber der Zeitschrift für Systemische Therapie und Beratung“ (ZSTB) zum Thema„Neuere Entwicklungen“ in der Psychiatrie. Unter anderem präsentiert er den letzten Artikel des im Februar 2004 bei einem Autounfall tödlich verunglückten Gianfranco Cecchin, den dieser gemeinsam mit Gerry Lane und Wendel A. Ray verfasst hat:„Exzentrizität und Intoleranz: Eine systemische Kritik“. Sein eigener Beitrag gilt der„Entfaltung systemischer Ideen und Arbeitsformen in der Praxis psychiatrischer Institutionen“, bei der vor allem dem Begriff der„Kooperation“ eine zentrale Bedeutung zukommt. Eine Autorengruppe um Jochen Schweitzer aus Heidelberg 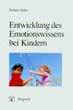 In einer Rezension des Forschungsberichtes von Bettina Janke schreibt Dieter Irblich:„Leider liefert das Buch keine Hinweise darauf, welchen Nutzen die Befunde für den Umgang mit Kindern, noch dazu im beraterischen und klinischen Kontext haben. Für die Praxis wäre es aber von besonderem Interesse, Hinweise zu erhalten, wie sich das Emotionswissen außerhalb fiktiver Ereignisse aktualisiert, also dann, wenn Kinder sich in realen, emotionsauslösenden Situationen befinden, und inwieweit tatsächliche Verhaltensweisen dadurch beeinflusst werden können. Sinnvoll erschiene auch, das hier referierte ,experimentelle‘ Emotionswissen in Beziehung zu setzen mit mehr oder weniger fachlich fundierten therapeutischen und beraterischen Interventionen bei Kindern und ihren Familien, die der Emotionsregulation und der Bewältigung belastender Erfahrungen dienen. Auch wenn anwendungsbezogene Aspekte in dem Buch von Janke keine Rolle spielen, ergeben sich hier doch einige Denkanstöße zur Reflexion praktischer Handlungskonzepte z. B. im Hinblick auf ängstliche Kinder oder Kinder mit aggressiven Verhaltensweisen“
In einer Rezension des Forschungsberichtes von Bettina Janke schreibt Dieter Irblich:„Leider liefert das Buch keine Hinweise darauf, welchen Nutzen die Befunde für den Umgang mit Kindern, noch dazu im beraterischen und klinischen Kontext haben. Für die Praxis wäre es aber von besonderem Interesse, Hinweise zu erhalten, wie sich das Emotionswissen außerhalb fiktiver Ereignisse aktualisiert, also dann, wenn Kinder sich in realen, emotionsauslösenden Situationen befinden, und inwieweit tatsächliche Verhaltensweisen dadurch beeinflusst werden können. Sinnvoll erschiene auch, das hier referierte ,experimentelle‘ Emotionswissen in Beziehung zu setzen mit mehr oder weniger fachlich fundierten therapeutischen und beraterischen Interventionen bei Kindern und ihren Familien, die der Emotionsregulation und der Bewältigung belastender Erfahrungen dienen. Auch wenn anwendungsbezogene Aspekte in dem Buch von Janke keine Rolle spielen, ergeben sich hier doch einige Denkanstöße zur Reflexion praktischer Handlungskonzepte z. B. im Hinblick auf ängstliche Kinder oder Kinder mit aggressiven Verhaltensweisen“
 In der Systemischen Bibliothek erscheint heute ein Aufsatz von Rudolf Klein aus dem Jahre 1998, in dem dieser anhand der Auseinandersetzung mit Familienaufstellungen Psychotherapie als Übergangsritual und (im Rückgriff auf Mircea Eliade) als Verbindungsmöglichkeit des Profanen mit dem Sakralen:„Oft wird die Unterscheidung sakral – profan mit der Differenz von real – irreal bzw. pseudoreal gleichgesetzt. Es handelt sich jedoch vielmehr um zwei Arten des In-der-Welt-Seins.
In der Systemischen Bibliothek erscheint heute ein Aufsatz von Rudolf Klein aus dem Jahre 1998, in dem dieser anhand der Auseinandersetzung mit Familienaufstellungen Psychotherapie als Übergangsritual und (im Rückgriff auf Mircea Eliade) als Verbindungsmöglichkeit des Profanen mit dem Sakralen:„Oft wird die Unterscheidung sakral – profan mit der Differenz von real – irreal bzw. pseudoreal gleichgesetzt. Es handelt sich jedoch vielmehr um zwei Arten des In-der-Welt-Seins.
 Die zweite Ausgabe von„perspektive mediation“ wartet mit einem interessanten Beitrag über Wirtschaftsmediaton im Jemen auf sowie mit einer Kontroverse über den Sinn einer„Ein-Parteien-Mediation“ zwischen Markus Murbach (pro) und Friedrich Glasl (contra). Im systemagazin sind nun auch die vergangenen Jahrgänge der Zeitschrift erfasst.
Die zweite Ausgabe von„perspektive mediation“ wartet mit einem interessanten Beitrag über Wirtschaftsmediaton im Jemen auf sowie mit einer Kontroverse über den Sinn einer„Ein-Parteien-Mediation“ zwischen Markus Murbach (pro) und Friedrich Glasl (contra). Im systemagazin sind nun auch die vergangenen Jahrgänge der Zeitschrift erfasst. Tom Levold stellt ein interessantes Buch von Davic Campbell und Marianne Marianne Grønbæk vor, in dem beide über ihre Arbeit mit einem Beratungstool berichten, den„semantischen Polaritäten“, eine Variante aus dem Bereich der Skalierungstechniken:„Wie bei allen Methoden, hängt auch bei diesem Modell der erfolgreiche Einsatz ganz vom umsichtigen und besonnenen Vorgehen der Berater ab, die ein ausreichendes Gefühl für den Kontext, gutes Timing und eine angemessene affektive Rahmung besitzen müssen. Wie die zahlreichen Fallbeispiele aus der Praxis beider Autoren zeigen, handelt es sich um ein außerordentlich breit einsetzbares Beratungs-Instrument mit minimalen technischen Voraussetzungen, dass in der Hand von erfahrenen Beratern schnell und effektiv zu kreativen Problemlösungen beitragen kann. Die scheinbare Simplizität dieses Tools täuscht allerdings leicht darüber hinweg, dass die zugrundeliegenden Fragestellungen erst einmal erfahren, verstanden und neu konzeptualisiert werden müssen“
Tom Levold stellt ein interessantes Buch von Davic Campbell und Marianne Marianne Grønbæk vor, in dem beide über ihre Arbeit mit einem Beratungstool berichten, den„semantischen Polaritäten“, eine Variante aus dem Bereich der Skalierungstechniken:„Wie bei allen Methoden, hängt auch bei diesem Modell der erfolgreiche Einsatz ganz vom umsichtigen und besonnenen Vorgehen der Berater ab, die ein ausreichendes Gefühl für den Kontext, gutes Timing und eine angemessene affektive Rahmung besitzen müssen. Wie die zahlreichen Fallbeispiele aus der Praxis beider Autoren zeigen, handelt es sich um ein außerordentlich breit einsetzbares Beratungs-Instrument mit minimalen technischen Voraussetzungen, dass in der Hand von erfahrenen Beratern schnell und effektiv zu kreativen Problemlösungen beitragen kann. Die scheinbare Simplizität dieses Tools täuscht allerdings leicht darüber hinweg, dass die zugrundeliegenden Fragestellungen erst einmal erfahren, verstanden und neu konzeptualisiert werden müssen“ Das Thema der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift OSC („Organisationsberatung, Supervision, Coaching“, im Foto leider noch die Ausgabe 01/06) ist dem Thema„Lernen im Coaching, Lernen fürs Coaching“ gewidmet. Interessant ist dabei ein kurzer Aufsatz von Altmeister Wolfgang Looss, in dem dieser als Alternative zum„problemorientierten Coaching“ für eine„anlassfreie Beratungsarbeit über längere Zeit“ plädiert:„Die Erfahrung, sich auch ohne akuten äußeren Problemdruck tastend, unsicher, fragend und zweifelnd erleben zu dürfen, wird von Klienten als extrem produktiv und schon deswegen kostbar beschrieben. Da es keine Not-Wendigkeit gibt, fehlt auch ein Ziel, man kann auf vorgedacht Anzustrebendes verzichten. Und erst dadurch wird es dem Klienten möglich, seine gewohnte Realität behutsam zu dekonstruieren und sich der ‚Krise im Container‘ auszusetzen, wie das in der Dialogarbeit heißt“ (123).
Das Thema der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift OSC („Organisationsberatung, Supervision, Coaching“, im Foto leider noch die Ausgabe 01/06) ist dem Thema„Lernen im Coaching, Lernen fürs Coaching“ gewidmet. Interessant ist dabei ein kurzer Aufsatz von Altmeister Wolfgang Looss, in dem dieser als Alternative zum„problemorientierten Coaching“ für eine„anlassfreie Beratungsarbeit über längere Zeit“ plädiert:„Die Erfahrung, sich auch ohne akuten äußeren Problemdruck tastend, unsicher, fragend und zweifelnd erleben zu dürfen, wird von Klienten als extrem produktiv und schon deswegen kostbar beschrieben. Da es keine Not-Wendigkeit gibt, fehlt auch ein Ziel, man kann auf vorgedacht Anzustrebendes verzichten. Und erst dadurch wird es dem Klienten möglich, seine gewohnte Realität behutsam zu dekonstruieren und sich der ‚Krise im Container‘ auszusetzen, wie das in der Dialogarbeit heißt“ (123). Wie ein Beitrag des französisch-amerikanischen Soziologen Loïc Wacquant
Wie ein Beitrag des französisch-amerikanischen Soziologen Loïc Wacquant