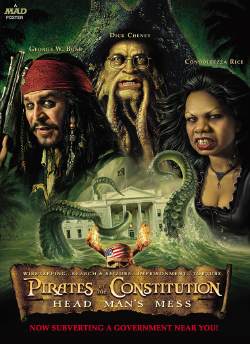14. Juli 2007
von Tom Levold
Keine Kommentare
 Reinhard Sieder ist Historiker und Kulturwissenschaftler an der Universität Wien. Bekannt geworden ist er durch seine zahlreichen Veröffentlichungen zur Sozialgeschichte der Familie, die in zahlreiche Sprachen übersetzt wurden. 2004 erschien im Verlag Turia + Kant eine Sammlung von Aufsätzen unter dem Titel„Die Rückkehr des Subjekts in den Kulturwissenschaften“, deren titelgebender Aufsatz auch online auf der Website von Reinhard Sieder zu lesen ist:
Reinhard Sieder ist Historiker und Kulturwissenschaftler an der Universität Wien. Bekannt geworden ist er durch seine zahlreichen Veröffentlichungen zur Sozialgeschichte der Familie, die in zahlreiche Sprachen übersetzt wurden. 2004 erschien im Verlag Turia + Kant eine Sammlung von Aufsätzen unter dem Titel„Die Rückkehr des Subjekts in den Kulturwissenschaften“, deren titelgebender Aufsatz auch online auf der Website von Reinhard Sieder zu lesen ist:  „Bedingung aller Humanwissenschaften ist es, auf die Fähigkeit des Menschen zu setzen, sich zu beobachten und Aussagen über sich selber zu treffen. Die Stringenz jeder Selbstbeobachtung ist durch den Mangel an Distanz eingeschränkt. In den Humanwissenschaften wird dieser Mangel zum theoretischen Problem und zur methodologischen Herausforderung. Systemtheorien versuchen deshalb, soziale Systeme und Kommunikationen ohne ihre Akteure und ohne empirischen Bezug auf deren Äußerungen zu konstruieren. Doch wo immer kognitive, emotionale und affektive Dimensionen menschlichen Handelns erfasst, verstanden und erklärt werden sollen, bilden Aussagen von Individuen über sich selbst unverzichtbare Evidenz: als Erzählungen, Beschreibungen, Urteile, Meinungen, Argumentationen etc., die in diversen Medien eingelagert sind und durch sie mitgeteilt werden, sei es in mündlichen Erzählungen, in autobiographischen Texten aller Art oder in Selbst-Inszenierungen in Bild und Film. Das Selbst ist keine fest gefügte Substanz, die sich sammeln und nach Farbe und Größe sortieren ließe wie Schmetterlinge, auch kein psychischer Kern in der Schale der Person, sondern eine immer prekäre Konstruktion jenes Subjekts, das über sich spricht. Wie sie zustande kommt und mit welchem Anspruch auf Gültigkeit sie analysiert werden kann, zählt zu den grundlegenden Fragen der Humanwissenschaften, sofern sie ihre wichtigste Möglichkeitsbedingung nicht im Dunklen der ungeprüften Voraussetzungen belassen wollen. Keineswegs nur biographisches und autobiographisches Schreiben, auch die struktural, strukturalistisch oder post-strukturalistisch vorgehenden Sozial- und Kulturwissenschaften bis hin zu ihren vorgeblich subjektfernsten Varianten setzen die Möglichkeit der Selbst-Besichtigung voraus. Um Konstruktion und Konstitution des historischen und prozedierenden Selbst soll es hier ganz im Sinn der vorangestellten Frage Foucaults in thesenhafter Form gehen“
„Bedingung aller Humanwissenschaften ist es, auf die Fähigkeit des Menschen zu setzen, sich zu beobachten und Aussagen über sich selber zu treffen. Die Stringenz jeder Selbstbeobachtung ist durch den Mangel an Distanz eingeschränkt. In den Humanwissenschaften wird dieser Mangel zum theoretischen Problem und zur methodologischen Herausforderung. Systemtheorien versuchen deshalb, soziale Systeme und Kommunikationen ohne ihre Akteure und ohne empirischen Bezug auf deren Äußerungen zu konstruieren. Doch wo immer kognitive, emotionale und affektive Dimensionen menschlichen Handelns erfasst, verstanden und erklärt werden sollen, bilden Aussagen von Individuen über sich selbst unverzichtbare Evidenz: als Erzählungen, Beschreibungen, Urteile, Meinungen, Argumentationen etc., die in diversen Medien eingelagert sind und durch sie mitgeteilt werden, sei es in mündlichen Erzählungen, in autobiographischen Texten aller Art oder in Selbst-Inszenierungen in Bild und Film. Das Selbst ist keine fest gefügte Substanz, die sich sammeln und nach Farbe und Größe sortieren ließe wie Schmetterlinge, auch kein psychischer Kern in der Schale der Person, sondern eine immer prekäre Konstruktion jenes Subjekts, das über sich spricht. Wie sie zustande kommt und mit welchem Anspruch auf Gültigkeit sie analysiert werden kann, zählt zu den grundlegenden Fragen der Humanwissenschaften, sofern sie ihre wichtigste Möglichkeitsbedingung nicht im Dunklen der ungeprüften Voraussetzungen belassen wollen. Keineswegs nur biographisches und autobiographisches Schreiben, auch die struktural, strukturalistisch oder post-strukturalistisch vorgehenden Sozial- und Kulturwissenschaften bis hin zu ihren vorgeblich subjektfernsten Varianten setzen die Möglichkeit der Selbst-Besichtigung voraus. Um Konstruktion und Konstitution des historischen und prozedierenden Selbst soll es hier ganz im Sinn der vorangestellten Frage Foucaults in thesenhafter Form gehen“
Zum vollständigen Text
 Das Augustheft des Journal of Family Therapy (JoFT) ist keinem besondern Thema gewidmet, sondern enthält ganz unterschiedliche Beiträge. Carmel Flaskas setzt sich mit der Balance von Hoffnung und Hoffnungslosigkeit in der Therapie auseinander. Susan Lord schreibt über die systemische Arbeit mit Klienten, die eine Borderline-Diagnose haben. Fiona Jones & Mary Morris erörtern die Frage, wie detailliert die Rekonstruktion eines sexuellen Missbrauchs in der Therapie mit traumatisierten Kindern sein sollte. Linnet Lee und Sophie Littlejohns stellen die Externalisierung als supervisorisches Instrument vor. Zwei weitere Artikel befassen sich mit gruppentherapeutischen Interventionen in der Arbeit mit alleinerziehenden Müttern sowie mit dem Thema interkultureller Familientherapie (im Zeitschriftenarchiv des systemagazin sind jetzt übrigens auch die bibliografischen Angaben der Jahrgänge 2004 und 2005 erfasst).
Das Augustheft des Journal of Family Therapy (JoFT) ist keinem besondern Thema gewidmet, sondern enthält ganz unterschiedliche Beiträge. Carmel Flaskas setzt sich mit der Balance von Hoffnung und Hoffnungslosigkeit in der Therapie auseinander. Susan Lord schreibt über die systemische Arbeit mit Klienten, die eine Borderline-Diagnose haben. Fiona Jones & Mary Morris erörtern die Frage, wie detailliert die Rekonstruktion eines sexuellen Missbrauchs in der Therapie mit traumatisierten Kindern sein sollte. Linnet Lee und Sophie Littlejohns stellen die Externalisierung als supervisorisches Instrument vor. Zwei weitere Artikel befassen sich mit gruppentherapeutischen Interventionen in der Arbeit mit alleinerziehenden Müttern sowie mit dem Thema interkultureller Familientherapie (im Zeitschriftenarchiv des systemagazin sind jetzt übrigens auch die bibliografischen Angaben der Jahrgänge 2004 und 2005 erfasst). 

 manipulieren. Gottschalks B-Probe wies Haribo-Goldbären-Werte auf, die alle bisher bekannt gewordenen Doping-Fälle mit Goldbären weit in den Schatten stellten. Gottschalk hat damit eine Wette mit Günter Jauch verloren, dass niemand hinter seinen Goldbärentrick kommen würde. Das ZDF distanzierte sich in einer Pressemitteilung von den Versuchen der TV-Stars, gute Laune mit illegalen Mitteln zu erreichen und wird an den kommenden Sendeterminen von Gottschalk und Kerner alte Folgen von„Aktenzeichen XY“ mit Eduard Zimmermann wiederholen,„bis der Bildschirm wieder sauber ist“. Die Sponsoren wiesen alle Vorwürfe zurück, die Medienpromis zum Doping angestiftet zu haben.
manipulieren. Gottschalks B-Probe wies Haribo-Goldbären-Werte auf, die alle bisher bekannt gewordenen Doping-Fälle mit Goldbären weit in den Schatten stellten. Gottschalk hat damit eine Wette mit Günter Jauch verloren, dass niemand hinter seinen Goldbärentrick kommen würde. Das ZDF distanzierte sich in einer Pressemitteilung von den Versuchen der TV-Stars, gute Laune mit illegalen Mitteln zu erreichen und wird an den kommenden Sendeterminen von Gottschalk und Kerner alte Folgen von„Aktenzeichen XY“ mit Eduard Zimmermann wiederholen,„bis der Bildschirm wieder sauber ist“. Die Sponsoren wiesen alle Vorwürfe zurück, die Medienpromis zum Doping angestiftet zu haben. 
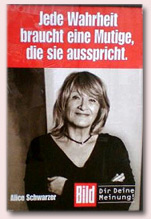

 In einem kürzlich erschienenen Interview setzt sich Schäuble gegen Vorwürfe aus den Reihen der Opposition, aber auch des Koalitionspartners SPD zur Wehr. Die Angriffe dienten dazu, die Öffentlichkeit bewusst in die Irre zu führen oder Denkverbote auszusprechen. «Beides ist unverantwortlich.» Die Kritik an seiner Arbeit ziele auf ihn als Menschen und Person, beklagte Schäuble und fügte hinzu:„Solche Angriffe gefährden die innere Sicherheit beträchtlich. Die Überwachung der Kommunikation meiner Gegner ist aus diesen Gründen lebensnotwendig. Wir müssen uns sogar überlegen, ob nicht schon der Tatbestand einer Verschwörung gegen den Bundesminister des Inneren vorliegt, was es erlauben würde, diese Kritiker vorbeugend zu internieren“ Dabei dürfe auch keine Ausnahme für den Koalitionspartner gemacht werden, betonte der Minister. Zwar halte er eine gezielte Tötung von Kritikern zum jetzigen Zeitpunkt noch für nicht erforderlich, grundsätzlich sehe er hier aber ein„rechtliches Problem auf uns zukommen“, das nach seiner Ansicht bald geklärt werden müsse. Die Bevölkerung müsse wissen, dass alle Maßnahmen fest auf dem Boden der Verfassung stünden, sobald diese geändert worden sei.
In einem kürzlich erschienenen Interview setzt sich Schäuble gegen Vorwürfe aus den Reihen der Opposition, aber auch des Koalitionspartners SPD zur Wehr. Die Angriffe dienten dazu, die Öffentlichkeit bewusst in die Irre zu führen oder Denkverbote auszusprechen. «Beides ist unverantwortlich.» Die Kritik an seiner Arbeit ziele auf ihn als Menschen und Person, beklagte Schäuble und fügte hinzu:„Solche Angriffe gefährden die innere Sicherheit beträchtlich. Die Überwachung der Kommunikation meiner Gegner ist aus diesen Gründen lebensnotwendig. Wir müssen uns sogar überlegen, ob nicht schon der Tatbestand einer Verschwörung gegen den Bundesminister des Inneren vorliegt, was es erlauben würde, diese Kritiker vorbeugend zu internieren“ Dabei dürfe auch keine Ausnahme für den Koalitionspartner gemacht werden, betonte der Minister. Zwar halte er eine gezielte Tötung von Kritikern zum jetzigen Zeitpunkt noch für nicht erforderlich, grundsätzlich sehe er hier aber ein„rechtliches Problem auf uns zukommen“, das nach seiner Ansicht bald geklärt werden müsse. Die Bevölkerung müsse wissen, dass alle Maßnahmen fest auf dem Boden der Verfassung stünden, sobald diese geändert worden sei.

 Reinhard Sieder ist Historiker und Kulturwissenschaftler an der Universität Wien. Bekannt geworden ist er durch seine zahlreichen Veröffentlichungen zur Sozialgeschichte der Familie, die in zahlreiche Sprachen übersetzt wurden. 2004 erschien im
Reinhard Sieder ist Historiker und Kulturwissenschaftler an der Universität Wien. Bekannt geworden ist er durch seine zahlreichen Veröffentlichungen zur Sozialgeschichte der Familie, die in zahlreiche Sprachen übersetzt wurden. 2004 erschien im