21. Februar 2008
von Tom Levold
Keine Kommentare
 Ludwig Reiter habe ich auf dem Zürcher Kongress 1981 kennengelernt, ganz am Rande der Tagung übrigens, beim Abendessen auf dem Zürichberg, wo das Kongressfest stattfand. Christa Hoffmann-zur Verth und Eberhard Künzel, PsychoanalytikerInnen und meine damaligen Lehrer und familientherapeutischen Teamkollegen, kannten ihn von gruppenanalytischen Seminaren und machten uns miteinander bekannt. Ich war blutiger Anfänger im familientherapeutischen Feld und konnte viele namhafte Kolleginnen und Kollegen erstmals aus der Nähe beobachten, ohne das Gefühl, selbst etwas beisteuern zu können. Gerade deswegen erinnere ich mich an ein interessantes Gespräch mit Ludwig Reiter über meine soziologische Herkunft und Perspektive – ich hatte in den 70er Jahren meine Diplom-Arbeit über Niklas Luhmann geschrieben. Von da an habe ich aufmerksam verfolgt, was Ludwig Reiter veröffentlichte – jedenfalls das, was in den deutschsprachigen Fachzeitschriften und einschlägigen Buchpublikationen zu lesen war. Und das war gewiss nicht wenig. Überrascht und erfreut war ich später, als ich bemerkte, dass auch er meine vorsichtigen publizistischen Aktivitäten registrierte, mit denen ich mich Mitte bis Ende der 80er Jahre in die Öffentlichkeit wagte. Er hatte Interesse an meinen Arbeiten über„Gewaltfamilien“, Zwangskontexte und Hilfesysteme und wir freuten uns, wenn wir uns bei Tagungen trafen, nutzten manchmal die Gelegenheit, um miteinander essen zu gehen, korrespondierten gelegentlich (bis heute) und hielten uns auf dem Laufenden, wenngleich immer mit einem gewissen Abstand, der wohl für ihn typisch ist. Als er für mich einen Vortrag in Wien über meine Kinderschutz-Arbeit organisierte, lud er mich anschließend zu einem Besuch in das Institut für Ehe- und Familientherapie in der Praterstraße ein, wo ich einige Mitglieder seines Teams (und der ÖAS) kennenlernte, mit denen ich auch heute noch freundschaftlich sehr verbunden bin. Ich habe sehr viel von Ludwig Reiter gelernt, vor allem durch Lektüre: es gibt wohl wenige Menschen mit einem solch breiten klinischen, theoretischen und praxeologischen Horizont, einer solchen Leselust und Belesenheit. Ihm verdanke ich den Zugang zu zahlreichen (eben auch internationalen) Quellen, die ich mir sonst wohl kaum erschlossen hätte. Mit zahlreichen Beiträgen haben er und seine MitarbeiterInnen ganz wesentlich zu der Weiterentwicklung„Von der Familientherapie zur Systemischen Perspektive“ beigetragen (u.a. auch durch den Sammelband mit diesem Titel). 1998 hat er sich gänzlich aus der beruflichen Arbeit zurückgezogen, wofür nicht nur gesundheitliche Gründe eine Rolle spielten und der Wunsch, sich stärker der Familie und den Künsten zu widmen, sondern auch die Tatsache, dass seine Beiträge – nicht nur in der akademischen Welt – nicht immer die Würdigung erfuhren, die ihrer Bedeutung angemessen gewesen wären: eine schon sicher erscheinende Professur in Deutschland wurde ihm unter bis heute nicht transparenten Umständen versagt. Diese Enttäuschungen leicht zu nehmen, war nicht seine Art, was wiederum in der Folge auch zu manchen Enttäuschungen und Irritationen in der systemischen Szene geführt haben mag. Leicht war der Umgang mit ihm nicht immer, da man selten wusste, was ihn wirklich bewegte. Die Ausnahmen bleiben umso besser im Gedächtnis.
Ludwig Reiter habe ich auf dem Zürcher Kongress 1981 kennengelernt, ganz am Rande der Tagung übrigens, beim Abendessen auf dem Zürichberg, wo das Kongressfest stattfand. Christa Hoffmann-zur Verth und Eberhard Künzel, PsychoanalytikerInnen und meine damaligen Lehrer und familientherapeutischen Teamkollegen, kannten ihn von gruppenanalytischen Seminaren und machten uns miteinander bekannt. Ich war blutiger Anfänger im familientherapeutischen Feld und konnte viele namhafte Kolleginnen und Kollegen erstmals aus der Nähe beobachten, ohne das Gefühl, selbst etwas beisteuern zu können. Gerade deswegen erinnere ich mich an ein interessantes Gespräch mit Ludwig Reiter über meine soziologische Herkunft und Perspektive – ich hatte in den 70er Jahren meine Diplom-Arbeit über Niklas Luhmann geschrieben. Von da an habe ich aufmerksam verfolgt, was Ludwig Reiter veröffentlichte – jedenfalls das, was in den deutschsprachigen Fachzeitschriften und einschlägigen Buchpublikationen zu lesen war. Und das war gewiss nicht wenig. Überrascht und erfreut war ich später, als ich bemerkte, dass auch er meine vorsichtigen publizistischen Aktivitäten registrierte, mit denen ich mich Mitte bis Ende der 80er Jahre in die Öffentlichkeit wagte. Er hatte Interesse an meinen Arbeiten über„Gewaltfamilien“, Zwangskontexte und Hilfesysteme und wir freuten uns, wenn wir uns bei Tagungen trafen, nutzten manchmal die Gelegenheit, um miteinander essen zu gehen, korrespondierten gelegentlich (bis heute) und hielten uns auf dem Laufenden, wenngleich immer mit einem gewissen Abstand, der wohl für ihn typisch ist. Als er für mich einen Vortrag in Wien über meine Kinderschutz-Arbeit organisierte, lud er mich anschließend zu einem Besuch in das Institut für Ehe- und Familientherapie in der Praterstraße ein, wo ich einige Mitglieder seines Teams (und der ÖAS) kennenlernte, mit denen ich auch heute noch freundschaftlich sehr verbunden bin. Ich habe sehr viel von Ludwig Reiter gelernt, vor allem durch Lektüre: es gibt wohl wenige Menschen mit einem solch breiten klinischen, theoretischen und praxeologischen Horizont, einer solchen Leselust und Belesenheit. Ihm verdanke ich den Zugang zu zahlreichen (eben auch internationalen) Quellen, die ich mir sonst wohl kaum erschlossen hätte. Mit zahlreichen Beiträgen haben er und seine MitarbeiterInnen ganz wesentlich zu der Weiterentwicklung„Von der Familientherapie zur Systemischen Perspektive“ beigetragen (u.a. auch durch den Sammelband mit diesem Titel). 1998 hat er sich gänzlich aus der beruflichen Arbeit zurückgezogen, wofür nicht nur gesundheitliche Gründe eine Rolle spielten und der Wunsch, sich stärker der Familie und den Künsten zu widmen, sondern auch die Tatsache, dass seine Beiträge – nicht nur in der akademischen Welt – nicht immer die Würdigung erfuhren, die ihrer Bedeutung angemessen gewesen wären: eine schon sicher erscheinende Professur in Deutschland wurde ihm unter bis heute nicht transparenten Umständen versagt. Diese Enttäuschungen leicht zu nehmen, war nicht seine Art, was wiederum in der Folge auch zu manchen Enttäuschungen und Irritationen in der systemischen Szene geführt haben mag. Leicht war der Umgang mit ihm nicht immer, da man selten wusste, was ihn wirklich bewegte. Die Ausnahmen bleiben umso besser im Gedächtnis.
Wie auch immer, Ludwig Reiter ist und bleibt ein Pionier der ersten Stunde der Familientherapie in der deutschsprachigen Region (er war Mitbegründer der 1971 gegründeten legendären„Internationalen Arbeitsgemeinschaft für Familienforschung und Familientherapie AGF), der den Wandel von einem psychoanalytischen Paradigma hin zu einem systemtheoretisch fundierten Therapieansatz nicht nur gefördert, sondern auch selbst konsequent betrieben hat, ohne seine Wurzeln in der Psychoanalyse und seine schulenübergreifenden Kenntnisse zu verleugnen. Sein Beitrag für die Geschichte der Systemischen Therapie dürfte heute weithin unterschätzt sein, was sich in Zukunft hoffentlich noch einmal ändern wird.
Zu seinem Geburtstag, den er – der nicht mehr gut reisen kann – zuhause im Südschwarzwald verbringt, sei ihm herzlich an dieser Stelle gratuliert. Zu seinen Ehren bringt systemagazin in der Systemischen Bibliothek eine ausführliche Würdigung Ludwig Reiters von Kurt Ludewig, die dieser vor 10 Jahren, also 1998, anlässlich des beruflichen Abschiedes von Ludwig Reiter verfasste, die aber heute nicht weniger aktuell ist, sowie einen Aufsatz von Egbert Steiner (der mit Ludwig Reiter zahlreiche bedeutsame theoretische Texte verfasst hat) und Ludwig Reiter von 1986 über das„Verhältnis von Individuum und sozialem System“ aus der Zeitschrift„Familiendynamik“, in dem die Autoren als eine der ersten für eine Übernahme des Luhmann’schen Konzeptes sozialer Systeme in die theoretische Konzeption systemischer Therapie plädieren.

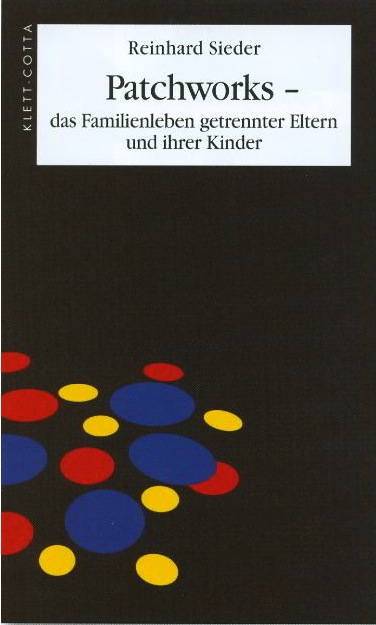

 Dass sich der Radikale Konstruktivismus keinem theoretischen Urknall verdankt, sondern sich ideengeschichtlich weit zurückverfolgen lässt, dürfte klar sein. Stefan Schweizer hat 2007 die philosophischen Wurzeln des Konstruktivismus bis in den deutschen Idealismus hinein (Kant, Fichte und Schelling) in einem Beitrag für die elektronische Zeitschrift„Electroneurobiología“ verfolgt:„Diese historisch-genetische
Dass sich der Radikale Konstruktivismus keinem theoretischen Urknall verdankt, sondern sich ideengeschichtlich weit zurückverfolgen lässt, dürfte klar sein. Stefan Schweizer hat 2007 die philosophischen Wurzeln des Konstruktivismus bis in den deutschen Idealismus hinein (Kant, Fichte und Schelling) in einem Beitrag für die elektronische Zeitschrift„Electroneurobiología“ verfolgt:„Diese historisch-genetische 

 Heute feiert in Meilen bei Zürich Rosmarie Welter-Enderlin ihren Geburtstag. Dazu sei ihr von dieser Stelle mit ganzem Herzen gratuliert! Aus gegebenem Anlass erscheint im systemagazin die Rezensionen von Tom Levold und Rudolf Sanders über ihr jüngstes Buches im Carl-Auer-Verlag, die„Einführung in die systemische Paartherapie“ am heutigen Tage: Tom Levold:„Während der Lektüre wird einem deutlich, dass es hier zwar immer um Paartherapie geht, aber immer auch noch um etwas mehr, nämlich um den Themenzyklus, für den die Person von
Heute feiert in Meilen bei Zürich Rosmarie Welter-Enderlin ihren Geburtstag. Dazu sei ihr von dieser Stelle mit ganzem Herzen gratuliert! Aus gegebenem Anlass erscheint im systemagazin die Rezensionen von Tom Levold und Rudolf Sanders über ihr jüngstes Buches im Carl-Auer-Verlag, die„Einführung in die systemische Paartherapie“ am heutigen Tage: Tom Levold:„Während der Lektüre wird einem deutlich, dass es hier zwar immer um Paartherapie geht, aber immer auch noch um etwas mehr, nämlich um den Themenzyklus, für den die Person von 

 Ludwig Reiter habe ich auf dem Zürcher Kongress 1981 kennengelernt, ganz am Rande der Tagung übrigens, beim Abendessen auf dem Zürichberg, wo das Kongressfest stattfand. Christa Hoffmann-zur Verth und Eberhard Künzel, PsychoanalytikerInnen und meine damaligen Lehrer und familientherapeutischen Teamkollegen, kannten ihn von gruppenanalytischen Seminaren und machten uns miteinander bekannt. Ich war blutiger Anfänger im familientherapeutischen Feld und konnte viele namhafte Kolleginnen und Kollegen erstmals aus der Nähe beobachten, ohne das Gefühl, selbst etwas beisteuern zu können. Gerade deswegen erinnere ich mich an ein interessantes Gespräch mit Ludwig Reiter über meine soziologische Herkunft und Perspektive – ich hatte in den 70er Jahren meine Diplom-Arbeit über Niklas Luhmann geschrieben. Von da an habe ich aufmerksam verfolgt, was Ludwig Reiter veröffentlichte – jedenfalls das, was in den deutschsprachigen Fachzeitschriften und einschlägigen Buchpublikationen zu lesen war. Und das war gewiss nicht wenig. Überrascht und erfreut war ich später, als ich bemerkte, dass auch er meine vorsichtigen publizistischen Aktivitäten registrierte, mit denen ich mich Mitte bis Ende der 80er Jahre in die Öffentlichkeit wagte. Er hatte Interesse an meinen Arbeiten über„Gewaltfamilien“, Zwangskontexte und Hilfesysteme und wir freuten uns, wenn wir uns bei Tagungen trafen, nutzten manchmal die Gelegenheit, um miteinander essen zu gehen, korrespondierten gelegentlich (bis heute) und hielten uns auf dem Laufenden, wenngleich immer mit einem gewissen Abstand, der wohl für ihn typisch ist. Als er für mich einen Vortrag in Wien über meine Kinderschutz-Arbeit organisierte, lud er mich anschließend zu einem Besuch in das Institut für Ehe- und Familientherapie in der Praterstraße ein, wo ich einige Mitglieder seines Teams (und der ÖAS) kennenlernte, mit denen ich auch heute noch freundschaftlich sehr verbunden bin. Ich habe sehr viel von Ludwig Reiter gelernt, vor allem durch Lektüre: es gibt wohl wenige Menschen mit einem solch breiten klinischen, theoretischen und praxeologischen Horizont, einer solchen Leselust und Belesenheit. Ihm verdanke ich den Zugang zu zahlreichen (eben auch internationalen) Quellen, die ich mir sonst wohl kaum erschlossen hätte. Mit zahlreichen Beiträgen haben er und seine MitarbeiterInnen ganz wesentlich zu der Weiterentwicklung„Von der Familientherapie zur Systemischen Perspektive“ beigetragen (u.a. auch durch den Sammelband mit diesem Titel). 1998 hat er sich gänzlich aus der beruflichen Arbeit zurückgezogen, wofür nicht nur gesundheitliche Gründe eine Rolle spielten und der Wunsch, sich stärker der Familie und den Künsten zu widmen, sondern auch die Tatsache, dass seine Beiträge – nicht nur in der akademischen Welt – nicht immer die Würdigung erfuhren, die ihrer Bedeutung angemessen gewesen wären: eine schon sicher erscheinende Professur in Deutschland wurde ihm unter bis heute nicht transparenten Umständen versagt. Diese Enttäuschungen leicht zu nehmen, war nicht seine Art, was wiederum in der Folge auch zu manchen Enttäuschungen und Irritationen in der systemischen Szene geführt haben mag. Leicht war der Umgang mit ihm nicht immer, da man selten wusste, was ihn wirklich bewegte. Die Ausnahmen bleiben umso besser im Gedächtnis.
Ludwig Reiter habe ich auf dem Zürcher Kongress 1981 kennengelernt, ganz am Rande der Tagung übrigens, beim Abendessen auf dem Zürichberg, wo das Kongressfest stattfand. Christa Hoffmann-zur Verth und Eberhard Künzel, PsychoanalytikerInnen und meine damaligen Lehrer und familientherapeutischen Teamkollegen, kannten ihn von gruppenanalytischen Seminaren und machten uns miteinander bekannt. Ich war blutiger Anfänger im familientherapeutischen Feld und konnte viele namhafte Kolleginnen und Kollegen erstmals aus der Nähe beobachten, ohne das Gefühl, selbst etwas beisteuern zu können. Gerade deswegen erinnere ich mich an ein interessantes Gespräch mit Ludwig Reiter über meine soziologische Herkunft und Perspektive – ich hatte in den 70er Jahren meine Diplom-Arbeit über Niklas Luhmann geschrieben. Von da an habe ich aufmerksam verfolgt, was Ludwig Reiter veröffentlichte – jedenfalls das, was in den deutschsprachigen Fachzeitschriften und einschlägigen Buchpublikationen zu lesen war. Und das war gewiss nicht wenig. Überrascht und erfreut war ich später, als ich bemerkte, dass auch er meine vorsichtigen publizistischen Aktivitäten registrierte, mit denen ich mich Mitte bis Ende der 80er Jahre in die Öffentlichkeit wagte. Er hatte Interesse an meinen Arbeiten über„Gewaltfamilien“, Zwangskontexte und Hilfesysteme und wir freuten uns, wenn wir uns bei Tagungen trafen, nutzten manchmal die Gelegenheit, um miteinander essen zu gehen, korrespondierten gelegentlich (bis heute) und hielten uns auf dem Laufenden, wenngleich immer mit einem gewissen Abstand, der wohl für ihn typisch ist. Als er für mich einen Vortrag in Wien über meine Kinderschutz-Arbeit organisierte, lud er mich anschließend zu einem Besuch in das Institut für Ehe- und Familientherapie in der Praterstraße ein, wo ich einige Mitglieder seines Teams (und der ÖAS) kennenlernte, mit denen ich auch heute noch freundschaftlich sehr verbunden bin. Ich habe sehr viel von Ludwig Reiter gelernt, vor allem durch Lektüre: es gibt wohl wenige Menschen mit einem solch breiten klinischen, theoretischen und praxeologischen Horizont, einer solchen Leselust und Belesenheit. Ihm verdanke ich den Zugang zu zahlreichen (eben auch internationalen) Quellen, die ich mir sonst wohl kaum erschlossen hätte. Mit zahlreichen Beiträgen haben er und seine MitarbeiterInnen ganz wesentlich zu der Weiterentwicklung„Von der Familientherapie zur Systemischen Perspektive“ beigetragen (u.a. auch durch den Sammelband mit diesem Titel). 1998 hat er sich gänzlich aus der beruflichen Arbeit zurückgezogen, wofür nicht nur gesundheitliche Gründe eine Rolle spielten und der Wunsch, sich stärker der Familie und den Künsten zu widmen, sondern auch die Tatsache, dass seine Beiträge – nicht nur in der akademischen Welt – nicht immer die Würdigung erfuhren, die ihrer Bedeutung angemessen gewesen wären: eine schon sicher erscheinende Professur in Deutschland wurde ihm unter bis heute nicht transparenten Umständen versagt. Diese Enttäuschungen leicht zu nehmen, war nicht seine Art, was wiederum in der Folge auch zu manchen Enttäuschungen und Irritationen in der systemischen Szene geführt haben mag. Leicht war der Umgang mit ihm nicht immer, da man selten wusste, was ihn wirklich bewegte. Die Ausnahmen bleiben umso besser im Gedächtnis.


 Das erste Heft des neuen Jahrgang des britischen Journals of Family Therapy präsentiert Beiträge über lösungsorientierte Ansätze u.a. in der Arbeit mit Familien mit intellektuell stark beeinträchtigten Kindern sowie mit Fällen familialer Gewalt. Darüberhinaus befasst sich ein Aufsatz mit den Bemühungen, paartherapeutische Angebote auch für Canadian First Nations couples, also Angehörige indianischer Völker in Kanada, zugänglich zu machen. Zwei weitere Forschungbeiträge sind den Themen der Bedeutung„romantischer Bindung“ für die Beziehungszufriedenheit sowie dem Stellenwert von Eltern-Eltern-Konsultation in familientherapeutischen Behandlungsprogrammen von Magersucht gewidmet. Herausgeber Ivan Eisler macht sich in seinem ausführlichen Editorial Gedanken, wie die Stimme der Familientherapie (was hier auch als Synonym für Systemische Therapie gelesen werden kann) gestärkt werden könne. Er beklagt, dass zahlreiche erfahrene Familientherapeuten im Publikationsbereich nur wenig präsent sind, weil ihnen die (universitären) Möglichkeiten des Forschens und Schreibens nicht ohne weiteres gegeben sind. Andererseits gäbe es zahlreiche Arbeiten junger AutorInnen (meistens Dissertationen), die nicht ohne weiteres im familientherapeutischen Diskurs wahrgenommen würden. Eisler schlägt daher vor, das Prinzip der Ko-Autorenschaft ernster zu nehmen als Beitrag für eine Erweiterung der familientherapeutischen Publikationsöffentlichkeit:„We teach trainees how to express their ideas clearly in writing, but the next step, helping them to publish, is somehow missing. By far the best way of learning such skills is to start writing with an experienced published author. If a trainee completes work that is worth publishing, the best way of helping that to happen is to become a co-author. This does not mean simply adding ones name to a paper written by the student but requires taking an active part in developing the ideas for the paper so that it is suitable for publication, helping to redraft early versions and so on. I find it strange that that this seldom happens in family therapy contexts (although it is the norm in many other fields such as clinical psychology). I have heard people express their concern that this would be encroaching on the students authorship rights. Both students and teachers/supervisors should recognize that inviting a senior colleague(s) to co-author a paper is a recognition that they have probably had a significant role in developing the ideas already and that reshaping the student work for publication nearly always needs someone who is able to step back and give it a fresh focus. The issue of acknowledging the central contribution of the student is of course important but is dealt with by there being a clear expectation that the student will normally be the first author of any such joint publication (
). The co-authoring of papers is not just an effective way of increasing the chance of good work getting published. It is also an important way of marking the change from a student/teacher relationship to a collaborative colleague relationship which is crucial in encouraging newly qualified family therapists in pursuing academic interests“ Vielleicht wäre das auch eine spannende Perspektive für unsere deutsche Publikationsöffentlichkeit?
Das erste Heft des neuen Jahrgang des britischen Journals of Family Therapy präsentiert Beiträge über lösungsorientierte Ansätze u.a. in der Arbeit mit Familien mit intellektuell stark beeinträchtigten Kindern sowie mit Fällen familialer Gewalt. Darüberhinaus befasst sich ein Aufsatz mit den Bemühungen, paartherapeutische Angebote auch für Canadian First Nations couples, also Angehörige indianischer Völker in Kanada, zugänglich zu machen. Zwei weitere Forschungbeiträge sind den Themen der Bedeutung„romantischer Bindung“ für die Beziehungszufriedenheit sowie dem Stellenwert von Eltern-Eltern-Konsultation in familientherapeutischen Behandlungsprogrammen von Magersucht gewidmet. Herausgeber Ivan Eisler macht sich in seinem ausführlichen Editorial Gedanken, wie die Stimme der Familientherapie (was hier auch als Synonym für Systemische Therapie gelesen werden kann) gestärkt werden könne. Er beklagt, dass zahlreiche erfahrene Familientherapeuten im Publikationsbereich nur wenig präsent sind, weil ihnen die (universitären) Möglichkeiten des Forschens und Schreibens nicht ohne weiteres gegeben sind. Andererseits gäbe es zahlreiche Arbeiten junger AutorInnen (meistens Dissertationen), die nicht ohne weiteres im familientherapeutischen Diskurs wahrgenommen würden. Eisler schlägt daher vor, das Prinzip der Ko-Autorenschaft ernster zu nehmen als Beitrag für eine Erweiterung der familientherapeutischen Publikationsöffentlichkeit:„We teach trainees how to express their ideas clearly in writing, but the next step, helping them to publish, is somehow missing. By far the best way of learning such skills is to start writing with an experienced published author. If a trainee completes work that is worth publishing, the best way of helping that to happen is to become a co-author. This does not mean simply adding ones name to a paper written by the student but requires taking an active part in developing the ideas for the paper so that it is suitable for publication, helping to redraft early versions and so on. I find it strange that that this seldom happens in family therapy contexts (although it is the norm in many other fields such as clinical psychology). I have heard people express their concern that this would be encroaching on the students authorship rights. Both students and teachers/supervisors should recognize that inviting a senior colleague(s) to co-author a paper is a recognition that they have probably had a significant role in developing the ideas already and that reshaping the student work for publication nearly always needs someone who is able to step back and give it a fresh focus. The issue of acknowledging the central contribution of the student is of course important but is dealt with by there being a clear expectation that the student will normally be the first author of any such joint publication (
). The co-authoring of papers is not just an effective way of increasing the chance of good work getting published. It is also an important way of marking the change from a student/teacher relationship to a collaborative colleague relationship which is crucial in encouraging newly qualified family therapists in pursuing academic interests“ Vielleicht wäre das auch eine spannende Perspektive für unsere deutsche Publikationsöffentlichkeit?