24. März 2008
von Tom Levold
Keine Kommentare
Annette Ziegler aus Wien hat im Jahre 2004 eine schöne Diplom-Arbeit über„Metaphern im Schizophrenie-Diskurs Betroffener und Angehöriger“ geschrieben, die nun auch online zu lesen ist. Es handelt sich dabei nicht nur um eine kundige Einführung in die Metapherntheorie der kognitiven Linguistik nach Lakoff und Johnson, sondern auch um eine beeindruckende empirische Studie über die Metaphern, mithilfe derer Bilder und Metaphern erschlossen werden, die den„Alltagsdiskurs schizophrenie-erfahrener Menschen implizit anleiten“. Die Arbeit ist umfangreich und ausgesprochen lesenswert:„Als Datenmaterial für die Metaphernanalyse dienten natürliche Daten – in Büchern und Zeitschriften veröffentlichte Erfahrungsberichte von Schizophrenie-Beteiligten; analysiert wurden 37 Textdokumente Betroffener und 25 Erfahrungsberichte von Angehörigen.
Im Ergebnisteil wird zunächst das Metaphernspektrum Betroffener detailliert beschrieben. Es zeigt sich, dass die rekonstruierten Metaphern die zentralen inhaltlichen Dimensionen der Schizophrenie das sind Beschreibungen der Schizophrenie selbst, Charakterisierungen der schizophrenen Person, Vorstellungen über hilfreiche Umgangsweisen, Sinnzuschreibungen und Ursachenvorstellungen jeweils in einem Bild zu verbinden vermögen. Die dargestellten metaphorisch strukturierten Handlungs- und Lösungserwartungen werden insbesondere dann relevant, wenn es um die Implementierung passender Behandlungsangebote geht. Etwa erfordert ein Kriegszustand Kampfgeist, Mitstreiter, Verbündete, Durchhaltewillen wer Schizophrenie als Irrweg bebildert, braucht Anhaltspunkte, Wegweiser, Begleiter etc.
In einem zweiten Analyseschritt wird auf der Grundlage einer Häufigkeitenanalyse der identifizierten Metaphernfelder die Metaphorisierungspraxis Betroffener und Angehöriger verglichen. Zentrale Be-deutung in den Texten beider Subgruppen kommt solchen metaphorischen Konzepten zu, die Betroffene und Angehörige als ausgelieferte Opfer unausweichlicher und beängstigender Vorgänge mit wenig Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten konstituieren.
Die beiden wichtigsten metaphorischen Modelle sind im Betroffenen- wie im Angehörigendiskurs die Weg- und die Behälter-Metapher. Beide lassen Schizophrenie als Zustand der Abweichung von wichtigen gesellschaftlich und kulturell geteilten Werten und Normen erscheinen: Im Lichte der Weg-Metapher sind schizophrene Symptome als Komplementärerscheinungen zum gesellschaftlichen Ideal des immer weiter und immer schneller zu verstehen – die Behälter-Metapher kennzeichnet Schizophrenie als einen Zustand, in dem sich die für unser westliches Subjekt-Verständnis fundamentalste Konstante, die Trennung zwischen Subjekt und Objekt, Innen und Außen, aufzulösen beginnt.
Unterschiede zwischen den Sprechergruppen zeigen sich v.a. in Bezug auf die Verortung der Schizophrenie. Angehörige tendieren dazu, die Schizophrenie in der als Behälter gedachten Person zu platzieren. Bei Betroffenen finden sich demgegenüber zahlreiche Metaphern, die die Schizophrenie externalisieren und sie als von der eigenen Person klar getrennten Gegenstand, als von außen kommende bzw. in Gang gesetzte Dynamik erscheinen lassen“
Zum Volltext der Diplomarbeit

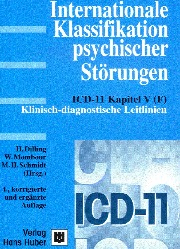 systemagazin ist von interessierter Seite ein internes Arbeitspapier der„Arbeitsgruppe Aktualisierung der Internationalen Klassifikation psychischer Störungen – ICD 11″ zugespielt worden, die als Zusammenschluss forschender Psychiater und Psychotherapeuten aus dem Bereich namhafter Verbände, Institute und Kliniken mit Schwerpunkt auf dem Gebiet der deutschsprachigen Sozialpsychiatrie damit befasst ist, Vorschläge für eine Aktualisierung des derzeitig gültigen ICD-10-Kataloges zu entwickeln. Die vorliegende, vertrauliche Passage gilt der Einführung einer neuen umschriebenen Störungskategorie im Bereich der bereits bekannten spezifischen Persönlichkeitsstörungen sowie anderen Persönlichkeitsstörungen und anhaltenden Persönlichkeitsänderungen. Diese Kategorien werden im bisherigen ICD-10-Katalog unter den Ziffern F60 F62 beschrieben und katalogisiert. Die neu zu katalogisierende Störung soll mit ICD 11 F 62.2 – andauernde Persönlichkeitsstörung nach tief greifender sozioökonomischer Belastung Ökonomisierungswahn überschrieben werden. Da in den letzten Monaten auch im systemagazin eine heftige Debatte um das„Störungsspezifische Wissen“ in der systemischen Therapie zu verzeichnen war, sind alle Leserinnen und Leser herzlich eingeladen, ihre Meinungen und Kommentare über die Einführung dieser neuen Diagnose an dieser Stelle beizusteuern.
systemagazin ist von interessierter Seite ein internes Arbeitspapier der„Arbeitsgruppe Aktualisierung der Internationalen Klassifikation psychischer Störungen – ICD 11″ zugespielt worden, die als Zusammenschluss forschender Psychiater und Psychotherapeuten aus dem Bereich namhafter Verbände, Institute und Kliniken mit Schwerpunkt auf dem Gebiet der deutschsprachigen Sozialpsychiatrie damit befasst ist, Vorschläge für eine Aktualisierung des derzeitig gültigen ICD-10-Kataloges zu entwickeln. Die vorliegende, vertrauliche Passage gilt der Einführung einer neuen umschriebenen Störungskategorie im Bereich der bereits bekannten spezifischen Persönlichkeitsstörungen sowie anderen Persönlichkeitsstörungen und anhaltenden Persönlichkeitsänderungen. Diese Kategorien werden im bisherigen ICD-10-Katalog unter den Ziffern F60 F62 beschrieben und katalogisiert. Die neu zu katalogisierende Störung soll mit ICD 11 F 62.2 – andauernde Persönlichkeitsstörung nach tief greifender sozioökonomischer Belastung Ökonomisierungswahn überschrieben werden. Da in den letzten Monaten auch im systemagazin eine heftige Debatte um das„Störungsspezifische Wissen“ in der systemischen Therapie zu verzeichnen war, sind alle Leserinnen und Leser herzlich eingeladen, ihre Meinungen und Kommentare über die Einführung dieser neuen Diagnose an dieser Stelle beizusteuern. 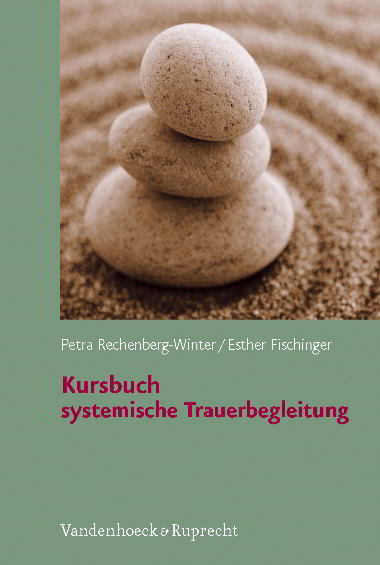







 Sie haben recht. Ich finde auch: das ist eine bescheuerte Frage! Ich hörte sie gestern im Autoradio auf dem Weg zur Arbeit. Es folgte die Ankündigung des Moderators mit sonorer Stimme: Das klären wir in ein paar Minuten. (Wie bescheuert ich auch diesen zweiten Satz finde, klären wir in ein paar Minuten.)
Sie haben recht. Ich finde auch: das ist eine bescheuerte Frage! Ich hörte sie gestern im Autoradio auf dem Weg zur Arbeit. Es folgte die Ankündigung des Moderators mit sonorer Stimme: Das klären wir in ein paar Minuten. (Wie bescheuert ich auch diesen zweiten Satz finde, klären wir in ein paar Minuten.)
 Walter Ludwig Bühl, geb. 1934, Philosoph und Soziologe, der von von 1974-1996 einen Lehrstuhl für Soziologie u.a. mit den Arbeitsschwerpunkten Soziologische Theorie, Wissens- und Wissenschaftssoziologie an der Universität München innehatte, geht in diesem Aufsatz mit Niklas Luhmann ins Gericht, der auf website
Walter Ludwig Bühl, geb. 1934, Philosoph und Soziologe, der von von 1974-1996 einen Lehrstuhl für Soziologie u.a. mit den Arbeitsschwerpunkten Soziologische Theorie, Wissens- und Wissenschaftssoziologie an der Universität München innehatte, geht in diesem Aufsatz mit Niklas Luhmann ins Gericht, der auf website