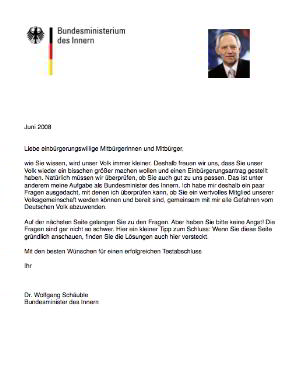Im Herbst 1998 beschäftigte sich die Systemische Gesellschaft auf ihrer Jahrestagung in Hamburg mit dem Thema„Selbsterfahrung“ als Bestandteil der Weiterbildung in Systemischer Psychotherapie. Die Vorträge wurden in„System Familie“ dokumentiert. Kurt Ludewig vertrat in seinem Beitrag„Selbstreflexion in der systemischen Weiterbildung – zum Sinn und Unsinn eines traditionellen Vorgehens“ (der in der Systemischen Bibliothek nachzulesen ist) dabei eine skeptische Haltung:„Die Frage, ob Selbsterfahrungseinheiten unerläßliche Bedingung für das Erlernen professioneller Kompetenz im Rahmen systemischer Weiterbildungen sein müssen, bleibt (
) offen. Dennoch sprechen einige Gesichtspunkte dafür, daß eine systematisch eingesetzte Form der Selbsterfahrung sinnvoll sein kann, wenn sie in einer gut ausbalancierten Mischung Ressourcen beim lernenden Therapeuten fördert und gegebenenfalls auf vorhandene Grenzen hinweist. Ich werte diesen Prozeß als einen Initiationsritus, der wie bei allen anderen Lernberufen dem Lernenden ermöglicht, die Besonderheiten des Berufes am eigenen Leibe kennenzulernen. Darüber hinaus dürfte eine angemessene, auf die persönlichen Möglichkeiten und Grenzen des Lernenden abgestimmte Selbstreflexion helfen, durch Einübung in Selbstthematisierung und Selbstveröffentlichung die wohl natürliche Scheu zu verringern, Selbiges bei seinen Klientinnen anzustoßen, sie also zu entsprechenden Prozessen anzuleiten und dabei behutsam zu begleiten. Darüber hinausgehende Erwartungen erscheinen mir hingegen fragwürdig, d. h. hinterfragbar, und zwar bei allem Respekt vor etablierten Traditionen. Denn eine verpflichtende, systematische Selbsterfahrung, die vorrangig auf das Konstrukt ,Selbsterkenntnis‘ ausgerichtet ist, setzt voraus, daß Menschen in der Weise erkannt werden können, wie dies der Fall bei Maschinen oder anderen Mechanismen ist, die aus festen Bestandteilen und überdauernden Mustern aufgebaut sind“
Im Herbst 1998 beschäftigte sich die Systemische Gesellschaft auf ihrer Jahrestagung in Hamburg mit dem Thema„Selbsterfahrung“ als Bestandteil der Weiterbildung in Systemischer Psychotherapie. Die Vorträge wurden in„System Familie“ dokumentiert. Kurt Ludewig vertrat in seinem Beitrag„Selbstreflexion in der systemischen Weiterbildung – zum Sinn und Unsinn eines traditionellen Vorgehens“ (der in der Systemischen Bibliothek nachzulesen ist) dabei eine skeptische Haltung:„Die Frage, ob Selbsterfahrungseinheiten unerläßliche Bedingung für das Erlernen professioneller Kompetenz im Rahmen systemischer Weiterbildungen sein müssen, bleibt (
) offen. Dennoch sprechen einige Gesichtspunkte dafür, daß eine systematisch eingesetzte Form der Selbsterfahrung sinnvoll sein kann, wenn sie in einer gut ausbalancierten Mischung Ressourcen beim lernenden Therapeuten fördert und gegebenenfalls auf vorhandene Grenzen hinweist. Ich werte diesen Prozeß als einen Initiationsritus, der wie bei allen anderen Lernberufen dem Lernenden ermöglicht, die Besonderheiten des Berufes am eigenen Leibe kennenzulernen. Darüber hinaus dürfte eine angemessene, auf die persönlichen Möglichkeiten und Grenzen des Lernenden abgestimmte Selbstreflexion helfen, durch Einübung in Selbstthematisierung und Selbstveröffentlichung die wohl natürliche Scheu zu verringern, Selbiges bei seinen Klientinnen anzustoßen, sie also zu entsprechenden Prozessen anzuleiten und dabei behutsam zu begleiten. Darüber hinausgehende Erwartungen erscheinen mir hingegen fragwürdig, d. h. hinterfragbar, und zwar bei allem Respekt vor etablierten Traditionen. Denn eine verpflichtende, systematische Selbsterfahrung, die vorrangig auf das Konstrukt ,Selbsterkenntnis‘ ausgerichtet ist, setzt voraus, daß Menschen in der Weise erkannt werden können, wie dies der Fall bei Maschinen oder anderen Mechanismen ist, die aus festen Bestandteilen und überdauernden Mustern aufgebaut sind“
Zum vollständigen Text
26. Juni 2008
von Tom Levold
Keine Kommentare




 Nachdem Fritz Simon seine Einführung in die systemische Organisationstheorie gewissermaßen„live“ im Carl-Auer-Blog geschrieben und damit der Leserschaft schon vorab das Angebot gemacht hat, Kommentare und Diskussionsbeiträge beizusteuern, startet er nun einen neuen Blog auf der website der„revue für postheroisches management“, in dem es um eine Einführung in die systemische Wirtschaftstheorie geht:„mit wenigen Ausnahmen (z.B. Säuglingen) nimmt heute jeder Mensch aktiv am Wirtschaftssystem teil. Die Wirtschaft bestimmt heute die Lebensbedingungen eines jeden Einzelnen wohl mehr als je zuvor. In dieser Einführung in die systemische Wirtschaftstheorie wird versucht, die Gesetzmäßigkeiten der Wirtschaft und des Wirtschaftens aus einer konstruktivistisch-systemtheoretischen Perspektive zu analysieren und darzustellen. Dabei geht es um die individuelle und kollektive Überlebensfunktion des Wirtschaftens, die Produktion und Verteilung knapper und mehr bzw. weniger austauschbarer Güter, die Wirkung von Geld als Kommunikationsmedium, die Beziehung von Gesellschaft und Wirtschaft und die Auswirkungen auf unser aller tägliches Leben“ Es besteht die Möglichkeit, zu jedem Eintrag von Fritz Simon einen Kommentar abzugeben. Allerdings ist der Text sehr leseunfreundlich in enger weißer Schrift auf schwarzem Grund gestaltet, das sollte vielleicht noch einmal überdacht werden. Ich wünsche Fritz Simon viel Erfolg mit diesem Projekt 🙂
Nachdem Fritz Simon seine Einführung in die systemische Organisationstheorie gewissermaßen„live“ im Carl-Auer-Blog geschrieben und damit der Leserschaft schon vorab das Angebot gemacht hat, Kommentare und Diskussionsbeiträge beizusteuern, startet er nun einen neuen Blog auf der website der„revue für postheroisches management“, in dem es um eine Einführung in die systemische Wirtschaftstheorie geht:„mit wenigen Ausnahmen (z.B. Säuglingen) nimmt heute jeder Mensch aktiv am Wirtschaftssystem teil. Die Wirtschaft bestimmt heute die Lebensbedingungen eines jeden Einzelnen wohl mehr als je zuvor. In dieser Einführung in die systemische Wirtschaftstheorie wird versucht, die Gesetzmäßigkeiten der Wirtschaft und des Wirtschaftens aus einer konstruktivistisch-systemtheoretischen Perspektive zu analysieren und darzustellen. Dabei geht es um die individuelle und kollektive Überlebensfunktion des Wirtschaftens, die Produktion und Verteilung knapper und mehr bzw. weniger austauschbarer Güter, die Wirkung von Geld als Kommunikationsmedium, die Beziehung von Gesellschaft und Wirtschaft und die Auswirkungen auf unser aller tägliches Leben“ Es besteht die Möglichkeit, zu jedem Eintrag von Fritz Simon einen Kommentar abzugeben. Allerdings ist der Text sehr leseunfreundlich in enger weißer Schrift auf schwarzem Grund gestaltet, das sollte vielleicht noch einmal überdacht werden. Ich wünsche Fritz Simon viel Erfolg mit diesem Projekt 🙂 Rechtzeitig vor dem Anpfiff des gestrigen EM-Viertelfinalspiels Deutschland gegen Portugal sind die beliebten TV-Unterhaltungskünstler Gerhard Delling und Günter Netzer wieder aus der Abschiebehaft entlassen worden, nachdem ihre Papiere wieder aufgetaucht waren. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck entschuldigte sich in aller Form bei den beiden Prominenten, der ARD und dem ganzen deutschen Volk:„Wir haben einen furchtbaren Fehler gemacht, den wir zutiefst bedauern. Wiedergutzumachen ist das kaum, aber wir hoffen, dass die deutsch-österreichischen Beziehungen dadurch nicht über die Maßen belastet werden“, sagte der Pressesprecher der Staatsanwalt gestern abend. Als Schuldminderungsgrund führte er an, dass sich die zuständigen Kollegen einfach nicht hätten vorstellen können, dass Personen mit solch begrenzten sprachlichen Fähigkeiten für eine so große und bedeutende Fernsehanstalt wie die ARD arbeiten könnten. Unmittelbar nach der Freilassung versammelten sich hunderttausende Delling- und Netzer-Fans in zahlreichen deutschen Städten auf eigens dafür eingerichteten Public-Viewing-Plätzen und feierten die Freilassung der beiden TV-Größen in einem unglaublichen Freudentaumel bis in die späte Nacht hinein.
Rechtzeitig vor dem Anpfiff des gestrigen EM-Viertelfinalspiels Deutschland gegen Portugal sind die beliebten TV-Unterhaltungskünstler Gerhard Delling und Günter Netzer wieder aus der Abschiebehaft entlassen worden, nachdem ihre Papiere wieder aufgetaucht waren. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck entschuldigte sich in aller Form bei den beiden Prominenten, der ARD und dem ganzen deutschen Volk:„Wir haben einen furchtbaren Fehler gemacht, den wir zutiefst bedauern. Wiedergutzumachen ist das kaum, aber wir hoffen, dass die deutsch-österreichischen Beziehungen dadurch nicht über die Maßen belastet werden“, sagte der Pressesprecher der Staatsanwalt gestern abend. Als Schuldminderungsgrund führte er an, dass sich die zuständigen Kollegen einfach nicht hätten vorstellen können, dass Personen mit solch begrenzten sprachlichen Fähigkeiten für eine so große und bedeutende Fernsehanstalt wie die ARD arbeiten könnten. Unmittelbar nach der Freilassung versammelten sich hunderttausende Delling- und Netzer-Fans in zahlreichen deutschen Städten auf eigens dafür eingerichteten Public-Viewing-Plätzen und feierten die Freilassung der beiden TV-Größen in einem unglaublichen Freudentaumel bis in die späte Nacht hinein. Das aktuelle Heft der„Family Process“ enthält wieder eine bunte Mischung aus forschungsbezogenen und klinischen Beiträgen. In der Abteilung„Qualitative Forschung zur Unterstützung therapeutischer Praxis“ finden sich zwei Arbeiten, die sich mit den Auswirkungen chronischer Vaginalschmerzen von Frauen auf ihre Paarbeziehungen einerseits, mit dem Einsatz von Fokusgruppen zum Austausch von ähnlichen und konstrastierenden Lebenserfahrungen bei Latino-Eltern andererseits beschäftigen. In beiden Fällen geht es darum, eher verschwiegenen Erfahrungen einen Raum zu verschaffen und damit Entlastung und therapeutische Bearbeitung zu ermöglichen. Ein Beitrag von Marcia Sheinberg und Fiona True gilt der Bearbeitung traumatischer Beziehungserfahrungen in Eltern-Kind-Beziehungen durch die Einführung von„Decision Dialogues“ in die Familienkommunikation, die durch ausführliche Transkripte illustriert werden. Michele Scheinkman präsentiert einen„Multi-Level-Approach“ als „Road Map for Couples Therapy“. Das Heft wird durch vier weitere Forschungsbeiträge zur Paar- und Familiendynamik abgerundet.
Das aktuelle Heft der„Family Process“ enthält wieder eine bunte Mischung aus forschungsbezogenen und klinischen Beiträgen. In der Abteilung„Qualitative Forschung zur Unterstützung therapeutischer Praxis“ finden sich zwei Arbeiten, die sich mit den Auswirkungen chronischer Vaginalschmerzen von Frauen auf ihre Paarbeziehungen einerseits, mit dem Einsatz von Fokusgruppen zum Austausch von ähnlichen und konstrastierenden Lebenserfahrungen bei Latino-Eltern andererseits beschäftigen. In beiden Fällen geht es darum, eher verschwiegenen Erfahrungen einen Raum zu verschaffen und damit Entlastung und therapeutische Bearbeitung zu ermöglichen. Ein Beitrag von Marcia Sheinberg und Fiona True gilt der Bearbeitung traumatischer Beziehungserfahrungen in Eltern-Kind-Beziehungen durch die Einführung von„Decision Dialogues“ in die Familienkommunikation, die durch ausführliche Transkripte illustriert werden. Michele Scheinkman präsentiert einen„Multi-Level-Approach“ als „Road Map for Couples Therapy“. Das Heft wird durch vier weitere Forschungsbeiträge zur Paar- und Familiendynamik abgerundet.
 Heute feiert Corina Ahlers ihren 50. Geburtstag. Als Lehrtherapeutin, Mitbegründerin und langjährige Vorsitzende der ÖAS in Wien und ihre internationalen Aktivitäten im Rahmen der EFTA ist sie auch über die Grenzen hinaus bekannt. Seit vielen Jahren bereichert sie die systemtherapeutische Szene mit theoretischen und praxisbezogenen Publikationen, wobei die Reflexion ihrer persönlichen und biografischen Beteiligung am therapeutischen und institutionellen Geschehen immer auf eine unverwechselbare und charakteristische Art und Weise ihre Überlegungen bereichert. Auf diese Weise ziehen sich Themen wie Emotionen, Selbsttheorie und -erfahrung, Gender und Macht, die im systemischen Diskurs nicht immer die Bedeutung erhalten, die ihnen eigentlich zukommen müssten, wie ein roter Faden durch ihre Arbeiten. So auch in ihrem Vortrag auf der Tagung der ÖAS im Jahre 2003, der zuerst in systeme veröffentlicht worden ist und nun anlässlich ihres Jubiläums in der
Heute feiert Corina Ahlers ihren 50. Geburtstag. Als Lehrtherapeutin, Mitbegründerin und langjährige Vorsitzende der ÖAS in Wien und ihre internationalen Aktivitäten im Rahmen der EFTA ist sie auch über die Grenzen hinaus bekannt. Seit vielen Jahren bereichert sie die systemtherapeutische Szene mit theoretischen und praxisbezogenen Publikationen, wobei die Reflexion ihrer persönlichen und biografischen Beteiligung am therapeutischen und institutionellen Geschehen immer auf eine unverwechselbare und charakteristische Art und Weise ihre Überlegungen bereichert. Auf diese Weise ziehen sich Themen wie Emotionen, Selbsttheorie und -erfahrung, Gender und Macht, die im systemischen Diskurs nicht immer die Bedeutung erhalten, die ihnen eigentlich zukommen müssten, wie ein roter Faden durch ihre Arbeiten. So auch in ihrem Vortrag auf der Tagung der ÖAS im Jahre 2003, der zuerst in systeme veröffentlicht worden ist und nun anlässlich ihres Jubiläums in der