9. September 2008
von Tom Levold
Keine Kommentare

Das aktuelle Heft des„Kontext“ ist einem spannenden Experiment gewidmet. Im Mittelpunkt steht ein langer und ausführlicher anonymer Bericht eines Adoptivvaters, der von Experten der Jugendhilfe, Familientherapie und sozialen Arbeit kommentiert wird. Die Geschichte dieses Experimentes war keine einfache, was sich schon daran zeigt, dass der zugrundeliegende Text bereits vor zwei Jahren bei der Redaktion eingegangen ist. Im Editorial heißt es:„Es ist ein ganz aus der Perspektive eines engagierten, fachlich versierten (der Adoptivvater ist selbst Psycho- und Familientherapeut), aber zugleich durch seine Tochter und das Jugendamt sich verletzt fühlenden Vaters geschrieben theoretisch würde man sagen: eher linear als zirkulär. Aber hier geht es um tiefe Gefühle der Kränkung, Ohnmacht, Frustration und des sich von der Umwelt im Stich gelassen Fühlens; und wie sollten diese den Nerv der Existenz treffenden Erfahrungen anders als linear zum Ausdruck gebracht werden? Die Perspektiven der anderen beteiligten Personen und Institutionen kommen kaum ins Spiel, wenn aber, dann unter der Wahrnehmungs- und Beurteilungsperspektive des Vaters. Zugleich ist der Bericht sehr selbstreflexiv angelegt denn es handelt sich bei dem Autor um einen Fachmann; doch auch diese Selbstreflexion bezieht die Perspektive der anderen kaum mit ein. Andererseits zeigt der Bericht, mit wie viel Liebe, Engagement und Verantwortungsbewusstsein sich die Adoptiveltern um die Beziehung zu »ihrem« Kind bemühten, das schon als Baby zu ihnen kam. Wir alle waren von dem Text sehr betroffen, ambivalent in der Reaktion und
unsicher im Bezug auf die Frage : Was sollen wir mit diesem Text anfangen? Ihn einfach in einer der nächsten Ausgaben zu veröffentlichen, war unmöglich. Von seiner Länge her hätte er alle anderen Beiträge in den Hintergrund gedrängt. Aber auch die konsequente Beibehaltung der eigenen Perspektive betrachteten wir als ein Problem : Das Jugendamt erschien als »Täter«, die Eltern, hier vor allem der Vater und letztlich auch die Adoptivtochter als dessen Opfer“
Wie weiter berichtet, erwies sich nicht nur aufgrund der Anonymität des Autors (die bis heute für die Herausgeber fortbesteht) die Kommunikation mit ihm als schwierig, es war auch nicht leicht, in Frage kommende Kommentatoren zu finden. Auch ein abschließender Text des Autors kam nicht zustande. Dennoch entschieden sich die Herausgeber zur Veröffentlichung, weil„endlich einmal die die andere Seite Sozialer Arbeit, Beratung und Therapie, nämlich die Adressatenseite, zum Zuge kommt zumindest durch die Feder eines Betroffenen, der über genügend Mut, soziale und intellektuelle Kompetenzen verfügt, um sich öffentlich zu artikulieren. Diese Seite zu hören, ernst zu nehmen, wertzuschätzen und dialogisch für den weiteren Hilfeprozess zu nutzen, auch wenn sie uns kränkt, verletzt und in unserem professionellen Selbstwert trifft, ist ja eine wesentliche Forderung an die systemische Praxis (und nicht nur an diese)“
Zu den vollständigen abstracts
 Wer mit der hypnotherapeutischen Arbeit mit Erwachsenen vertraut ist, muss sich deshalb noch lange nicht auf die Anwendung der Hypnotherapie bei Kindern und Jugendlichen verstehen. Wer einmal einen Workshop mit Siegfried Mrochen, Professor an der Universität Siegen, erlebt hat, bekommt ein Gefühl für die Unterschiede – und für die unglaubliche Fähigkeit, mit der er in die Vorstellungswelt von Kindern eintauchen und ressourcenorientiert an sie anknüpfen kann. Gemeinsam mit Karl L. Holtz aus Heidelberg, dortselbst an der Pädagogischen Hochschule als Psychologie-Professor tätig, hat er in der Reihe Carl-Auer Compact eine„Einführung in die Hypnotherapie mit Kindern und Jugendlichen“ herausgebracht. Rezensent Thomas Lindner, Leiter einer Familien-Beratungsstelle:„Angenehm ist, dass die Autoren hypnotherapeutisches Vorgehen einbetten in ein multiperspektivisches Verstehen der zu behandelnden Problematik. Dabei greifen sie auf lerntheoretische, psychodynamische, überwiegend aber systemische Sichtweisen zurück. Niemals beschränkt sich ihr Ansatz auf reine Symptombeseitigung. Der systemisch orientierte Therapeut hätte sich das Kapitel über die Arbeit mit der Familie ausführlicher gewünscht aber er hat ja kein Lehrbuch sondern eine preiswerte ,Einführung‘ gekauft. Und die ist rundum gelungen!“
Wer mit der hypnotherapeutischen Arbeit mit Erwachsenen vertraut ist, muss sich deshalb noch lange nicht auf die Anwendung der Hypnotherapie bei Kindern und Jugendlichen verstehen. Wer einmal einen Workshop mit Siegfried Mrochen, Professor an der Universität Siegen, erlebt hat, bekommt ein Gefühl für die Unterschiede – und für die unglaubliche Fähigkeit, mit der er in die Vorstellungswelt von Kindern eintauchen und ressourcenorientiert an sie anknüpfen kann. Gemeinsam mit Karl L. Holtz aus Heidelberg, dortselbst an der Pädagogischen Hochschule als Psychologie-Professor tätig, hat er in der Reihe Carl-Auer Compact eine„Einführung in die Hypnotherapie mit Kindern und Jugendlichen“ herausgebracht. Rezensent Thomas Lindner, Leiter einer Familien-Beratungsstelle:„Angenehm ist, dass die Autoren hypnotherapeutisches Vorgehen einbetten in ein multiperspektivisches Verstehen der zu behandelnden Problematik. Dabei greifen sie auf lerntheoretische, psychodynamische, überwiegend aber systemische Sichtweisen zurück. Niemals beschränkt sich ihr Ansatz auf reine Symptombeseitigung. Der systemisch orientierte Therapeut hätte sich das Kapitel über die Arbeit mit der Familie ausführlicher gewünscht aber er hat ja kein Lehrbuch sondern eine preiswerte ,Einführung‘ gekauft. Und die ist rundum gelungen!“

 (DGSF, 17.9.08): Dr. Julika Zwack, Universität Heidelberg, ist in diesem Jahr Preisträgerin des mit 3000 Euro dotierten Forschungspreises der Deutschen Gesellschaft für Systemische Therapie und Familientherapie (DGSF). Ausgezeichnet wurde ihre Promotionsarbeit„Systemische Akutpsychiatrie als multiprofessionelle Praxis“. Die Preisträgerin hat in drei großen psychiatrischen Kliniken des SYMPA-Projektes (Systemtherapeutische Methoden in der psychiatrischen Akutversorgung) untersucht, wie sich die Arbeitssituation auf den Stationen verändert, wenn ein systemtherapeutisches Behandlungskonzept mit gemeinsamer Weiterbildung ganzer Stationsteams eingeführt wird. Die Ergebnisse zeigen, dass die Burnout-Belastung der Klinikmitarbeiter sinkt, dass sich das Teamklima auf mehreren Skalen verbessert und dass sich die Pflege als eigenständige, auch therapeutisch tätige Berufsgruppe emanzipiert. Julika Zwacks Bestandsaufnahme der veränderten Arbeitsweisen nach Abschluss der systemischen Weiterbildung macht anschaulich: Eine familien- und systemorientierte Behandlungsweise ist in psychiatrischen Kliniken der Regelversorgung gut realisierbar. Sie erleichtert und verbessert die Zusammenarbeit der psychiatrischen Fachleute mit ihren Patienten und deren Angehörigen. Julika Zwack hat Teile ihrer Ergebnisse in renommierten Fachzeitschriften veröffentlicht, unter anderem in der Zeitschrift Psychiatrische Praxis, in Familiendynamik und im britischen Journal of Family Therapy. Die Preisträgerin ist Diplom-Psychologin und Psychologische Psychotherapeutin. Sie arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Medizinische Psychologie des Universitätsklinikums Heidelberg. systemagazin gratuliert Julika Zwack zum Forschungspreis!
(DGSF, 17.9.08): Dr. Julika Zwack, Universität Heidelberg, ist in diesem Jahr Preisträgerin des mit 3000 Euro dotierten Forschungspreises der Deutschen Gesellschaft für Systemische Therapie und Familientherapie (DGSF). Ausgezeichnet wurde ihre Promotionsarbeit„Systemische Akutpsychiatrie als multiprofessionelle Praxis“. Die Preisträgerin hat in drei großen psychiatrischen Kliniken des SYMPA-Projektes (Systemtherapeutische Methoden in der psychiatrischen Akutversorgung) untersucht, wie sich die Arbeitssituation auf den Stationen verändert, wenn ein systemtherapeutisches Behandlungskonzept mit gemeinsamer Weiterbildung ganzer Stationsteams eingeführt wird. Die Ergebnisse zeigen, dass die Burnout-Belastung der Klinikmitarbeiter sinkt, dass sich das Teamklima auf mehreren Skalen verbessert und dass sich die Pflege als eigenständige, auch therapeutisch tätige Berufsgruppe emanzipiert. Julika Zwacks Bestandsaufnahme der veränderten Arbeitsweisen nach Abschluss der systemischen Weiterbildung macht anschaulich: Eine familien- und systemorientierte Behandlungsweise ist in psychiatrischen Kliniken der Regelversorgung gut realisierbar. Sie erleichtert und verbessert die Zusammenarbeit der psychiatrischen Fachleute mit ihren Patienten und deren Angehörigen. Julika Zwack hat Teile ihrer Ergebnisse in renommierten Fachzeitschriften veröffentlicht, unter anderem in der Zeitschrift Psychiatrische Praxis, in Familiendynamik und im britischen Journal of Family Therapy. Die Preisträgerin ist Diplom-Psychologin und Psychologische Psychotherapeutin. Sie arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Medizinische Psychologie des Universitätsklinikums Heidelberg. systemagazin gratuliert Julika Zwack zum Forschungspreis! In der„Zeitschrift für systemische Therapie“ 3/1999 erschien ein Aufsatz von Bernd Schmid, Joachim Hipp und Sabine Caspari mit dem obigen Titel, in dem sie sich auf einem transaktionsanalytischen Hintergrund mit dem Phänomen der Intution auseinandersetzen:„Eric Berne entwickelte das Konzept der Intuition als Instrument für Therapeuten und Berater. Verknüpft mit wirklichkeitskonstruktiven Ideen bedeutet die Nutzung von Intuition eine reiche Quelle der Selbstorganisation und -steuerung in der Beratung von Menschen und Systemen. Besonders in hochkomplexen Situationen und bei knappen Ressourcen stellt sie ein unerläßliches Medium für„Inspiration“ dar und ist damit eine Möglichkeit, in professionellen Situationen Überschaubarkeit, Handlungsfähigkeit und wechselseitige Abstimmung herzustellen. In diesem Artikel werden einige Modellüberlegungen aufgezeigt, die sinnvolle Fragestellungen für die Professionalisierung von Beratern und Trainern ergeben“.
In der„Zeitschrift für systemische Therapie“ 3/1999 erschien ein Aufsatz von Bernd Schmid, Joachim Hipp und Sabine Caspari mit dem obigen Titel, in dem sie sich auf einem transaktionsanalytischen Hintergrund mit dem Phänomen der Intution auseinandersetzen:„Eric Berne entwickelte das Konzept der Intuition als Instrument für Therapeuten und Berater. Verknüpft mit wirklichkeitskonstruktiven Ideen bedeutet die Nutzung von Intuition eine reiche Quelle der Selbstorganisation und -steuerung in der Beratung von Menschen und Systemen. Besonders in hochkomplexen Situationen und bei knappen Ressourcen stellt sie ein unerläßliches Medium für„Inspiration“ dar und ist damit eine Möglichkeit, in professionellen Situationen Überschaubarkeit, Handlungsfähigkeit und wechselseitige Abstimmung herzustellen. In diesem Artikel werden einige Modellüberlegungen aufgezeigt, die sinnvolle Fragestellungen für die Professionalisierung von Beratern und Trainern ergeben“.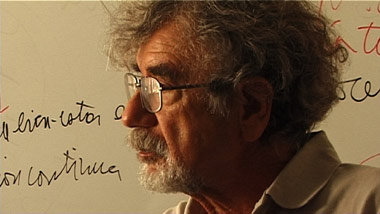
 Heute wäre der ungarische Psychoanalytiker und Mitbegründer der„Ethnopsychoanalyse“ George Devereux (gest. 1985) 100 Jahre alt geworden. Devereux, der einer bürgerlichen ungarischen jüdischen Familie entstammte, studierte ab 1926 in Paris Physik und Chemie und absolvierte eine Lehre als Verlagsbuchhändler in Leipzig.
Heute wäre der ungarische Psychoanalytiker und Mitbegründer der„Ethnopsychoanalyse“ George Devereux (gest. 1985) 100 Jahre alt geworden. Devereux, der einer bürgerlichen ungarischen jüdischen Familie entstammte, studierte ab 1926 in Paris Physik und Chemie und absolvierte eine Lehre als Verlagsbuchhändler in Leipzig. 


