13. Oktober 2008
von Tom Levold
Keine Kommentare
 Während sich die Politik darauf geeinigt hat, die Bezüge von Bankmanagern deutlich zu begrenzen, fordern Wirtschaftswissenschaftler der TU Chemnitz, dass Bankvorstände zukünftig mit einem monatlichen Regelsatz von 132 Euro auskommen sollen. Das geht aus einer Studie hervor, die am Mittwoch auf der Internetseite der Technischen Universität Chemnitz veröffentlicht wurde. Für alle Bereiche des Lebens, ob Ernährung, Kommunikation oder Kultur, sehen die Wissenschaftler bei dieser Personengruppe erhebliches Kürzungspotenzial.„Die Durchschnittsbezüge von Bankvorständen liegen bei 12 Millionen . Wir haben festgestellt, dass man zum Leben aber nur 132 im Monat braucht“, sagte der Leiter der Studie, Friedrich Thießen dem systemagazin. BDI-Hauptgeschäftsführer Werner Schnappauf verurteilte die Studie dagegen als„hochgradig interessengeleitet“. Die Umsetzung des Vorschlags würde die ohnehin zu hohe Belastung für die Leistungsträger der Finanzwirtschaft massiv verschärfen, betonte er. Die Studie platzt mitten in eine neue, heftig geführte Debatte über Zahlungen an Bankmanager in Zeiten der Finanzkrise. In den Reihen der SPD mehren sich die Stimmen, die für mehr Härte bei missbräuchlichem Bezug von Vorstandsgehältern plädieren. CDU und CSU hingegen sprechen sich eher dafür aus, den Vorständen wenigstens Gehälter in Höhe der aktuellen Hartz-IV-Sätze von 350 zuzubilligen. Nach Ansicht der Chemnitzer Ökonomen ist es rechtlich völlig unklar, was unter Existenzminimum zu verstehen ist.„Unsere Gesellschaft hat sich bisher davor herumgedrückt, die Ziele der Mindestsicherung für Bankmanager exakt zu formulieren“, heißt es in der Studie. Aus dem Grundgesetz ließen sich lediglich schwammige Leitbilder der„physischen Existenzsicherung“ und der„Teilhabe am kulturellen Leben“ ableiten. Dafür reichten aber weitaus geringere Leistungen: Der derzeitige Hartz-IV-Satz liege jedenfalls„weit oberhalb des physischen Existenzminimums“. In einer Tabelle erstellen die Autoren deshalb für alle relevanten Lebensbereiche Richtwerte, die ihrer Meinung nach angemessen sind. Die Preiserhebungen wurden ausschließlich in Discountern und Billig-Ketten durchgeführt. So reiche ein Euro, um den monatlichen Freizeit- und Unterhaltungsbedarf von Bankvorständen zu decken. Mit zwei Euro für„20 Min./Tag Internet in Stadtbibliothek“ ließe sich ausreichend kommunizieren. Der Bedarf für Lebensmittel wird auf 68 Euro monatlich taxiert. Auf Champagner und Zigarren müsse verzichtet werden. Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, Josef Ackermann zeigte sich entsetzt. Er warf den Autoren vor, die sich ausbreitende Manager-Armut mit Theoriespielchen zu verschleiern.„Nicht einmal der laufende Schulbedarf für Kinder ist gedeckt“, so Ackermann.„Der Regelsatz enthält lediglich 1,63 Euro für allgemeine Schreibwaren“
Während sich die Politik darauf geeinigt hat, die Bezüge von Bankmanagern deutlich zu begrenzen, fordern Wirtschaftswissenschaftler der TU Chemnitz, dass Bankvorstände zukünftig mit einem monatlichen Regelsatz von 132 Euro auskommen sollen. Das geht aus einer Studie hervor, die am Mittwoch auf der Internetseite der Technischen Universität Chemnitz veröffentlicht wurde. Für alle Bereiche des Lebens, ob Ernährung, Kommunikation oder Kultur, sehen die Wissenschaftler bei dieser Personengruppe erhebliches Kürzungspotenzial.„Die Durchschnittsbezüge von Bankvorständen liegen bei 12 Millionen . Wir haben festgestellt, dass man zum Leben aber nur 132 im Monat braucht“, sagte der Leiter der Studie, Friedrich Thießen dem systemagazin. BDI-Hauptgeschäftsführer Werner Schnappauf verurteilte die Studie dagegen als„hochgradig interessengeleitet“. Die Umsetzung des Vorschlags würde die ohnehin zu hohe Belastung für die Leistungsträger der Finanzwirtschaft massiv verschärfen, betonte er. Die Studie platzt mitten in eine neue, heftig geführte Debatte über Zahlungen an Bankmanager in Zeiten der Finanzkrise. In den Reihen der SPD mehren sich die Stimmen, die für mehr Härte bei missbräuchlichem Bezug von Vorstandsgehältern plädieren. CDU und CSU hingegen sprechen sich eher dafür aus, den Vorständen wenigstens Gehälter in Höhe der aktuellen Hartz-IV-Sätze von 350 zuzubilligen. Nach Ansicht der Chemnitzer Ökonomen ist es rechtlich völlig unklar, was unter Existenzminimum zu verstehen ist.„Unsere Gesellschaft hat sich bisher davor herumgedrückt, die Ziele der Mindestsicherung für Bankmanager exakt zu formulieren“, heißt es in der Studie. Aus dem Grundgesetz ließen sich lediglich schwammige Leitbilder der„physischen Existenzsicherung“ und der„Teilhabe am kulturellen Leben“ ableiten. Dafür reichten aber weitaus geringere Leistungen: Der derzeitige Hartz-IV-Satz liege jedenfalls„weit oberhalb des physischen Existenzminimums“. In einer Tabelle erstellen die Autoren deshalb für alle relevanten Lebensbereiche Richtwerte, die ihrer Meinung nach angemessen sind. Die Preiserhebungen wurden ausschließlich in Discountern und Billig-Ketten durchgeführt. So reiche ein Euro, um den monatlichen Freizeit- und Unterhaltungsbedarf von Bankvorständen zu decken. Mit zwei Euro für„20 Min./Tag Internet in Stadtbibliothek“ ließe sich ausreichend kommunizieren. Der Bedarf für Lebensmittel wird auf 68 Euro monatlich taxiert. Auf Champagner und Zigarren müsse verzichtet werden. Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, Josef Ackermann zeigte sich entsetzt. Er warf den Autoren vor, die sich ausbreitende Manager-Armut mit Theoriespielchen zu verschleiern.„Nicht einmal der laufende Schulbedarf für Kinder ist gedeckt“, so Ackermann.„Der Regelsatz enthält lediglich 1,63 Euro für allgemeine Schreibwaren“
 Vom 10.-13.9.2008 fand die diesjährige Jahrestagung der DGSF statt, und erstmals war eine größere systemische Tagung der Hirnforschung und ihrer Bedeutung für eine systemische Praxis gewidmet. Katrin Richter aus Laboe hat einen (n)eu(ro)phorischen 🙂 Tagungsbericht verfasst, der die gute Stimmung der Tagung auf lebendige Weise wiedergibt:„Ich will ja nicht schon wieder damit beginnen, dass es beeindruckend war, das ist es ja immer. Man könnte nach diesem Kongress schon von ewiger neuer neuronaler Vernetzung sprechen. Ich weiß ja nicht, wie es anderen Teilnehmern geht, aber ich profitiere lange davon, bin hellauf begeistert, verschwinde mit meinen neuen Synapsennetzwerken in meiner Schatzkammer und summe leise vor mich hin. Es war der größte DGSF-Kongress überhaupt mit mehr als 600 Teilnehmern. Die Qualität stimmte“
Vom 10.-13.9.2008 fand die diesjährige Jahrestagung der DGSF statt, und erstmals war eine größere systemische Tagung der Hirnforschung und ihrer Bedeutung für eine systemische Praxis gewidmet. Katrin Richter aus Laboe hat einen (n)eu(ro)phorischen 🙂 Tagungsbericht verfasst, der die gute Stimmung der Tagung auf lebendige Weise wiedergibt:„Ich will ja nicht schon wieder damit beginnen, dass es beeindruckend war, das ist es ja immer. Man könnte nach diesem Kongress schon von ewiger neuer neuronaler Vernetzung sprechen. Ich weiß ja nicht, wie es anderen Teilnehmern geht, aber ich profitiere lange davon, bin hellauf begeistert, verschwinde mit meinen neuen Synapsennetzwerken in meiner Schatzkammer und summe leise vor mich hin. Es war der größte DGSF-Kongress überhaupt mit mehr als 600 Teilnehmern. Die Qualität stimmte“


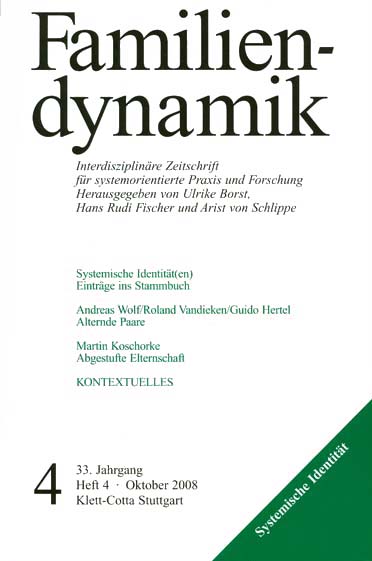

 Manfred Füllsack, Sozialwissenschaftler an der Universität Wien, hat sich 1998, also nach Erscheinen von Luhmanns„Gesellschaft der Gesellschaft“ in einem Aufsatz für„Soziale Systeme“ (mit dem Titel„Geltungsansprüche und Beobachtungen zweiter Ordnung. Wie nahe kommen sich Diskurs- und Systemtheorie?“) noch einmal Gedanken über die sogenannte Habermas-Luhmann-Debatte unter gemacht und plädiert für eine Entpolarisierung:„Obwohl die Heftigkeit der Kontroverse nicht zuletzt auch in der Wahl der sprachlichen Mittel zwar nun eine gewisse Konsolidierung gegenüber ihrem Beginn in den siebziger Jahren zu erfahren scheint, dürften die beiden Konzepte in der sozialwissenschaftlichen Theoriediskussion nach wie vor als weitgehend inkompatibel gelten. Gerade Die Gesellschaft der Gesellschaft gibt aber, indem sie gewisse, freilich bereits auch im früheren Werk angelegte Züge der systemtheoretischen Konzeption mit neuer Deutlichkeit herausstellt, Anlaß, einen zweiten Blick auf Parallelen und Analogien von Diskurs- und Systemtheorie zu werfen. Dabei zeigt sich überraschender Weise, daß die Fronten so starr gar nicht sein müßten, daß sie vielmehr an sehr grundsätzlichen Stellen Möglichkeiten bieten, um die eine Konzeption in die andere überzuführen oder mit den Konsequenzen der einen an Prämissen der anderen gewissermaßen interkonzeptuell anzuschließen. Ob die beiden Autoren (und vor allem die mittlerweile nicht unbeträchtliche Zahl ihrer Epigonen) ihre Theorien freilich in dieser Weise kompatibilisiert sehen wollten, bleibt fraglich. Da sich aber beim Aneinanderhalten der beiden Konzepte einerseits ein besseres Verständnis der jeweiligen Ansätze ergeben könnte ( – um mit Luhmann zu sprechen, kann man dann sehen, daß und wie eine der Theorien sehen kann, was die jeweils andere nicht sehen kann – ), und andererseits damit vielleicht auch weitere Anschlußmöglichkeiten für die Sozialwissenschaften geschaffen werden, werde ich im folgenden als Teil einer umfangreicheren Untersuchungsreihe zur Habermas-Luhmann-Debatte – die jeweiligen theoretischen Zentren der beiden Konzeptionen gegeneinanderstellen und zeigen, daß ihre Differenzen zwar grundsätzlich, nicht aber unüberwindbar sind“ Der Aufsatz ist auch im Internet zu lesen,
Manfred Füllsack, Sozialwissenschaftler an der Universität Wien, hat sich 1998, also nach Erscheinen von Luhmanns„Gesellschaft der Gesellschaft“ in einem Aufsatz für„Soziale Systeme“ (mit dem Titel„Geltungsansprüche und Beobachtungen zweiter Ordnung. Wie nahe kommen sich Diskurs- und Systemtheorie?“) noch einmal Gedanken über die sogenannte Habermas-Luhmann-Debatte unter gemacht und plädiert für eine Entpolarisierung:„Obwohl die Heftigkeit der Kontroverse nicht zuletzt auch in der Wahl der sprachlichen Mittel zwar nun eine gewisse Konsolidierung gegenüber ihrem Beginn in den siebziger Jahren zu erfahren scheint, dürften die beiden Konzepte in der sozialwissenschaftlichen Theoriediskussion nach wie vor als weitgehend inkompatibel gelten. Gerade Die Gesellschaft der Gesellschaft gibt aber, indem sie gewisse, freilich bereits auch im früheren Werk angelegte Züge der systemtheoretischen Konzeption mit neuer Deutlichkeit herausstellt, Anlaß, einen zweiten Blick auf Parallelen und Analogien von Diskurs- und Systemtheorie zu werfen. Dabei zeigt sich überraschender Weise, daß die Fronten so starr gar nicht sein müßten, daß sie vielmehr an sehr grundsätzlichen Stellen Möglichkeiten bieten, um die eine Konzeption in die andere überzuführen oder mit den Konsequenzen der einen an Prämissen der anderen gewissermaßen interkonzeptuell anzuschließen. Ob die beiden Autoren (und vor allem die mittlerweile nicht unbeträchtliche Zahl ihrer Epigonen) ihre Theorien freilich in dieser Weise kompatibilisiert sehen wollten, bleibt fraglich. Da sich aber beim Aneinanderhalten der beiden Konzepte einerseits ein besseres Verständnis der jeweiligen Ansätze ergeben könnte ( – um mit Luhmann zu sprechen, kann man dann sehen, daß und wie eine der Theorien sehen kann, was die jeweils andere nicht sehen kann – ), und andererseits damit vielleicht auch weitere Anschlußmöglichkeiten für die Sozialwissenschaften geschaffen werden, werde ich im folgenden als Teil einer umfangreicheren Untersuchungsreihe zur Habermas-Luhmann-Debatte – die jeweiligen theoretischen Zentren der beiden Konzeptionen gegeneinanderstellen und zeigen, daß ihre Differenzen zwar grundsätzlich, nicht aber unüberwindbar sind“ Der Aufsatz ist auch im Internet zu lesen, Wie sich mittlerweile herumgesprochen hat, sind in keinem Land der Welt mehr Menschen inhaftiert (in Relation zur Gesamtbevölkerung) wie in den USA. Ein Thema für Psychotherapeuten? Bislang wohl viel zu wenig. Die aktuelle Ausgabe von„Family Process“ ist diesem Schwerpunkt gewidmet. In einem leidenschaftlichen Plädoyer, sich intensiver mit diesen Fragen auseinanderzusetzen, nennt Herausgeberin Evan Imber-Black ein paar Zahlen: Alleine im Jahre 2007 nahm die Zahl der Gefängnisinsassen in den USA um 25.000 zu! Mehr als einer von hundert Amerikanern ist inhaftiert, aber genauer: einer von 36 Latinos, einer von 15 schwarzen Männern, 1 von 9 schwarzen Jugendlichen! Die durchschnittlichen Kosten eines Gefängnisjahres pro Person belaufen sich auf 23.000 $, ein Betrag, von dem die Unterrichtskosten vieler Colleges bestritten werden könnten. Der Bundesstaat Arizona gibt mehr Geld für die Haftunterbringung von Latinos und Afroamerikanern aus als insgesamt für ihre Bildung. usw. usw. Die Beiträge des aktuellen Heftes befassen sich schwerpunktmäßig mit inhaftierten Frauen und Müttern und könnten auch als Anregung verstanden werden, sich auch hierzulande stärker mit dem Thema des Strafvollzuges aus psychosozialer und therapeutisch-pädagogischer Sicht auseinanderzusetzen.
Wie sich mittlerweile herumgesprochen hat, sind in keinem Land der Welt mehr Menschen inhaftiert (in Relation zur Gesamtbevölkerung) wie in den USA. Ein Thema für Psychotherapeuten? Bislang wohl viel zu wenig. Die aktuelle Ausgabe von„Family Process“ ist diesem Schwerpunkt gewidmet. In einem leidenschaftlichen Plädoyer, sich intensiver mit diesen Fragen auseinanderzusetzen, nennt Herausgeberin Evan Imber-Black ein paar Zahlen: Alleine im Jahre 2007 nahm die Zahl der Gefängnisinsassen in den USA um 25.000 zu! Mehr als einer von hundert Amerikanern ist inhaftiert, aber genauer: einer von 36 Latinos, einer von 15 schwarzen Männern, 1 von 9 schwarzen Jugendlichen! Die durchschnittlichen Kosten eines Gefängnisjahres pro Person belaufen sich auf 23.000 $, ein Betrag, von dem die Unterrichtskosten vieler Colleges bestritten werden könnten. Der Bundesstaat Arizona gibt mehr Geld für die Haftunterbringung von Latinos und Afroamerikanern aus als insgesamt für ihre Bildung. usw. usw. Die Beiträge des aktuellen Heftes befassen sich schwerpunktmäßig mit inhaftierten Frauen und Müttern und könnten auch als Anregung verstanden werden, sich auch hierzulande stärker mit dem Thema des Strafvollzuges aus psychosozialer und therapeutisch-pädagogischer Sicht auseinanderzusetzen. Während sich die Politik darauf geeinigt hat, die Bezüge von Bankmanagern deutlich zu begrenzen, fordern Wirtschaftswissenschaftler der TU Chemnitz, dass Bankvorstände zukünftig mit einem monatlichen Regelsatz von 132 Euro auskommen sollen. Das geht aus einer Studie hervor, die am Mittwoch auf der Internetseite der Technischen Universität Chemnitz veröffentlicht wurde. Für alle Bereiche des Lebens, ob Ernährung, Kommunikation oder Kultur, sehen die Wissenschaftler bei dieser Personengruppe erhebliches Kürzungspotenzial.„Die Durchschnittsbezüge von Bankvorständen liegen bei 12 Millionen . Wir haben festgestellt, dass man zum Leben aber nur 132 im Monat braucht“, sagte der Leiter der Studie, Friedrich Thießen dem systemagazin. BDI-Hauptgeschäftsführer Werner Schnappauf verurteilte die Studie dagegen als„hochgradig interessengeleitet“. Die Umsetzung des Vorschlags würde die ohnehin zu hohe Belastung für die Leistungsträger der Finanzwirtschaft massiv verschärfen, betonte er. Die Studie platzt mitten in eine neue, heftig geführte Debatte über Zahlungen an Bankmanager in Zeiten der Finanzkrise. In den Reihen der SPD mehren sich die Stimmen, die für mehr Härte bei missbräuchlichem Bezug von Vorstandsgehältern plädieren. CDU und CSU hingegen sprechen sich eher dafür aus, den Vorständen wenigstens Gehälter in Höhe der aktuellen Hartz-IV-Sätze von 350 zuzubilligen. Nach Ansicht der Chemnitzer Ökonomen ist es rechtlich völlig unklar, was unter Existenzminimum zu verstehen ist.„Unsere Gesellschaft hat sich bisher davor herumgedrückt, die Ziele der Mindestsicherung für Bankmanager exakt zu formulieren“, heißt es in der Studie. Aus dem Grundgesetz ließen sich lediglich schwammige Leitbilder der„physischen Existenzsicherung“ und der„Teilhabe am kulturellen Leben“ ableiten. Dafür reichten aber weitaus geringere Leistungen: Der derzeitige Hartz-IV-Satz liege jedenfalls„weit oberhalb des physischen Existenzminimums“. In einer Tabelle erstellen die Autoren deshalb für alle relevanten Lebensbereiche Richtwerte, die ihrer Meinung nach angemessen sind. Die Preiserhebungen wurden ausschließlich in Discountern und Billig-Ketten durchgeführt. So reiche ein Euro, um den monatlichen Freizeit- und Unterhaltungsbedarf von Bankvorständen zu decken. Mit zwei Euro für„20 Min./Tag Internet in Stadtbibliothek“ ließe sich ausreichend kommunizieren. Der Bedarf für Lebensmittel wird auf 68 Euro monatlich taxiert. Auf Champagner und Zigarren müsse verzichtet werden. Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, Josef Ackermann zeigte sich entsetzt. Er warf den Autoren vor, die sich ausbreitende Manager-Armut mit Theoriespielchen zu verschleiern.„Nicht einmal der laufende Schulbedarf für Kinder ist gedeckt“, so Ackermann.„Der Regelsatz enthält lediglich 1,63 Euro für allgemeine Schreibwaren“
Während sich die Politik darauf geeinigt hat, die Bezüge von Bankmanagern deutlich zu begrenzen, fordern Wirtschaftswissenschaftler der TU Chemnitz, dass Bankvorstände zukünftig mit einem monatlichen Regelsatz von 132 Euro auskommen sollen. Das geht aus einer Studie hervor, die am Mittwoch auf der Internetseite der Technischen Universität Chemnitz veröffentlicht wurde. Für alle Bereiche des Lebens, ob Ernährung, Kommunikation oder Kultur, sehen die Wissenschaftler bei dieser Personengruppe erhebliches Kürzungspotenzial.„Die Durchschnittsbezüge von Bankvorständen liegen bei 12 Millionen . Wir haben festgestellt, dass man zum Leben aber nur 132 im Monat braucht“, sagte der Leiter der Studie, Friedrich Thießen dem systemagazin. BDI-Hauptgeschäftsführer Werner Schnappauf verurteilte die Studie dagegen als„hochgradig interessengeleitet“. Die Umsetzung des Vorschlags würde die ohnehin zu hohe Belastung für die Leistungsträger der Finanzwirtschaft massiv verschärfen, betonte er. Die Studie platzt mitten in eine neue, heftig geführte Debatte über Zahlungen an Bankmanager in Zeiten der Finanzkrise. In den Reihen der SPD mehren sich die Stimmen, die für mehr Härte bei missbräuchlichem Bezug von Vorstandsgehältern plädieren. CDU und CSU hingegen sprechen sich eher dafür aus, den Vorständen wenigstens Gehälter in Höhe der aktuellen Hartz-IV-Sätze von 350 zuzubilligen. Nach Ansicht der Chemnitzer Ökonomen ist es rechtlich völlig unklar, was unter Existenzminimum zu verstehen ist.„Unsere Gesellschaft hat sich bisher davor herumgedrückt, die Ziele der Mindestsicherung für Bankmanager exakt zu formulieren“, heißt es in der Studie. Aus dem Grundgesetz ließen sich lediglich schwammige Leitbilder der„physischen Existenzsicherung“ und der„Teilhabe am kulturellen Leben“ ableiten. Dafür reichten aber weitaus geringere Leistungen: Der derzeitige Hartz-IV-Satz liege jedenfalls„weit oberhalb des physischen Existenzminimums“. In einer Tabelle erstellen die Autoren deshalb für alle relevanten Lebensbereiche Richtwerte, die ihrer Meinung nach angemessen sind. Die Preiserhebungen wurden ausschließlich in Discountern und Billig-Ketten durchgeführt. So reiche ein Euro, um den monatlichen Freizeit- und Unterhaltungsbedarf von Bankvorständen zu decken. Mit zwei Euro für„20 Min./Tag Internet in Stadtbibliothek“ ließe sich ausreichend kommunizieren. Der Bedarf für Lebensmittel wird auf 68 Euro monatlich taxiert. Auf Champagner und Zigarren müsse verzichtet werden. Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, Josef Ackermann zeigte sich entsetzt. Er warf den Autoren vor, die sich ausbreitende Manager-Armut mit Theoriespielchen zu verschleiern.„Nicht einmal der laufende Schulbedarf für Kinder ist gedeckt“, so Ackermann.„Der Regelsatz enthält lediglich 1,63 Euro für allgemeine Schreibwaren“
