23. März 2009
von Tom Levold
Keine Kommentare
 Heinrich Tessenow (1876-1950) war ein namhafter Architekt und Hochschullehrer und ist insbesondere für die Umsetzung des Reformgedankens in der Architektur bekannt geworden, ein Konzept der Kritik an der Industrialisierung beziehungsweise an Materialismus und Urbanisierung, die mit dem Leitmotto Zurück zur Natur“ charakterisiert werden könnte. Seit 1963 wird jährlich die Heinrich-Tessenow-Medaille verliehen,„im Gedenken an den großen Architekten, Baumeister und Hochschullehrer, europäischen Persönlichkeiten zuerkannt, die Hervorragendes in der architektonischen, handwerklichen und industriellen Formgebung und in der Erziehung zu Wohn- und Baukultur geleistet haben, oder deren Wirken dem vielseitigen Lebenswerk Heinrich Tessenows entspricht“, wie es auf der website der Tessenow-Gesellschaft heißt. In diesem Jahr ist der bedeutende und auch hierzulande prominente Soziologe Richard Sennet (* 1943) zum Preisträger gewählt worden. Heinz Bude, Soziologie-Professor in Kassel, hat die lesenswerte Laudatio gehalten, die am Wochenende in der TAZ veröffentlicht wurde:„Vielleicht kann man das Werk von Richard Sennett als Antwort auf eine„geistige Situation der Zeit“ nehmen, wo wir begreifen wollen, was uns in dieser Periode des Flexiblen Kapitalismus ergriffen hat, die mit einem Schlag vergangen zu sein scheint. Wir fragen uns, wozu wir uns durch„Plastikwörter“ wie Globalisierung, Digitalisierung und Individualisierung haben verleiten lassen. Natürlich hat sich dadurch, dass wir relativ mühelos überall hinreisen können, dass wir Sushi, Yoga und Buddhas ins Normalprogramm der Lebensführung aufgenommen haben, dass wir sofort über Bilder von jedem Erdbeben verfügen können, unsere Welt verändert. Natürlich hat uns das Internet ganz andere Kommunikationsmöglichkeiten eröffnet. Und natürlich wollen wir alle einzigartige und unaustauschbare Individuen sein und uns nicht mehr als Repräsentanten von Großgruppen ansprechen lassen. Aber die Tatsache, dass sich uns durch den globalen Massentourismus, den globalen Massenkonsum und die globalen Massenmedien viele neue Türen öffnen, kann doch nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir immer nur durch eine einzige gehen können. Die Tatsache, dass wir uns über Facebook viele neue Freunde ansichtig machen können, wirft andererseits die Frage auf, was ein wirklicher Freund ist. Hilft uns Richard Sennett, wenn sich heute die Frage nach Lebensformen der Existenz, der Freundschaft und der Treue stellt? Ich glaube, ja, und ich will das an drei Begriffen zeigen, die sich durch das Werk von Richard Sennett ziehen: dem Begriff des Charakters, dem Begriff des Respekts und dem des Handwerks“
Heinrich Tessenow (1876-1950) war ein namhafter Architekt und Hochschullehrer und ist insbesondere für die Umsetzung des Reformgedankens in der Architektur bekannt geworden, ein Konzept der Kritik an der Industrialisierung beziehungsweise an Materialismus und Urbanisierung, die mit dem Leitmotto Zurück zur Natur“ charakterisiert werden könnte. Seit 1963 wird jährlich die Heinrich-Tessenow-Medaille verliehen,„im Gedenken an den großen Architekten, Baumeister und Hochschullehrer, europäischen Persönlichkeiten zuerkannt, die Hervorragendes in der architektonischen, handwerklichen und industriellen Formgebung und in der Erziehung zu Wohn- und Baukultur geleistet haben, oder deren Wirken dem vielseitigen Lebenswerk Heinrich Tessenows entspricht“, wie es auf der website der Tessenow-Gesellschaft heißt. In diesem Jahr ist der bedeutende und auch hierzulande prominente Soziologe Richard Sennet (* 1943) zum Preisträger gewählt worden. Heinz Bude, Soziologie-Professor in Kassel, hat die lesenswerte Laudatio gehalten, die am Wochenende in der TAZ veröffentlicht wurde:„Vielleicht kann man das Werk von Richard Sennett als Antwort auf eine„geistige Situation der Zeit“ nehmen, wo wir begreifen wollen, was uns in dieser Periode des Flexiblen Kapitalismus ergriffen hat, die mit einem Schlag vergangen zu sein scheint. Wir fragen uns, wozu wir uns durch„Plastikwörter“ wie Globalisierung, Digitalisierung und Individualisierung haben verleiten lassen. Natürlich hat sich dadurch, dass wir relativ mühelos überall hinreisen können, dass wir Sushi, Yoga und Buddhas ins Normalprogramm der Lebensführung aufgenommen haben, dass wir sofort über Bilder von jedem Erdbeben verfügen können, unsere Welt verändert. Natürlich hat uns das Internet ganz andere Kommunikationsmöglichkeiten eröffnet. Und natürlich wollen wir alle einzigartige und unaustauschbare Individuen sein und uns nicht mehr als Repräsentanten von Großgruppen ansprechen lassen. Aber die Tatsache, dass sich uns durch den globalen Massentourismus, den globalen Massenkonsum und die globalen Massenmedien viele neue Türen öffnen, kann doch nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir immer nur durch eine einzige gehen können. Die Tatsache, dass wir uns über Facebook viele neue Freunde ansichtig machen können, wirft andererseits die Frage auf, was ein wirklicher Freund ist. Hilft uns Richard Sennett, wenn sich heute die Frage nach Lebensformen der Existenz, der Freundschaft und der Treue stellt? Ich glaube, ja, und ich will das an drei Begriffen zeigen, die sich durch das Werk von Richard Sennett ziehen: dem Begriff des Charakters, dem Begriff des Respekts und dem des Handwerks“
Zum vollständigen Text
 Schon im November wurde im systemagazin das Lehrbuch zur psychosozialen Arbeit von Sigrid Haselmann, Psychologie-Professorin an der Hochschule Neubrandenburg, besprochen. In diesem praxisorientiertem Handbuch wird mit Bezug auf die psychosoziale Arbeit im Arbeitsfeld Psychiatrie neben der subjektorientierten Sozialpsychiatrie die systemische Perspektive mit ihren anders gearteten Denk- und Vorgehensweisen vorgestellt. Nun haben sich zur Rezension von Anja Boltin noch zwei weitere Rezensionen von Jürgen Leuther und Gerhard Dieter Ruf hinzugesellt, was den Lesern einen umfassenden Eindruck vom besprochenen Buch erlaubt.
Schon im November wurde im systemagazin das Lehrbuch zur psychosozialen Arbeit von Sigrid Haselmann, Psychologie-Professorin an der Hochschule Neubrandenburg, besprochen. In diesem praxisorientiertem Handbuch wird mit Bezug auf die psychosoziale Arbeit im Arbeitsfeld Psychiatrie neben der subjektorientierten Sozialpsychiatrie die systemische Perspektive mit ihren anders gearteten Denk- und Vorgehensweisen vorgestellt. Nun haben sich zur Rezension von Anja Boltin noch zwei weitere Rezensionen von Jürgen Leuther und Gerhard Dieter Ruf hinzugesellt, was den Lesern einen umfassenden Eindruck vom besprochenen Buch erlaubt. 

 Im November
Im November 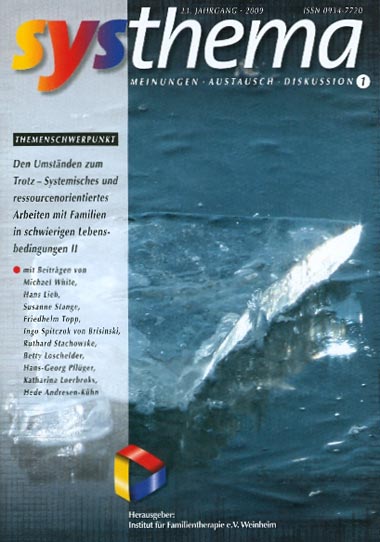

 Nach langen Jahren der Pause ist in diesem Jahr endlich wieder eine Rentenerhöhung in Sicht. Rund 20 Millionen Rentner in Deutschland können sich freuen. Besonders erfreulich ist die Tatsache, dass sich Rentner ab sofort die Rente bis zu einem Betrag von 20 Millionen Euro im Voraus auszahlen lassen können. Einer, der diese Gelegenheit als erster beim Schopf ergriffen hat, ist Klaus Z. (Foto: Deutsche Post) aus Köln. Der Frühpensionär und ehemalige Postbote, dem das Schicksal in den vergangenen Monaten schwere Prüfungen auferlegt hat, kann sein Glück noch gar nicht fassen:„Nachdem meine Ersparnisse durch die vielen zu begleichende Rechnungen fast aufgebraucht waren, kann ich die 20 Millionen wirklich gut gebrauchen. Immerhin hat die Regierung jahrelang nichts für uns Rentner getan. Da war es angebracht, mal ein Zeichen zu setzen“. Aber Klaus Z. möchte seinen Reichtum nicht alleine genießen und hat sich deshalb die Einrichtung einer kleinen Familien-Stiftung vorgenommen.„Ideen habe ich schon genug“, verrät der immer noch dynamisch wirkende Pensionär verschmitzt,„nun kann ich sie endlich auch verwirklichen“. Ein Projekt, das dem reisefreudigen Postler besonders am Herzen liegt, sind Reiseführer etwas anderer Art. Als erstes Buch der Reihe„Mit meiner Rente unterwegs“ ist ein Band über sein Lieblingsurlaubsland Liechtenstein geplant. Der Der Titel steht für ihn schon fest:„Seid umschlungen, Millionen. Stiften gehn mit Klaus Z.!“ We wish you a pleasant journey
Nach langen Jahren der Pause ist in diesem Jahr endlich wieder eine Rentenerhöhung in Sicht. Rund 20 Millionen Rentner in Deutschland können sich freuen. Besonders erfreulich ist die Tatsache, dass sich Rentner ab sofort die Rente bis zu einem Betrag von 20 Millionen Euro im Voraus auszahlen lassen können. Einer, der diese Gelegenheit als erster beim Schopf ergriffen hat, ist Klaus Z. (Foto: Deutsche Post) aus Köln. Der Frühpensionär und ehemalige Postbote, dem das Schicksal in den vergangenen Monaten schwere Prüfungen auferlegt hat, kann sein Glück noch gar nicht fassen:„Nachdem meine Ersparnisse durch die vielen zu begleichende Rechnungen fast aufgebraucht waren, kann ich die 20 Millionen wirklich gut gebrauchen. Immerhin hat die Regierung jahrelang nichts für uns Rentner getan. Da war es angebracht, mal ein Zeichen zu setzen“. Aber Klaus Z. möchte seinen Reichtum nicht alleine genießen und hat sich deshalb die Einrichtung einer kleinen Familien-Stiftung vorgenommen.„Ideen habe ich schon genug“, verrät der immer noch dynamisch wirkende Pensionär verschmitzt,„nun kann ich sie endlich auch verwirklichen“. Ein Projekt, das dem reisefreudigen Postler besonders am Herzen liegt, sind Reiseführer etwas anderer Art. Als erstes Buch der Reihe„Mit meiner Rente unterwegs“ ist ein Band über sein Lieblingsurlaubsland Liechtenstein geplant. Der Der Titel steht für ihn schon fest:„Seid umschlungen, Millionen. Stiften gehn mit Klaus Z.!“ We wish you a pleasant journey

 Nachdem vorgestern an dieser Stelle bereits ein Vorabdruck aus C. Otto Scharmers„Theorie U“ zu lesen war, gibt es heute noch einen kleinen Nachschlag. Sein Text über„Presencing als evolutionäre Grammatik und soziale Technik für die Erschliessung des vierten Feldes sozialen Werdens“ ist eine Übersetzung der Einführung der englischen Fassung seines Buches und in der Zeitschrift„Gesprächspsychotherapie und Personenzentrierte Beratung“ 4/2007 erschienen:„Indem ich Sie zu diesem Feldgang einlade, werde ich mich auf drei Methoden beziehen bzw. sie einsetzen: Phänomenologie, Dialog und kollaborative Aktionsforschung. Alle drei beziehen sich auf den gleichen Kern: die wechselseitig verbundene Qualität von Wissen, Wirklichkeit und Selbst. Alle drei folgen dem Diktum von Kurt Lewin, dem Begründer der Aktionsforschung, dessen These lautete: Du hast ein System nicht verstanden, solange Du es nicht verändern kannst. Jede der drei Methoden verfolgt einen unterschiedlichen Schwerpunkt: Phänomenologie setzt an der Perspektive der 1. Person (dem individuellen Bewusstsein); Dialog an der Perspektive der 2. Person (Felder der Konversation); und Aktionsforschung an der Perspektive der 3. Person (Hervorbringung von neuen institutionellen Mustern und Strukturen)“
Nachdem vorgestern an dieser Stelle bereits ein Vorabdruck aus C. Otto Scharmers„Theorie U“ zu lesen war, gibt es heute noch einen kleinen Nachschlag. Sein Text über„Presencing als evolutionäre Grammatik und soziale Technik für die Erschliessung des vierten Feldes sozialen Werdens“ ist eine Übersetzung der Einführung der englischen Fassung seines Buches und in der Zeitschrift„Gesprächspsychotherapie und Personenzentrierte Beratung“ 4/2007 erschienen:„Indem ich Sie zu diesem Feldgang einlade, werde ich mich auf drei Methoden beziehen bzw. sie einsetzen: Phänomenologie, Dialog und kollaborative Aktionsforschung. Alle drei beziehen sich auf den gleichen Kern: die wechselseitig verbundene Qualität von Wissen, Wirklichkeit und Selbst. Alle drei folgen dem Diktum von Kurt Lewin, dem Begründer der Aktionsforschung, dessen These lautete: Du hast ein System nicht verstanden, solange Du es nicht verändern kannst. Jede der drei Methoden verfolgt einen unterschiedlichen Schwerpunkt: Phänomenologie setzt an der Perspektive der 1. Person (dem individuellen Bewusstsein); Dialog an der Perspektive der 2. Person (Felder der Konversation); und Aktionsforschung an der Perspektive der 3. Person (Hervorbringung von neuen institutionellen Mustern und Strukturen)“ In Heft 2/2008 des Kontext erschien zum 70. Geburtstag von Wilhelm Rotthaus ein ausführliches Gespräch, das Wilhelm Rotthaus mit Tom Levold geführt hat. Auf der website der DGSF kann das Gespräch als Datei heruntergeladen werden. Zur aktuellen Situation um die Anerkennung der Systemischen Therapie sagt Wilhelm Rotthaus:„Ich glaube, wir haben angesichts der Tatsache, dass systemische Gedanken und Methoden zunehmend von anderen Verfahren vereinnahmt werden, richtig damit gehandelt, dem Wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie die Expertise vorzulegen. Das ist unser Versuch, mit den anderen Verfahren auf eine gleichberechtigte Ebene gehen zu können. Schließlich haben wir etwas zu bieten, nicht nur eine bestechende Methodenvielfalt, sondern vor allem auch sehr eigenständiges Theoriekonzept, aus dem sich für die Therapie ungemein förderliche Haltungen, Einstellungen und Beziehungsgestaltungen ableiten. Und ich glaube, dass unsere Doppelstrategie, einmal den Klageweg zu beschreiten, den die SG ja nicht mitgemacht hat, und andererseits die Expertise dem Wissenschaftlichen Beirat vorzulegen, richtig ist. Ich sehe aber auch Gefahren. Angenommen, wir werden eine Anerkennung durch den Beirat erreichen und uns entschließen, den nächsten Schritt zum G-BA zu gehen, dann besteht natürlich eine Gefahr, dass wir uns zu sehr an das dominierende verhaltenstherapeutische Modell anschließen könnten, das sich ja im Methodenpapier und den neuen Verfahrensregeln des Beirats und des G-BA durchgesetzt hat wobei mir völlig unverständlich ist, dass die Psychoanalytiker dazu geschwiegen haben; ob das eine kluge Strategie war, das so laufen zu lassen, bezweifle ich. Auf jeden Fall werden wir darauf aufpassen müssen, wie wir unsere Essentials bewahren können und trotzdem mit diesem System irgendwie in Kooperation kommen“
In Heft 2/2008 des Kontext erschien zum 70. Geburtstag von Wilhelm Rotthaus ein ausführliches Gespräch, das Wilhelm Rotthaus mit Tom Levold geführt hat. Auf der website der DGSF kann das Gespräch als Datei heruntergeladen werden. Zur aktuellen Situation um die Anerkennung der Systemischen Therapie sagt Wilhelm Rotthaus:„Ich glaube, wir haben angesichts der Tatsache, dass systemische Gedanken und Methoden zunehmend von anderen Verfahren vereinnahmt werden, richtig damit gehandelt, dem Wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie die Expertise vorzulegen. Das ist unser Versuch, mit den anderen Verfahren auf eine gleichberechtigte Ebene gehen zu können. Schließlich haben wir etwas zu bieten, nicht nur eine bestechende Methodenvielfalt, sondern vor allem auch sehr eigenständiges Theoriekonzept, aus dem sich für die Therapie ungemein förderliche Haltungen, Einstellungen und Beziehungsgestaltungen ableiten. Und ich glaube, dass unsere Doppelstrategie, einmal den Klageweg zu beschreiten, den die SG ja nicht mitgemacht hat, und andererseits die Expertise dem Wissenschaftlichen Beirat vorzulegen, richtig ist. Ich sehe aber auch Gefahren. Angenommen, wir werden eine Anerkennung durch den Beirat erreichen und uns entschließen, den nächsten Schritt zum G-BA zu gehen, dann besteht natürlich eine Gefahr, dass wir uns zu sehr an das dominierende verhaltenstherapeutische Modell anschließen könnten, das sich ja im Methodenpapier und den neuen Verfahrensregeln des Beirats und des G-BA durchgesetzt hat wobei mir völlig unverständlich ist, dass die Psychoanalytiker dazu geschwiegen haben; ob das eine kluge Strategie war, das so laufen zu lassen, bezweifle ich. Auf jeden Fall werden wir darauf aufpassen müssen, wie wir unsere Essentials bewahren können und trotzdem mit diesem System irgendwie in Kooperation kommen“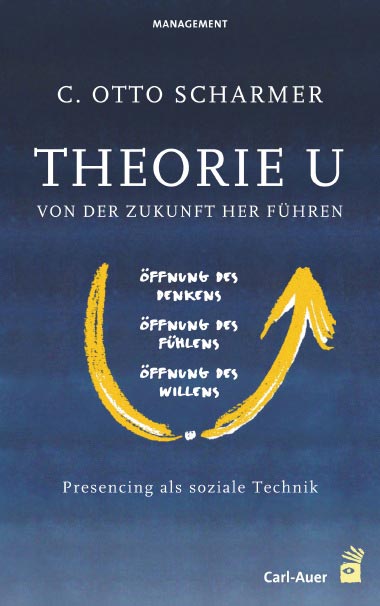
 Wer einen Blick werfen möchte auf die Untiefen fortgeschrittener Merkantilisierung unserer Profession, dürfte sich für ein Interview interessieren, dass Scott Miller vom Chicagoer Institute for the Study of Therapeutic Change (ISTC) im Jahr 2007 Jim Walt gegeben hat, ehemals Vorsitzender der Californian Association of Marital and Family Therapists (CAMFT), emeritierter Psychologie-Professor an der kalifornischen John F. Kennedy University. In diesem Gespräch skizzieren beide eine Situation in den USA, die darauf hinauszulaufen scheint, dass die meisten derjenigen, die zurzeit noch ihr Geld mit professionellen psychosozialen Hilfen verdienen, es bald nicht mehr können. Ungeachtet der konsistenten Forschungsergebnisse zur Psychotherapie, dass diese wirkt, gaben zwei Drittel der Befragten als Antwort auf die Frage, weshalb sie keine Therapie aufgesucht hätten, an, dass sie deren Wirksamkeit bezweifelten. Zweifel an der Wirksamkeit von etwas werden jedoch vermutlich erst dann zu einem schlagkräftigen Argument, wenn wie ebenfalls erhoben die Einschätzung als„zu teuer“ hinzukommt. Hier nun setzen offenbar die üblichen Marktmechanismen an. Die fortschreitende Verwertung von Therapie als Ware unterliegt dem Preiskalkül. Preisgestaltung wiederum funktioniert nach dem Aldi-Prinzip und man könnte sich fragen, warum es TherapeutInnen anders gehen sollte als, sagen wir, Milchbauern. Wie gesagt, nur für den Fall, dass Therapie oder allgemein professionelle psychosoziale Hilfen, sich in erster Linie als Warenwert zu bewähren hätten. Schon klar, dass dies ein Dilemma bedeutet, wenn man sich nicht im Elfenbeinturm (oder Wolkenkuckucksheim) einrichten möchte. Umso bemerkenswerter, dass Scott Miller nach wie vor davon überzeugt ist, dass das„Hören auf die KlientInnen“ einen (für ihn: den) Ausweg darstellt. Er berichtet von Evaluationsstudien, nach denen das Ergebnis um 65% allein dadurch verbessert werden konnte, dass konsequent das Feedback der KlientInnen zum Maßstab gemacht wurde unabhängig von der theoretischen Position der TherapeutInnen. Vier Merkmale zeichneten das Beisteuern von professionellen HelferInnen in erfolgreichen Therapien aus: sie blieben flexibel, sie wehrten Feedback nicht ab, sie veränderten das Vorgehen so lange, bis die KlientInnen darauf positiv ansprachen und schließlich: sie zögerten nicht, andere Hilfen als angemessener zu empfehlen, wenn sie auf die beschriebene Weise nicht zu einer tragfähigen Beziehung kamen.
Wer einen Blick werfen möchte auf die Untiefen fortgeschrittener Merkantilisierung unserer Profession, dürfte sich für ein Interview interessieren, dass Scott Miller vom Chicagoer Institute for the Study of Therapeutic Change (ISTC) im Jahr 2007 Jim Walt gegeben hat, ehemals Vorsitzender der Californian Association of Marital and Family Therapists (CAMFT), emeritierter Psychologie-Professor an der kalifornischen John F. Kennedy University. In diesem Gespräch skizzieren beide eine Situation in den USA, die darauf hinauszulaufen scheint, dass die meisten derjenigen, die zurzeit noch ihr Geld mit professionellen psychosozialen Hilfen verdienen, es bald nicht mehr können. Ungeachtet der konsistenten Forschungsergebnisse zur Psychotherapie, dass diese wirkt, gaben zwei Drittel der Befragten als Antwort auf die Frage, weshalb sie keine Therapie aufgesucht hätten, an, dass sie deren Wirksamkeit bezweifelten. Zweifel an der Wirksamkeit von etwas werden jedoch vermutlich erst dann zu einem schlagkräftigen Argument, wenn wie ebenfalls erhoben die Einschätzung als„zu teuer“ hinzukommt. Hier nun setzen offenbar die üblichen Marktmechanismen an. Die fortschreitende Verwertung von Therapie als Ware unterliegt dem Preiskalkül. Preisgestaltung wiederum funktioniert nach dem Aldi-Prinzip und man könnte sich fragen, warum es TherapeutInnen anders gehen sollte als, sagen wir, Milchbauern. Wie gesagt, nur für den Fall, dass Therapie oder allgemein professionelle psychosoziale Hilfen, sich in erster Linie als Warenwert zu bewähren hätten. Schon klar, dass dies ein Dilemma bedeutet, wenn man sich nicht im Elfenbeinturm (oder Wolkenkuckucksheim) einrichten möchte. Umso bemerkenswerter, dass Scott Miller nach wie vor davon überzeugt ist, dass das„Hören auf die KlientInnen“ einen (für ihn: den) Ausweg darstellt. Er berichtet von Evaluationsstudien, nach denen das Ergebnis um 65% allein dadurch verbessert werden konnte, dass konsequent das Feedback der KlientInnen zum Maßstab gemacht wurde unabhängig von der theoretischen Position der TherapeutInnen. Vier Merkmale zeichneten das Beisteuern von professionellen HelferInnen in erfolgreichen Therapien aus: sie blieben flexibel, sie wehrten Feedback nicht ab, sie veränderten das Vorgehen so lange, bis die KlientInnen darauf positiv ansprachen und schließlich: sie zögerten nicht, andere Hilfen als angemessener zu empfehlen, wenn sie auf die beschriebene Weise nicht zu einer tragfähigen Beziehung kamen.