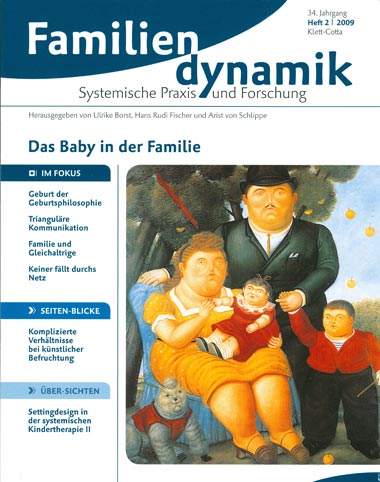Im November 2007 fand am Maudsley Hospital in London eine internationale Tagung zum Thema„Familientherapie des Substanzmissbrauches über die Lebensspanne“ statt, veranstaltet von der Sektion Familientherapie am dortigen Institut für Psychiatrie in Verbindung mit dem Journal of Family Therapy, das nun auch die Ergebnisse dieser Tagung publiziert hat. Altmeister in Fragen Sucht und Familie Peter Steinglass, der sich schon in den 70er Jahren mit diesem Thema beschäftigt hat, gehört mit Jenny Corless und K.A.H. Mirza zu den Gastherausgebern. In ihrem Editorial halten sie fest, dass das Thema des süchtigen Drogengebrauches nach wie vor ein marginales Thema in der Familientherapie/systemischen Therapie darstellt, obwohl es sich mittlerweile um einen ausgereiften Forschungs- und Praxisbereich handele. Neben allen offenen Fragen, die in diesem Heft auch angesprochen wird, werden als positives Ergebnis einer familienorientierten Suchtbehandlung hervorgehoben:„- the value of working therapeutically with whole families and systems rather than with the substance-misusing person alone; – a therapeutic stance that incorporates a non-blaming, collaborative approach rather than a hierarchical, confrontational style; – a recognition that clients can have multiple drug-related change goals, and while abstinence may be top of the list, reduced use and harm minimization activities can bring very worthwhile gains; – an expansion of outcome measures of success to include the psychosocial functioning of non-using family members as well as the substance misuser; – an awareness of the value of relationships, both within the family and via social networks, critical sources of support and positive reinforcement for therapeutic change; – an appreciation of the need to adapt the therapeutic approach to fit both family values and cultural beliefs of the larger community within which the family is embedded; – a sense of humility about the complexity and multi-deterministic causality of addictive behaviours along with the tenacity necessary to work constructively with families around managing chronic conditions like substance misuse disorders“
Zu den vollständigen abstracts

 In zwei Jahren, so heißt es, werde die Hälfte der Erdbevölkerung in Städten leben. New York war vor 50 Jahren die einzige Stadt der Erde mit mehr als 10 Millionen Bewohnern. Heute gibt es bereits 19 Mega-Cities diesen Ausmaßes. In einem Aufsatz für die C.A.P.-News, einem Online-Journal des Centrums für angewandte Politikforschung, schreibt Chloé Lachauer, es gehe in der Konsequenz darum, für die Zukunftsgesellschaft Lösungsansätze zu finden, mit diesen neuen Formen der Stadtlandschaften ökologisch, gesellschaftspolitisch und ökonomisch fertig zu werden. Bezeichnenderweise hat die größte Rückversicherung der Welt, die Münchner Rück, angesichts der neuesten Prognosen der Vereinten Nationen und anlässlich der UN-Konferenz für Katastrophenbegrenzung jüngst eine Studie publiziert, die die Mega-Cities der Zukunft als hoch komplexe Großrisiken betiteln, die nicht mehr versicherbar seien. Nicht nur ökologische Katastrophen werden vorausgesehen, sondern auch anarchische Gewaltzustände in den Städten, und eine Art Urban Sprawl im Sinne einer riesenhaften Slumisierung (Foto:
In zwei Jahren, so heißt es, werde die Hälfte der Erdbevölkerung in Städten leben. New York war vor 50 Jahren die einzige Stadt der Erde mit mehr als 10 Millionen Bewohnern. Heute gibt es bereits 19 Mega-Cities diesen Ausmaßes. In einem Aufsatz für die C.A.P.-News, einem Online-Journal des Centrums für angewandte Politikforschung, schreibt Chloé Lachauer, es gehe in der Konsequenz darum, für die Zukunftsgesellschaft Lösungsansätze zu finden, mit diesen neuen Formen der Stadtlandschaften ökologisch, gesellschaftspolitisch und ökonomisch fertig zu werden. Bezeichnenderweise hat die größte Rückversicherung der Welt, die Münchner Rück, angesichts der neuesten Prognosen der Vereinten Nationen und anlässlich der UN-Konferenz für Katastrophenbegrenzung jüngst eine Studie publiziert, die die Mega-Cities der Zukunft als hoch komplexe Großrisiken betiteln, die nicht mehr versicherbar seien. Nicht nur ökologische Katastrophen werden vorausgesehen, sondern auch anarchische Gewaltzustände in den Städten, und eine Art Urban Sprawl im Sinne einer riesenhaften Slumisierung (Foto:  Die Verbindung von Bioethik und Pädagogik spielt in den momentanen Diskursen zur Reproduktionstechnologie keine zentrale Rolle. Alex Aßmann, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Mainz und neuer systemagazin-Autor, hat sich aber in seinem„Plädoyer für eine Debatte“ über Bioethik Posthumanismus Pädagogik genau unter diesem Gesichtspunkt mit der Frage auseinandergesetzt:„Wollen wir wirklich, dass der Nachwuchs so gerät, wie wir ihn uns gewünscht hatten?“. In seinem Originalbeitrag für die
Die Verbindung von Bioethik und Pädagogik spielt in den momentanen Diskursen zur Reproduktionstechnologie keine zentrale Rolle. Alex Aßmann, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Mainz und neuer systemagazin-Autor, hat sich aber in seinem„Plädoyer für eine Debatte“ über Bioethik Posthumanismus Pädagogik genau unter diesem Gesichtspunkt mit der Frage auseinandergesetzt:„Wollen wir wirklich, dass der Nachwuchs so gerät, wie wir ihn uns gewünscht hatten?“. In seinem Originalbeitrag für die  „He was a guru to the Beatles and a brilliant psychiatrist who redefined the family but his own children remember only drink, adultery and violence“. Russell Miller hat in der Ausgabe der Online-Times einen so eindrucksvollen wie deprimierenden Artikel über den Aufstieg – und vor allem den Abstieg von Ronald D. Laing geschrieben, der zur Lektüre empfohlen sei. Laing, ein schottischer Psychiater und Psychoanalytiker, der 1927 in Glasgow geboren wurde, wurde in den 60er Jahren zu einer der bekanntesten Führer der Anti-Psychiatrie-Bewegung. Seine Arbeiten zum Zusammenhang von familiärer Interaktion und Schizophrenie wurden auch in der Familientherapie-Szene rezipiert, so etwa sein Aufsatz„
„He was a guru to the Beatles and a brilliant psychiatrist who redefined the family but his own children remember only drink, adultery and violence“. Russell Miller hat in der Ausgabe der Online-Times einen so eindrucksvollen wie deprimierenden Artikel über den Aufstieg – und vor allem den Abstieg von Ronald D. Laing geschrieben, der zur Lektüre empfohlen sei. Laing, ein schottischer Psychiater und Psychoanalytiker, der 1927 in Glasgow geboren wurde, wurde in den 60er Jahren zu einer der bekanntesten Führer der Anti-Psychiatrie-Bewegung. Seine Arbeiten zum Zusammenhang von familiärer Interaktion und Schizophrenie wurden auch in der Familientherapie-Szene rezipiert, so etwa sein Aufsatz„
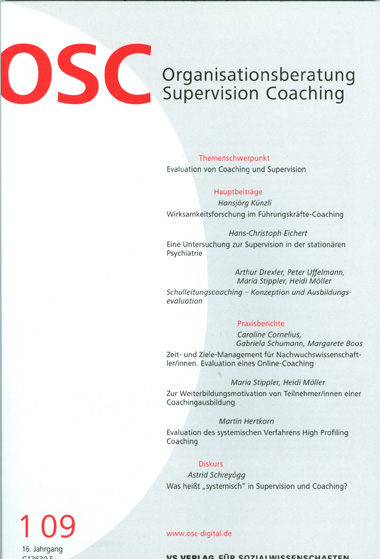
 In einem äußerst interessanten Aufsatz, der in der neuen Ausgabe des
In einem äußerst interessanten Aufsatz, der in der neuen Ausgabe des 

 Jens Daniel Peter, Jg. 1975 ist Diplom-Psychologe, Diplom-Musiktherapeut, systemischer Familientherapeut, Supervisor (IGST) sowie Pianist und Komponist. Er arbeitet in einer Erziehungsberatungsstelle und als Supervisor und ist Lehrtherapeut der Mannheimer Gesellschaft für systemische Therapie, Supervision und Weiterbildung. Auf der Website der MAGST ist seine ausgesprochen kritische und gründliche Auseinandersetzung mit Humberto Maturanas Konzept der autopoietischen Systeme und seiner Rezeption hierzulande von ihm zu finden, die die Lektüre lohnt: „Wenn Maturana behauptet, Repräsentationen könnten nicht existieren, weil das Nervensystem eben nur mit internen Zuständen umgeht, dann übersieht er dabei, daß Repräsentation von etwas eine zweistellige Relation ist. Das Vorliegen einer solchen Relation kann also per definitionem nur von einem Beobachter festgestellt werden, der Zugang zu beiden Relata (System und Umwelt) hat. Diese Beschreibung dann als verzerrt zurückzuweisen, eben weil sie von einem Beobachter vorgenommen wurde, übersieht, daß eine Beschreibung aus Sicht des Gehirns vollkommen sinnlos ist. Gleichzeitig privilegiert Maturana dadurch seine eigene Beschreibung allen anderen gegenüber als die zutreffendere ohne Gründe dafür anzugeben oder seine Argumentation zu relativieren; denn auch Maturana befindet sich nur in einer verzerrenden Beobachterposition“
Jens Daniel Peter, Jg. 1975 ist Diplom-Psychologe, Diplom-Musiktherapeut, systemischer Familientherapeut, Supervisor (IGST) sowie Pianist und Komponist. Er arbeitet in einer Erziehungsberatungsstelle und als Supervisor und ist Lehrtherapeut der Mannheimer Gesellschaft für systemische Therapie, Supervision und Weiterbildung. Auf der Website der MAGST ist seine ausgesprochen kritische und gründliche Auseinandersetzung mit Humberto Maturanas Konzept der autopoietischen Systeme und seiner Rezeption hierzulande von ihm zu finden, die die Lektüre lohnt: „Wenn Maturana behauptet, Repräsentationen könnten nicht existieren, weil das Nervensystem eben nur mit internen Zuständen umgeht, dann übersieht er dabei, daß Repräsentation von etwas eine zweistellige Relation ist. Das Vorliegen einer solchen Relation kann also per definitionem nur von einem Beobachter festgestellt werden, der Zugang zu beiden Relata (System und Umwelt) hat. Diese Beschreibung dann als verzerrt zurückzuweisen, eben weil sie von einem Beobachter vorgenommen wurde, übersieht, daß eine Beschreibung aus Sicht des Gehirns vollkommen sinnlos ist. Gleichzeitig privilegiert Maturana dadurch seine eigene Beschreibung allen anderen gegenüber als die zutreffendere ohne Gründe dafür anzugeben oder seine Argumentation zu relativieren; denn auch Maturana befindet sich nur in einer verzerrenden Beobachterposition“