Am Wochenende gehört Papi mir, hieß es seinerzeit, ebenso kraftvoll wie gendermäßig unschuldig, als es um das Durchsetzen kürzerer Wochenarbeitszeiten ging. Die Zeiten ändern sich und mittlerweile geht der Trend wieder in Richtung längerer WArbZ. In einer aktuellen Studie der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin untersuchen A. Wirtz, F. Nachreiner, B. Beermann, F. Brenscheidt, und A. Siefer die Dauer der WArbZ im Hinblick auf gesundheitliche Beeinträchtigungen [baua, 06.April 2009]. Die AutorInnen konstatieren, dass aktuelle Diskussionen um Arbeitszeitverlängerungen sich oft ausschließlich an vermeintlich wirtschaftlichen Kriterien [orientieren], ohne dabei gesundheitliche Effekte für die Beschäftigten zu berücksichtigen. Die Datenbasis bilden vier nationale und europäische Untersuchungen der Jahre 2002 bis 2008. Am Beispiel von Schlafstörungen, Rückenschmerzen, Magen- und Herzbeschwerden lassen sich eindeutige Hinweise auf eine Zunahme der Beschwerden bei zunehmender WarbZ finden. Es finden sich auch Hinweise zum Healthy-Worker-Effect, der das Phänomen beschreibt, dass Ältere und Personen in sehr ungünstigen Arbeitsbedingungen oft verhältnismäßig wenig gesundheitliche Beschwerden aufweisen. Die Erklärung dafür ist, dass sie eine Überlebenspopulation derjenigen bilden, die derartige Arbeitsbedingungen aushalten können, wohingegen die gesundheitlich beeinträchtigten Personen bereits aus der Erwerbstätigkeit ausgeschieden bzw. in andere Arbeitsbedingungen gewechselt sind. Die AutorInnen stellen in ihrer Zusammenfassung heraus: Kommen zu den langen Arbeitszeiten weitere potentiell ungünstige Bedingungen wie Schichtarbeit, variable Arbeitszeiten, schlechte Planbarkeit der Arbeitszeit oder Arbeit an Abenden oder am Wochenende hinzu, so werden von den Erwerbstätigen insgesamt häufiger Beschwerden berichtet. Ebenso erhöhen hohe körperliche und psychische Anforderungen das Risiko gesundheitlicher Beeinträchtigungen, insbesondere in Kombination mit langen und/oder in der Lage versetzten Arbeitszeiten. Insgesamt lassen sich die Zusammenhänge zwischen der Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit und gesundheitlichen Beeinträchtigungen anhand der Ergebnisse aus vier untersuchten Stichproben gegenseitig stützen und somit absichern, und weiter: Die Feststellung, dass längere Arbeitszeiten mit einer deutlichen Erhöhung des Beeinträchtigungsrisikos zusammenhängen, kann als gesichert und generalisierbar betrachtet werden. Zur Studie von Wirtz et al. geht es hier
14. Mai 2009
von Wolfgang Loth
Keine Kommentare

 „Früher oder später macht jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter diese Erfahrung: Ergebnisse einer Arbeit, am Anfang noch mit Nachdruck in Auftrag gegeben, sind am Ende nicht mehr gefragt oder verschwinden unbeachtet. Für vergebliche Auftragserledigungen kann es viele Gründe geben. Das Interesse an einem Projekt wird von anderen Interessen überholt und versandet. Der Widerstand gegen die Ausführung erweist sich als zu hoch und die Unterstützung in der Organisation als zu gering. Woanders wurden Entscheidungen gefällt, die die Ausführung obsolet machen. Die Beauftragung war lediglich ein politisch-taktischer Zug und inhaltlich beliebig. Jemand sollte beschäftigt werden, weil es z.Zt. sonst keine Verwendung für ihn gibt. Die Führung hat gewechselt und bezieht sich nicht mehr auf vorangegangene Absprachen. Vergebliche Arbeit kommt vor in Organisationen und ist nicht zu vermeiden. Im Gegenteil, Aufgabenteilung und Handeln in der Hierarchie setzen auf Unabhängigkeit und Beweglichkeit. Die Autonomie der Organisation entsteht genau dadurch, dass nicht jede Person zu jedem Zeitpunkt über alles informiert werden und mitentscheiden muss. Aber was passiert, dass jemand mit ihren oder seiner Aufgabe ‚abgehängt‘ wird?“ Edelgard Struß hat sich auf ihre gewohnt kluge, perspektivenreiche und elegante Art und Weise mit diesem Thema beschäftigt und einen brillianten Originalbeitrag für die
„Früher oder später macht jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter diese Erfahrung: Ergebnisse einer Arbeit, am Anfang noch mit Nachdruck in Auftrag gegeben, sind am Ende nicht mehr gefragt oder verschwinden unbeachtet. Für vergebliche Auftragserledigungen kann es viele Gründe geben. Das Interesse an einem Projekt wird von anderen Interessen überholt und versandet. Der Widerstand gegen die Ausführung erweist sich als zu hoch und die Unterstützung in der Organisation als zu gering. Woanders wurden Entscheidungen gefällt, die die Ausführung obsolet machen. Die Beauftragung war lediglich ein politisch-taktischer Zug und inhaltlich beliebig. Jemand sollte beschäftigt werden, weil es z.Zt. sonst keine Verwendung für ihn gibt. Die Führung hat gewechselt und bezieht sich nicht mehr auf vorangegangene Absprachen. Vergebliche Arbeit kommt vor in Organisationen und ist nicht zu vermeiden. Im Gegenteil, Aufgabenteilung und Handeln in der Hierarchie setzen auf Unabhängigkeit und Beweglichkeit. Die Autonomie der Organisation entsteht genau dadurch, dass nicht jede Person zu jedem Zeitpunkt über alles informiert werden und mitentscheiden muss. Aber was passiert, dass jemand mit ihren oder seiner Aufgabe ‚abgehängt‘ wird?“ Edelgard Struß hat sich auf ihre gewohnt kluge, perspektivenreiche und elegante Art und Weise mit diesem Thema beschäftigt und einen brillianten Originalbeitrag für die 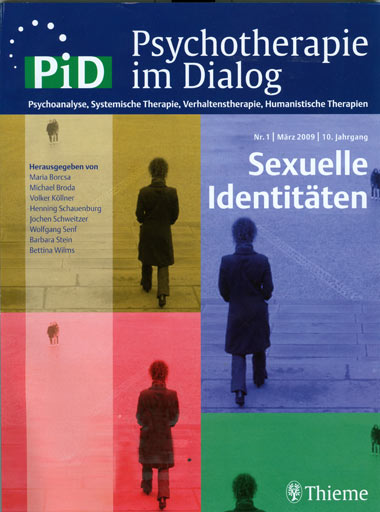
 Heute vor 85 Jahren, am 9. Mai 1924, wurde Harold A. Goolishian in Lowell, Massachusetts geboren. Goolishian, der am 10. November 1991 in Galveston, Texas, im Alter von 67 Jahren starb, war ein Pionier der Familientherapie und langjähriger Inhaber des Lehrstuhls für Klinische Psychologie an der Medizinischen Fakultät Galveston der University of Texas. Gemeinsam mit Harlene Anderson und Paul Dell gründete er 1977 das das Galveston Family Institute in Texas. Sein und Harlene Andersons Konzept des„Problemdeterminierten Systems“, das hierzulande vor allem von Kurt Ludewig bekannt gemacht worden ist, hat eine wichtige Rolle in der Entwicklung der Systemischen Therapie gespielt. Im Internet sind auf einer norwegischen website sieben Videos anzusehen, die der norwegische Psychotherapeut Steven Balmbra von einem Seminar mit Harry Goolishian im Januar 1988 gemacht hat, als dieser eine Woche mit Vorträgen und Workshops im Child and Adolescent Department des Nordland Psychiatric Hospital in Bodø, Nordnorwegen, zu Gast war. Insgesamt dauern die Videos fast 3,5 Stunden und geben einen Einblick nicht nur in die theoretischen Konzepte Goolishians, sondern auch seiner praktischen Arbeit!
Heute vor 85 Jahren, am 9. Mai 1924, wurde Harold A. Goolishian in Lowell, Massachusetts geboren. Goolishian, der am 10. November 1991 in Galveston, Texas, im Alter von 67 Jahren starb, war ein Pionier der Familientherapie und langjähriger Inhaber des Lehrstuhls für Klinische Psychologie an der Medizinischen Fakultät Galveston der University of Texas. Gemeinsam mit Harlene Anderson und Paul Dell gründete er 1977 das das Galveston Family Institute in Texas. Sein und Harlene Andersons Konzept des„Problemdeterminierten Systems“, das hierzulande vor allem von Kurt Ludewig bekannt gemacht worden ist, hat eine wichtige Rolle in der Entwicklung der Systemischen Therapie gespielt. Im Internet sind auf einer norwegischen website sieben Videos anzusehen, die der norwegische Psychotherapeut Steven Balmbra von einem Seminar mit Harry Goolishian im Januar 1988 gemacht hat, als dieser eine Woche mit Vorträgen und Workshops im Child and Adolescent Department des Nordland Psychiatric Hospital in Bodø, Nordnorwegen, zu Gast war. Insgesamt dauern die Videos fast 3,5 Stunden und geben einen Einblick nicht nur in die theoretischen Konzepte Goolishians, sondern auch seiner praktischen Arbeit!

 In diesem Jahr feiert der Carl-Auer-Verlag sein 20-jähriges Jubiläum. Aber wer war eigentlich Carl-Auer? Die wenigsten Menschen aus unserem Feld haben eine persönliche Erinnerung an ihn. Kein Wunder, seine Tätigkeit blühte im Verborgenen. Dennoch hat er sich hin und wieder Zeitzeugen offenbart. Zum Beispiel dem Altmeister Carlos Sluzki (Foto:
In diesem Jahr feiert der Carl-Auer-Verlag sein 20-jähriges Jubiläum. Aber wer war eigentlich Carl-Auer? Die wenigsten Menschen aus unserem Feld haben eine persönliche Erinnerung an ihn. Kein Wunder, seine Tätigkeit blühte im Verborgenen. Dennoch hat er sich hin und wieder Zeitzeugen offenbart. Zum Beispiel dem Altmeister Carlos Sluzki (Foto:  In ihrem Aufsatz Counseling Professionals as Agents of Promoting the Cultures of Peace diskutiert Ayoka Mopelola Olusakin (Foto:
In ihrem Aufsatz Counseling Professionals as Agents of Promoting the Cultures of Peace diskutiert Ayoka Mopelola Olusakin (Foto: