
Etwas verspätet wird an dieser Stelle die neue Ausgabe der„systeme“ vorgestellt, sie ist immerhin schon einige Wochen auf dem Markt. Aus dem Editorial:„Gleich zu Beginn finden Sie die im letzten Heft versprochene Fortsetzung zum Thema Burnout; in Teil 2 führen Stefan Geyerhofer und Carmen Unterholzer in kurzweiliger und anregender Weise durch hilfreiche Strategien und Interventionen im Umgang mit dem Burnout-Syndrom. Danach lädt Dominik Rosenauer, ausgehend von der österreichischen Gesetzeslage, in seinem Artikel über Online Beratung engagiert wie provokant dazu ein, sich mit den Rahmenbedingungen und Besonderheiten eines möglichen Arbeitsfeldes für PsychotherapeutInnen auseinanderzusetzen. In unserem dritten Beitrag zeigt Dietmar Rüther anschaulich, wie aus Physiotherapie im Sinn einer funktionalen Körpertherapie ganzheitlich körperorientierte Beziehungsarbeit mit systemischer Ausrichtung werden kann“. Darüber hinaus wird auf Günter Schiepeks neues Institut für Synergetik und Psychotherapieforschung in Salzburg eingegangen, ein Rezensionsessay von Wolfgang Loth zur Bedeutung der Philosophie Karl Jaspers für eine Sinn-orientierte Beratung sowie zwei Nachrufe auf Georgina Steininger und Rolf Thissen beschließen das Heft.
Zu den abstracts





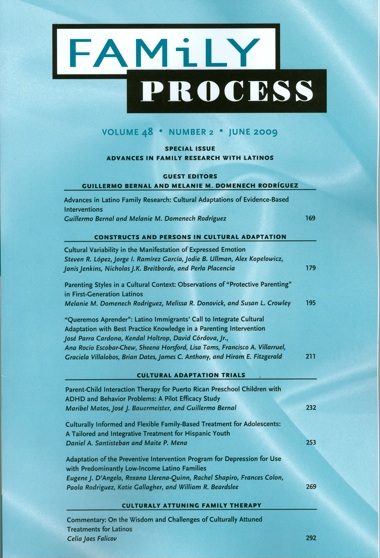
 eingebüßt. Auch in seinem jüngsten opus magnum, der Gesellschaft der Gesellschaft, bezieht Luhmann in zahlreichen Anmerkungen und Verweisen gegen die subjektzentrierte Vernunftkonzeption von Habermas Stellung, die für ihn, indem sie in illegitimer Weise die Verwirklichbarkeit von Utopien suggeriert, statt zeitgemäße Soziologie zu betreiben, nur auf Vernunft zu warten scheint. (1997: 1148) Obwohl sich Habermas zwar in seinem Spätwerk tatsächlich von der Soziologie eher ab und einer mehr philosophisch-normativen Erörterung der für moderne Gesellschaften noch gangbaren Integrationsmöglichkeiten zugewandt zu haben scheint, hält auch er es im Gegenzug nach wie vor für nötig, sich von der systemtheoretischen Unterscheidungspoiesis Luhmanns zu distanzieren. (zuletzt etwa: 1996: 393ff). Obwohl die Heftigkeit der Kontroverse nicht zuletzt auch in der Wahl der sprachlichen Mittel zwar nun eine gewisse Konsolidierung gegenüber ihrem Beginn in den siebziger Jahren zu erfahren scheint, dürften die beiden Konzepte in der sozialwissenschaftlichen Theoriediskussion nach wie vor als weitgehend inkompatibel gelten. Gerade Die Gesellschaft der Gesellschaft gibt aber, indem sie gewisse, freilich bereits auch im früheren Werk angelegte Züge der systemtheoretischen Konzeption mit neuer Deutlichkeit herausstellt, Anlaß, einen zweiten Blick auf Parallelen und Analogien von Diskurs- und Systemtheorie zu werfen. Dabei zeigt sich überraschender Weise, daß die Fronten so starr gar nicht sein müßten, daß sie vielmehr an sehr grundsätzlichen Stellen Möglichkeiten bieten, um die eine Konzeption in die andere überzuführen oder mit den Konsequenzen der einen an Prämissen der anderen gewissermaßen interkonzeptuell anzuschließen“
eingebüßt. Auch in seinem jüngsten opus magnum, der Gesellschaft der Gesellschaft, bezieht Luhmann in zahlreichen Anmerkungen und Verweisen gegen die subjektzentrierte Vernunftkonzeption von Habermas Stellung, die für ihn, indem sie in illegitimer Weise die Verwirklichbarkeit von Utopien suggeriert, statt zeitgemäße Soziologie zu betreiben, nur auf Vernunft zu warten scheint. (1997: 1148) Obwohl sich Habermas zwar in seinem Spätwerk tatsächlich von der Soziologie eher ab und einer mehr philosophisch-normativen Erörterung der für moderne Gesellschaften noch gangbaren Integrationsmöglichkeiten zugewandt zu haben scheint, hält auch er es im Gegenzug nach wie vor für nötig, sich von der systemtheoretischen Unterscheidungspoiesis Luhmanns zu distanzieren. (zuletzt etwa: 1996: 393ff). Obwohl die Heftigkeit der Kontroverse nicht zuletzt auch in der Wahl der sprachlichen Mittel zwar nun eine gewisse Konsolidierung gegenüber ihrem Beginn in den siebziger Jahren zu erfahren scheint, dürften die beiden Konzepte in der sozialwissenschaftlichen Theoriediskussion nach wie vor als weitgehend inkompatibel gelten. Gerade Die Gesellschaft der Gesellschaft gibt aber, indem sie gewisse, freilich bereits auch im früheren Werk angelegte Züge der systemtheoretischen Konzeption mit neuer Deutlichkeit herausstellt, Anlaß, einen zweiten Blick auf Parallelen und Analogien von Diskurs- und Systemtheorie zu werfen. Dabei zeigt sich überraschender Weise, daß die Fronten so starr gar nicht sein müßten, daß sie vielmehr an sehr grundsätzlichen Stellen Möglichkeiten bieten, um die eine Konzeption in die andere überzuführen oder mit den Konsequenzen der einen an Prämissen der anderen gewissermaßen interkonzeptuell anzuschließen“ „In einem interessanten Beitrag von Hans J. Pongratz (Foto: rosner-consult.de), der sich aus einem Vortrag für die ad-hoc-Gruppe Soziologische Beratung des Berufsverbands deutscher Soziologen e.V. am 16. September 1998 auf dem Soziologiekongress Grenzenlose Gesellschaft? in Freiburg im Breisgau entwickelt hat, plädiert dieser für eine beratungspraxeologische Integration von systemischen und herrschaftskritischen bzw. subjektbezogenen Theoriekonzepten in der Organisationsberatung:„Während die soziologische Diskussion von Organisationsberatung bisher vor allem auf systemtheoretische Ansätze Bezug nimmt, wird hier versucht, eine ergänzende subjektorientierte Perspektive unter Berücksichtigung herrschaftskritischer Positionen zu entwickeln. Denn typischerweise überlagern sich betriebliche Hierarchie und Beratungsauftrag in der Form, daß die Auftraggeber zugleich Vorgesetzte der zu beratenden (oder von Beratung betroffenen) Mitarbeiter sind. Um die Kooperation dieser Mitarbeiter im Beratungsprozeß zu erreichen, werden in den vorherrschenden Beratungsansätzen verschiedene Strategien vorgeschlagen: Autorität, Motivation, Partizipation, Neutralität. Angesichts der unvermeidbaren Verstrickung der Berater in Machtdynamiken wird hier hingegen für eine Verhandlungsstrategie plädiert, mit welcher zusätzlich zum Rahmenauftrag der Auftraggeber mit den betroffenen Mitarbeitern konkretisierende Kernaufträge ausgehandelt werden“
„In einem interessanten Beitrag von Hans J. Pongratz (Foto: rosner-consult.de), der sich aus einem Vortrag für die ad-hoc-Gruppe Soziologische Beratung des Berufsverbands deutscher Soziologen e.V. am 16. September 1998 auf dem Soziologiekongress Grenzenlose Gesellschaft? in Freiburg im Breisgau entwickelt hat, plädiert dieser für eine beratungspraxeologische Integration von systemischen und herrschaftskritischen bzw. subjektbezogenen Theoriekonzepten in der Organisationsberatung:„Während die soziologische Diskussion von Organisationsberatung bisher vor allem auf systemtheoretische Ansätze Bezug nimmt, wird hier versucht, eine ergänzende subjektorientierte Perspektive unter Berücksichtigung herrschaftskritischer Positionen zu entwickeln. Denn typischerweise überlagern sich betriebliche Hierarchie und Beratungsauftrag in der Form, daß die Auftraggeber zugleich Vorgesetzte der zu beratenden (oder von Beratung betroffenen) Mitarbeiter sind. Um die Kooperation dieser Mitarbeiter im Beratungsprozeß zu erreichen, werden in den vorherrschenden Beratungsansätzen verschiedene Strategien vorgeschlagen: Autorität, Motivation, Partizipation, Neutralität. Angesichts der unvermeidbaren Verstrickung der Berater in Machtdynamiken wird hier hingegen für eine Verhandlungsstrategie plädiert, mit welcher zusätzlich zum Rahmenauftrag der Auftraggeber mit den betroffenen Mitarbeitern konkretisierende Kernaufträge ausgehandelt werden“ „Konflikte können in Organisationen auf zweifache Weise zugerechnet werden: als Konflikt zwischen Rollen oder als Konflikt zwischen Personen. Konflikte zwischen Rollen werden dabei organisationsintern als legitime Auseinandersetzungen gehandhabt. Hinter dem Konflikt zwischen Rollenträgern wird ein Organisationskonflikt gesehen. Es wird deswegen organisationsintern in der Regel akzeptiert, dass sich in der Universität die Fachgruppensprecherin Politologie mit dem Fachgruppensprecher Betriebswirtschaftslehre über die Einbeziehung von wissenschaftlichen Mitarbeitern in die Lehre streitet. Konflikte zwischen Personen haben in Organisationen nicht die gleiche Form von Legitimität. Finden diese statt, werden sie als Hahnenkämpfe zwischen Verwaltungsgockeln, als Zickenkrieg zwischen mehreren Unteroffizierinnen oder als Problem in der Chemie zwischen zwei Abteilungsleitern markiert und tendenziell delegitimiert. Ob eine Auseinandersetzung jetzt als Konflikt zwischen Rollen oder Konflikt zwischen Personen gehandhabt wird ist nicht durch die Organisation selbst objektiv bestimmbar, sondern wird sozial ausgehandelt. Es ist ein häufig zu beobachtendes Phänomen, dass in einer Interaktion eine Aushandlung darüber gesucht wird, ob ein Konflikt als Chemie-Problem bestimmt wird, das durch ein Konflikt-Coaching oder die Auswechslung eines der Beteiligten zu lösen wäre, oder ob es sich um einen Rollenkonflikt handelt, der auch bei der Auswechslung der Person bestehen bleiben würde“ (In: Psychiatrisierung, Personifizierung und Personalisierung. Zur personenzentrierten Beratung in Organisationen. Organisationsberatung Supervision Coaching, Heft 4/2006, S. 391-405)
„Konflikte können in Organisationen auf zweifache Weise zugerechnet werden: als Konflikt zwischen Rollen oder als Konflikt zwischen Personen. Konflikte zwischen Rollen werden dabei organisationsintern als legitime Auseinandersetzungen gehandhabt. Hinter dem Konflikt zwischen Rollenträgern wird ein Organisationskonflikt gesehen. Es wird deswegen organisationsintern in der Regel akzeptiert, dass sich in der Universität die Fachgruppensprecherin Politologie mit dem Fachgruppensprecher Betriebswirtschaftslehre über die Einbeziehung von wissenschaftlichen Mitarbeitern in die Lehre streitet. Konflikte zwischen Personen haben in Organisationen nicht die gleiche Form von Legitimität. Finden diese statt, werden sie als Hahnenkämpfe zwischen Verwaltungsgockeln, als Zickenkrieg zwischen mehreren Unteroffizierinnen oder als Problem in der Chemie zwischen zwei Abteilungsleitern markiert und tendenziell delegitimiert. Ob eine Auseinandersetzung jetzt als Konflikt zwischen Rollen oder Konflikt zwischen Personen gehandhabt wird ist nicht durch die Organisation selbst objektiv bestimmbar, sondern wird sozial ausgehandelt. Es ist ein häufig zu beobachtendes Phänomen, dass in einer Interaktion eine Aushandlung darüber gesucht wird, ob ein Konflikt als Chemie-Problem bestimmt wird, das durch ein Konflikt-Coaching oder die Auswechslung eines der Beteiligten zu lösen wäre, oder ob es sich um einen Rollenkonflikt handelt, der auch bei der Auswechslung der Person bestehen bleiben würde“ (In: Psychiatrisierung, Personifizierung und Personalisierung. Zur personenzentrierten Beratung in Organisationen. Organisationsberatung Supervision Coaching, Heft 4/2006, S. 391-405)
