21. Dezember 2009
von Tom Levold
2 Kommentare
„Funktionale Differenzierung produziert (
) genau jenen Widerspruch, auf dessen Hintergrund nichtintendierte Handlungsfolgen politisiert werden können. Unter funktionaler Differenzierung versteht man klassisch ein gesellschaftliches Differenzierungsprinzip, das besondere Mechanismen der Vergesellschaftung von Individuen etabliert. Inklusion, also die Einbeziehung von Individuen in gesellschaftliche Zusammenhänge etwa über soziale Rollen, wird in funktional differenzierten Gesellschaften durch Funktionssysteme organisiert. Der Wohlfahrtsstaat lässt sich in diesem Zusammenhang als Institution auffassen, die versucht, ein gewisses Maß an Inklusion dauerhaft abzusichern. Zugleich aber behalten die Funktionssysteme ihre Autonomie insofern, als sie jeweils eigene Kriterien für Inklusion und Exklusion, d.h. für soziale Berücksichtigung und Ausgrenzung entwickeln. Eine solche funktionssystemspezifische Steuerung von Inklusion und Exklusion hat zwei Folgen: Auf der einen Seite generiert sie das Postulat eines Inklusionsuniversalismus, weil niemand mehr aufgrund seiner Lebenslage und seines sozialen Status ausgeschlossen werden sollte. Insofern zielt funktionale Differenzierung ihrem Prinzip nach auf Allinklusion (
). Damit einher gehen relativ anspruchsvolle, legitime Erwartungen, an gesellschaftlichen Leistungen teilhaben zu können. Zugleich entwickeln sich egalitäre Gerechtigkeitsvorstellungen, die davon ausgehen, dass bei der Inklusion in Funktionssysteme alle Gesellschaftsmitglieder gleiche Chancen haben sollten. Auf der anderen Seite entsteht gerade dadurch, dass Inklusion auf autonome Teilsysteme übergeht, systembedingter Ausschluss. Funktionale Differenzierung verstärkt in diesem Sinne das Problem sozialer Ungleichheit und sozialer Ausgrenzung. Wir haben es also mit einer gleichzeitigen Universalisierung und Spezialisierung von Inklusion zu tun. Der paradoxe Effekt dieses Widerspruchs ist Exklusion aufgrund (der systemspezifischen Steuerung) von Inklusion. Die Enttäuschung, die von diesem Effekt ausgeht, bildet den Bodensatz für die Entstehung von Konflikten. Allerdings hat die Differenzierungstheorie und insbesondere die Systemtheorie genau diesen Zusammenhang zwischen sozialer Exklusion und sozialem Konflikt nicht nur weitgehend ignoriert, sie ist auch konzeptionell aufgrund eines sehr engen Exklusionsbegriffs nicht ohne weiteres in der Lage, die Frage nach der Konfliktträchtigkeit sozialer Exklusion zu beantworten“ (In: Exklusion als Macht. Zu den Bedingungen der Konfliktträchtigkeit sozialer Ausgrenzung. In: Journal für Konflikt- und Gewaltforschung 7 (2005), Heft 2, S. 41-67.)


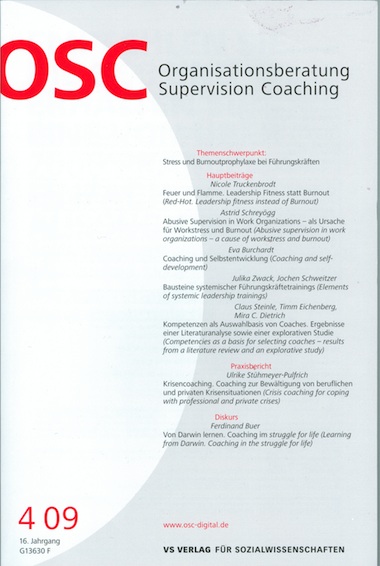
 ImDezember 1998 hat Rudolf Maresch„Interview mit Ernst von Glasersfeld über Schuhe, Stadtpläne und Regenbogen“ geführt, das im Telepolis-Magazin zu lesen ist und in dem Glasersfeld Fragen zum Radikalen Konstruktivismus beantwortet:„Maresch: ‚Herr von Glasersfeld, Sie gelten als der Stichwortgeber des Radikalen Konstruktivismus (RK). Können Sie uns zu Beginn kurz erläutern, wie sich Ihr Konzept von anderen operativen Konstruktivismen (Niklas Luhmann, Heinz von Foerster) unterscheidet?‘ Ernst von Glasersfeld: ‚Luhmann kenne ich zu wenig. Er hat mit der Systemtheorie gearbeitet. Sein Konstruktivismus muß anders sein, denn er war, obwohl er mich hie und da zitiert hat, mit meinem Konstruktivismus nicht ganz einverstanden. Gewisse Dinge passen wohl nicht zueinander. Neulich hat mir jemand erzählt, Luhmann hätte gesagt, wir hätten uns nicht genug mit den ontologischen Voraussetzungen befaßt. Der Radikale Konstruktivismus (RK) ist ein Versuch, eine Wissenstheorie ohne Bezug auf Ontologie aufzubauen. Luhmann scheint anzunehmen, daß man das nicht machen kann.‘
ImDezember 1998 hat Rudolf Maresch„Interview mit Ernst von Glasersfeld über Schuhe, Stadtpläne und Regenbogen“ geführt, das im Telepolis-Magazin zu lesen ist und in dem Glasersfeld Fragen zum Radikalen Konstruktivismus beantwortet:„Maresch: ‚Herr von Glasersfeld, Sie gelten als der Stichwortgeber des Radikalen Konstruktivismus (RK). Können Sie uns zu Beginn kurz erläutern, wie sich Ihr Konzept von anderen operativen Konstruktivismen (Niklas Luhmann, Heinz von Foerster) unterscheidet?‘ Ernst von Glasersfeld: ‚Luhmann kenne ich zu wenig. Er hat mit der Systemtheorie gearbeitet. Sein Konstruktivismus muß anders sein, denn er war, obwohl er mich hie und da zitiert hat, mit meinem Konstruktivismus nicht ganz einverstanden. Gewisse Dinge passen wohl nicht zueinander. Neulich hat mir jemand erzählt, Luhmann hätte gesagt, wir hätten uns nicht genug mit den ontologischen Voraussetzungen befaßt. Der Radikale Konstruktivismus (RK) ist ein Versuch, eine Wissenstheorie ohne Bezug auf Ontologie aufzubauen. Luhmann scheint anzunehmen, daß man das nicht machen kann.‘ Obwohl politisch bestens informiert, war ich auf die Öffnung der Mauer schlicht und einfach nicht vorbereitet:„Auf dem Bildschirm war eine Menschenmasse zu sehen, die sich vor und auf einer Mauer tummelte, die Ähnlichkeiten mit der Berliner Mauer hatte, offensichtlich euphorisiert, mit Sektflaschen in der Hand, aber eindeutig nicht mein Video-Band. Nach mehrmaligem Hin- und Herschalten erfasste mich eine Ahnung, dass es sich hier nicht um eine Inszenierung handelte, sondern um aktuelle Nachrichten. Ähnlich ungläubig habe ich 12 Jahre später am 11.9. auf die Bildschirme in der Kölner U-Bahn gestarrt und erst zuhause glauben wollen, dass das, was ich da sah, Realität und nicht Fiktion war. Meine plötzlichen, für mich völlig überraschenden Tränen und mein Unvermögen, mit dem Seminar wie geplant zu starten, verdanktem sich einem Gefühl von Überwältigung, dem Gefühl, schockiert zu sein von einem Ereignis, das der Kognition sozusagen längst als fällig vor Augen stand, vom Affekt aber bislang als ausgeschlossen angesehen wurde. Dass die Wirklichkeit meiner Phantasie so weit vorauszueilen imstande war bzw. dass ich mit meinen Erwartungen der Realität so weit hinterhergehinkt war, beschämte mich. Immerhin war die aufgeladene Atmosphäre in der DDR, in Ungarn und in der CSSR seit Wochen beherrschendes Thema in den Medien gewesen“
Obwohl politisch bestens informiert, war ich auf die Öffnung der Mauer schlicht und einfach nicht vorbereitet:„Auf dem Bildschirm war eine Menschenmasse zu sehen, die sich vor und auf einer Mauer tummelte, die Ähnlichkeiten mit der Berliner Mauer hatte, offensichtlich euphorisiert, mit Sektflaschen in der Hand, aber eindeutig nicht mein Video-Band. Nach mehrmaligem Hin- und Herschalten erfasste mich eine Ahnung, dass es sich hier nicht um eine Inszenierung handelte, sondern um aktuelle Nachrichten. Ähnlich ungläubig habe ich 12 Jahre später am 11.9. auf die Bildschirme in der Kölner U-Bahn gestarrt und erst zuhause glauben wollen, dass das, was ich da sah, Realität und nicht Fiktion war. Meine plötzlichen, für mich völlig überraschenden Tränen und mein Unvermögen, mit dem Seminar wie geplant zu starten, verdanktem sich einem Gefühl von Überwältigung, dem Gefühl, schockiert zu sein von einem Ereignis, das der Kognition sozusagen längst als fällig vor Augen stand, vom Affekt aber bislang als ausgeschlossen angesehen wurde. Dass die Wirklichkeit meiner Phantasie so weit vorauszueilen imstande war bzw. dass ich mit meinen Erwartungen der Realität so weit hinterhergehinkt war, beschämte mich. Immerhin war die aufgeladene Atmosphäre in der DDR, in Ungarn und in der CSSR seit Wochen beherrschendes Thema in den Medien gewesen“ Nun wird der Adventskalender doch noch voll! Cornelia Tsirigotis aus Aachen sorgt trotz schwerer Erkältung für das Türchen zum 23.12., obwohl Aachen ganz ganz weit weg von Berlin war:
Nun wird der Adventskalender doch noch voll! Cornelia Tsirigotis aus Aachen sorgt trotz schwerer Erkältung für das Türchen zum 23.12., obwohl Aachen ganz ganz weit weg von Berlin war:  „Ich gebe zu, für die Größe des geschichtlichen Moments sind meine Erinnerungen an den Abend des 9. November etwas dürftig. Viel spannender fand ich die Frage, mit der Tom zum Adventskalender einlud: Wann fiel die innere Mauer? Woraus besteht die eigentlich? Ich, ich habe doch keine innere Mauer?!?! Meine innere Mauer bestand eher aus nichts, oder aus wenig: wenig damit zu tun, immer wenig Menschen in der DDR gekannt, keine Verwandten gehabt, nur ganz entfernte, die mich mal als ich 12 Jahre alt war, für einen Nacht gegen ihre Tochter eintauschen wollten, damit die in Westberlin ihre Großmutter sehen konnte. Ich hatte Schiss und war froh, einen Kopf größer zu sein als Sigrid und darüber, dass mein Passbild keinerlei Ähnlichkeit bot, so dass der Plan fallen gelassen wurde“
„Ich gebe zu, für die Größe des geschichtlichen Moments sind meine Erinnerungen an den Abend des 9. November etwas dürftig. Viel spannender fand ich die Frage, mit der Tom zum Adventskalender einlud: Wann fiel die innere Mauer? Woraus besteht die eigentlich? Ich, ich habe doch keine innere Mauer?!?! Meine innere Mauer bestand eher aus nichts, oder aus wenig: wenig damit zu tun, immer wenig Menschen in der DDR gekannt, keine Verwandten gehabt, nur ganz entfernte, die mich mal als ich 12 Jahre alt war, für einen Nacht gegen ihre Tochter eintauschen wollten, damit die in Westberlin ihre Großmutter sehen konnte. Ich hatte Schiss und war froh, einen Kopf größer zu sein als Sigrid und darüber, dass mein Passbild keinerlei Ähnlichkeit bot, so dass der Plan fallen gelassen wurde“
 Was kaum jemand weiß: der Kofürst von Andorra, Nicolas Sarkozy, ist nicht nur einer der bedeutendsten Männer der Weltgeschichte, sondern hat auch maßgeblichen Anteil an der Öffnung der Mauer und der deutschen Wiedervereinigung. systemagazin freut sich, nach langem Zureden von Carla Bruni einen Exklusiv-Beitrag des berühmtesten Mauerspechtes der Welt präsentieren zu können:„Mon Dieu! Jeder Mensch in Allemagne weiß ja nun, dass ich als Erster am 9.11.1989 begonnen habe, mit einer Spitzhacke die Mauer zu zerlegen, und zwar von der Ostseite Berlins, wie zahlreiche Fotos belegen. Als zukünftigem Präsidenten eines Volkes, dass 200 Jahre zuvor das ancien régime auf den Abfallhaufen der Geschichte geworfen hat, hat mich damals schon gewundert, dass die Deutschen nicht von selbst auf diese Idee gekommen ist. Wahrscheinlich haben alle auf eine Abrissgenehmigung gewartet. Allons enfants! So lag es an mir, ein wenig Entwicklungshilfe zu leisten. Und wie Sie sehen, hat meine Initiative solchen Erfolg gehabt, dass mittlerweile von der Mauer gar nichts mehr zu sehen ist. Das ist aber nur die eine Hälfte der Geschichte“ Sie wollen die andere Hälfte auch wissen?
Was kaum jemand weiß: der Kofürst von Andorra, Nicolas Sarkozy, ist nicht nur einer der bedeutendsten Männer der Weltgeschichte, sondern hat auch maßgeblichen Anteil an der Öffnung der Mauer und der deutschen Wiedervereinigung. systemagazin freut sich, nach langem Zureden von Carla Bruni einen Exklusiv-Beitrag des berühmtesten Mauerspechtes der Welt präsentieren zu können:„Mon Dieu! Jeder Mensch in Allemagne weiß ja nun, dass ich als Erster am 9.11.1989 begonnen habe, mit einer Spitzhacke die Mauer zu zerlegen, und zwar von der Ostseite Berlins, wie zahlreiche Fotos belegen. Als zukünftigem Präsidenten eines Volkes, dass 200 Jahre zuvor das ancien régime auf den Abfallhaufen der Geschichte geworfen hat, hat mich damals schon gewundert, dass die Deutschen nicht von selbst auf diese Idee gekommen ist. Wahrscheinlich haben alle auf eine Abrissgenehmigung gewartet. Allons enfants! So lag es an mir, ein wenig Entwicklungshilfe zu leisten. Und wie Sie sehen, hat meine Initiative solchen Erfolg gehabt, dass mittlerweile von der Mauer gar nichts mehr zu sehen ist. Das ist aber nur die eine Hälfte der Geschichte“ Sie wollen die andere Hälfte auch wissen?
 erinnere mich an eine Fülle unterschiedlichster Erlebnisse: nach den ersten Schritten in den Westen stand z.B. auf der Westberliner Seite der Bornholmer Brücke ein Truck, von dem (tonnenweise) Kaffeepäckchen und Bananen in die Massen geschmissen wurden. Das fand ich so beschämend, dass ich eigentlich am liebsten gleich wieder umgekehrt wäre. Als wir dann viel später das Brandenburger Tor von der für uns unbekannten Seite vor uns sahen, berührte mich dann doch die Idee sehr, eine wie auch immer zumindest für uns Deutsche – bedeutsame Zeit mitzuerleben. Zwischen diesen beiden markierten Empfindungen gab es von nun an bis heute sehr unterschiedlich erlebte und empfundene Erfahrungen mit deutsch-deutscher Geschichte“ Gemischte Erfahrungen also (was sonst), von denen sie für den systemagazin-Adventskalender in ihrem schönen Beitrag aber nur die Glücklichen preisgibt.
erinnere mich an eine Fülle unterschiedlichster Erlebnisse: nach den ersten Schritten in den Westen stand z.B. auf der Westberliner Seite der Bornholmer Brücke ein Truck, von dem (tonnenweise) Kaffeepäckchen und Bananen in die Massen geschmissen wurden. Das fand ich so beschämend, dass ich eigentlich am liebsten gleich wieder umgekehrt wäre. Als wir dann viel später das Brandenburger Tor von der für uns unbekannten Seite vor uns sahen, berührte mich dann doch die Idee sehr, eine wie auch immer zumindest für uns Deutsche – bedeutsame Zeit mitzuerleben. Zwischen diesen beiden markierten Empfindungen gab es von nun an bis heute sehr unterschiedlich erlebte und empfundene Erfahrungen mit deutsch-deutscher Geschichte“ Gemischte Erfahrungen also (was sonst), von denen sie für den systemagazin-Adventskalender in ihrem schönen Beitrag aber nur die Glücklichen preisgibt.