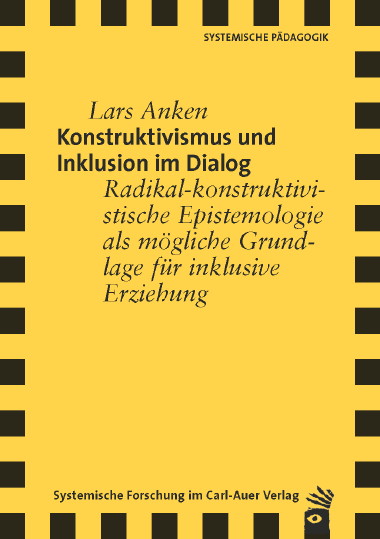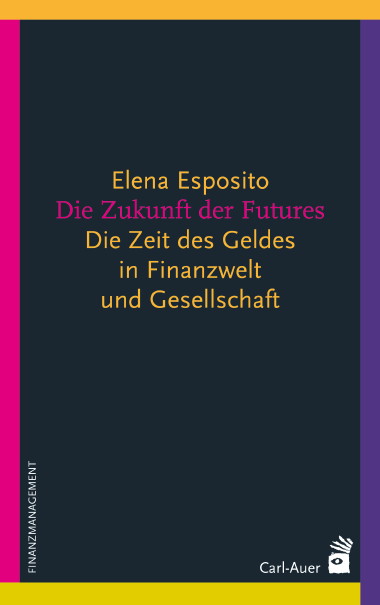In der Ausgabe 8 (2007) des e-Journal Philosophie der Psychologie verfolgt Oliver Grimm, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Neuropsychologie und Klinische Psychologie am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit die Rolle der Alltagspsychologie bei der Erstellung psychiatrischer Diagnosen unter einen sprachphilosophischen Blickwinkel:„Die heute gängigen Klassifikationssysteme innerhalb der Psychiatrie wurden konstruiert, um eine Theorielastigkeit der Diagnosen zu vermeiden. Sie sind als vermeintlich neutrale Beschreibungen einer objektiv fassbaren Diagnose gedacht. Die Strategie der biologischen Psychiatrie besteht nun darin, naturwissenschaftliche Erklärungen für Gehirnvorgänge zu finden, die diesen diagnostischen Identitäten zugrunde liegen. Manche Vertreter der biologischen Psychiatrie teilen dabei mit Vertretern des eliminativen Materialismus aus der Philosophie des Geistes ein gemeinsames Projekt: unser alltagspsychologisches Sprechen über Handlungen und Motive wird als ungenau abgelehnt. Damit begeben sich jedoch die biomedizinischen Materialisten in eine Zwickmühle. Es kann nicht gelingen, neurobiologische Ursachen psychiatrischer Erkrankungen zu finden, die letztlich unsere alltagspsychologischen Verhaltenserklärungen verlassen, wenn gerade alltagspsychologische Erklärungsmodelle auch heute noch psychiatrischen Diagnosen zugrunde liegen. Die Debatte um die folk-psychology innerhalb der Philosophie des Geistes liefert Hinweise auf eine mögliche Alternative: Wenn es sich bei folk-psychology nicht um eine falsche alltagspsychologische Theorie handelt, sondern um das Prinzip der mentalen Simulation unseres Gegenübers, so ist diese Theorie viel einfacher mit der gegenwärtigen, auch naturwissenschaftlichen Forschung zu verbinden. In neueren neurobiologischen Modellen wird von einem Modell ausgegangen, dass an die Stelle eines neurobiologischen Gehirns das so genannte„soziale Gehirn“ stellt. Psychiatrische Diagnosen ließen sich als Kategorisierungsversuch des„sozialen Gehirns“ des Psychiaters interpretieren, ein Ansatz, der mit der Simulationstheorie der folk-psychology kompatibel ist“
Zum vollständigen Text
17. März 2010
von Tom Levold
Keine Kommentare

 In der Sozialen Welt 53 (2002) erschien ein Aufsatz von Thorsten Bonacker, Professor am Zentrum für Konfliktforschung an der Universität Marburg (Foto:
In der Sozialen Welt 53 (2002) erschien ein Aufsatz von Thorsten Bonacker, Professor am Zentrum für Konfliktforschung an der Universität Marburg (Foto: 


 Im Jahre 2001 lud die Zeitschrift„Spektrum der Wissenschaft“ den (am 20.5.2008 im Alter von 78 Jahren verstorbenen) Astrophysiker
Im Jahre 2001 lud die Zeitschrift„Spektrum der Wissenschaft“ den (am 20.5.2008 im Alter von 78 Jahren verstorbenen) Astrophysiker  Wenn ich Wissenschaft von außen betrachte und mit Kunst oder Religion vergleiche, dann unterscheidet sie sich dadurch, dass sie für ihre Aussagen Wahrheit beansprucht das heißt, ihren Aussagen soll im Prinzip jeder zustimmen können. Aber das ist eine Fremdbeschreibung, und dieser Wahrheitsbegriff ist relativ abstrakt. Auf der internen Ebene der Selbstbeschreibung tritt ‚Wahrheit‘ vielfach zurück so wie Künstler heute nicht mehr sagen, dass ihre Bilder ’schön‘ sind. Wir beobachten in vielen gesellschaftlichen Bereichen diese Distanz gegenüber letzten Idealen. Spektrum: Ringt der Wissenschaftler intern ironisch-zynisch mit seiner Unsicherheit, vermittelt aber nach außen mehr Sicherheit, als er intern selbst vertreten würde? Ehlers: Natürlich stellen Wissenschaftler nach außen eher die Dinge heraus, von denen sie meinen, die seien verstanden denn wenn sie das Andere herausstellten, dann würde ihnen die Öffentlichkeit nicht die nötigen Mittel gewähren; das ist ein praktischer Gesichtspunkt. Dennoch kommen in der Wissenschaft Produkte zu Stande Heisenberg hat das ‚abgeschlossene Theorien‘ genannt , die in einem gewissen Bereich zuverlässig sind und die man nicht mehr zu ändern braucht. Überraschungen sind nie ausgeschlossen, aber der relative Grad an Sicherheit ist in den Naturwissenschaften größer als anderswo“
Wenn ich Wissenschaft von außen betrachte und mit Kunst oder Religion vergleiche, dann unterscheidet sie sich dadurch, dass sie für ihre Aussagen Wahrheit beansprucht das heißt, ihren Aussagen soll im Prinzip jeder zustimmen können. Aber das ist eine Fremdbeschreibung, und dieser Wahrheitsbegriff ist relativ abstrakt. Auf der internen Ebene der Selbstbeschreibung tritt ‚Wahrheit‘ vielfach zurück so wie Künstler heute nicht mehr sagen, dass ihre Bilder ’schön‘ sind. Wir beobachten in vielen gesellschaftlichen Bereichen diese Distanz gegenüber letzten Idealen. Spektrum: Ringt der Wissenschaftler intern ironisch-zynisch mit seiner Unsicherheit, vermittelt aber nach außen mehr Sicherheit, als er intern selbst vertreten würde? Ehlers: Natürlich stellen Wissenschaftler nach außen eher die Dinge heraus, von denen sie meinen, die seien verstanden denn wenn sie das Andere herausstellten, dann würde ihnen die Öffentlichkeit nicht die nötigen Mittel gewähren; das ist ein praktischer Gesichtspunkt. Dennoch kommen in der Wissenschaft Produkte zu Stande Heisenberg hat das ‚abgeschlossene Theorien‘ genannt , die in einem gewissen Bereich zuverlässig sind und die man nicht mehr zu ändern braucht. Überraschungen sind nie ausgeschlossen, aber der relative Grad an Sicherheit ist in den Naturwissenschaften größer als anderswo“