 Im Jahr 2001 hat Peter Kaimer vom Lehrstuhl für klinische Psychologie an der Universität Bamberg einen Aufsatz über Psychotherapie als Story Dealing verfasst:„Ich habe mich beim Titel für diesen Aufsatz von Hans Geißlingers Story Dealer AG (Geißlinger, 1992) anregen lassen. Diese Gruppe konnte im Rahmen ihrer Kinder- und Jugendlichenfreizeiten aber auch im Rahmen von Aktionen mit Erwachsenen anschaulich zeigen, dass Wirklichkeit in hohem Maße ein sozial erzeugtes – oder erfundenes – Produkt ist, an dem wir alle schöpfend oder erzählend – und damit auch wieder individuell konstruierend – teilhaben. Bei einer organisierten Freizeit sind wir üblicherweise gewohnt, diese als eine Veranstaltung zu sehen, welche von Leuten geplant und Schritt für Schritt durchgeführt wird. Aktive Planer auf der einen Seite – mehr oder minder passive Konsumenten auf der anderen. Die Beschreibungen der Story Dealer verhindern schon durch die Art der Darstellung eine solche Perspektive. Nicht nur stellen sie den Charakter der sich entfaltenden Wirklichkeit des Abenteuerurlaubs als einen kooperativen (wenngleich oft recht unbewussten) Prozess zwischen Anbietern und Konsumenten heraus. Sie arbeiten zusätzlich typische Muster dieser Entfaltung sorgfältig heraus und lassen so ein griffiges Bild davon entstehen, was planbar und was nicht planbar ist: Dieser Prozess wird von ihnen als Wechselspiel zwischen Deutungsangeboten und gezielten Irritationen einerseits, Reaktionen auf Zufälligkeiten und Verstärkung einmal eingetretener Eigendynamiken andererseits gesehen und beschrieben (
). Ich sehe Therapie als einen ähnlichen Prozess: als eine Entwicklung des gemeinsamen Findens, Erfindens, Irritierens und Bedeutung-Zuweisens; als ein Phänomen, für welches eine Beschreibung, die das Moment der Kontrolle der Therapeut/inn/en betont, eher unangemessen ist, sondern welches in hohem Maße als kollaborativ anzusehen ist, auch wenn die Lesegewohnheiten vermittelt über unsere Lehrbücher ein anderes Bild suggerieren. Welche Faktoren und Wendepunkte dabei bedeutsam sind, will ich im Folgenden darstellen. Allerdings erhebe ich nicht den Anspruch einer hinreichenden Systematik. Mein Anspruch geht eher – wie übrigens u.a. auch in meinen Therapien – in Richtung einer in sich stimmigen, im besten Falle gut erzählten Geschichte. Mit all den Folgen, welche solche Geschichten wiederum haben können
“
Im Jahr 2001 hat Peter Kaimer vom Lehrstuhl für klinische Psychologie an der Universität Bamberg einen Aufsatz über Psychotherapie als Story Dealing verfasst:„Ich habe mich beim Titel für diesen Aufsatz von Hans Geißlingers Story Dealer AG (Geißlinger, 1992) anregen lassen. Diese Gruppe konnte im Rahmen ihrer Kinder- und Jugendlichenfreizeiten aber auch im Rahmen von Aktionen mit Erwachsenen anschaulich zeigen, dass Wirklichkeit in hohem Maße ein sozial erzeugtes – oder erfundenes – Produkt ist, an dem wir alle schöpfend oder erzählend – und damit auch wieder individuell konstruierend – teilhaben. Bei einer organisierten Freizeit sind wir üblicherweise gewohnt, diese als eine Veranstaltung zu sehen, welche von Leuten geplant und Schritt für Schritt durchgeführt wird. Aktive Planer auf der einen Seite – mehr oder minder passive Konsumenten auf der anderen. Die Beschreibungen der Story Dealer verhindern schon durch die Art der Darstellung eine solche Perspektive. Nicht nur stellen sie den Charakter der sich entfaltenden Wirklichkeit des Abenteuerurlaubs als einen kooperativen (wenngleich oft recht unbewussten) Prozess zwischen Anbietern und Konsumenten heraus. Sie arbeiten zusätzlich typische Muster dieser Entfaltung sorgfältig heraus und lassen so ein griffiges Bild davon entstehen, was planbar und was nicht planbar ist: Dieser Prozess wird von ihnen als Wechselspiel zwischen Deutungsangeboten und gezielten Irritationen einerseits, Reaktionen auf Zufälligkeiten und Verstärkung einmal eingetretener Eigendynamiken andererseits gesehen und beschrieben (
). Ich sehe Therapie als einen ähnlichen Prozess: als eine Entwicklung des gemeinsamen Findens, Erfindens, Irritierens und Bedeutung-Zuweisens; als ein Phänomen, für welches eine Beschreibung, die das Moment der Kontrolle der Therapeut/inn/en betont, eher unangemessen ist, sondern welches in hohem Maße als kollaborativ anzusehen ist, auch wenn die Lesegewohnheiten vermittelt über unsere Lehrbücher ein anderes Bild suggerieren. Welche Faktoren und Wendepunkte dabei bedeutsam sind, will ich im Folgenden darstellen. Allerdings erhebe ich nicht den Anspruch einer hinreichenden Systematik. Mein Anspruch geht eher – wie übrigens u.a. auch in meinen Therapien – in Richtung einer in sich stimmigen, im besten Falle gut erzählten Geschichte. Mit all den Folgen, welche solche Geschichten wiederum haben können
“
Zum vollständigen Text
10. Juni 2010
von Tom Levold
Keine Kommentare




 Ulrich Clement, den eine lange Arbeits- und Freundschaftsbeziehung mit Ulrike Brandenburg verbandt, hat für das systemagazin einen Nachruf verfasst:„Es gibt nur wenige Menschen, die all das in einer Person vereinen, was sie ausgemacht hat. Ulrike Brandenburg war so ein Mensch. Klugheit, Empathie, Schönheit und Menschlichkeit verband sie mit einer ungeheuren Lebensfreude.
Sie hat sich bis zuletzt gefreut, ein gutes Leben zu haben und das Leben hat sich an ihr gefreut“
Ulrich Clement, den eine lange Arbeits- und Freundschaftsbeziehung mit Ulrike Brandenburg verbandt, hat für das systemagazin einen Nachruf verfasst:„Es gibt nur wenige Menschen, die all das in einer Person vereinen, was sie ausgemacht hat. Ulrike Brandenburg war so ein Mensch. Klugheit, Empathie, Schönheit und Menschlichkeit verband sie mit einer ungeheuren Lebensfreude.
Sie hat sich bis zuletzt gefreut, ein gutes Leben zu haben und das Leben hat sich an ihr gefreut“ Andreas Rothkegel ist Gestalttherapeut mit systemischer Ausbildung und arbeitet als Berater in der ProFamilia-Beratungsstelle Köln. Für den Jahresbericht der Stelle hat er einen sehr lesenswerten Aufsatz über Scham- und Schuldgefühle im Schwangerschaftskonflikt verfasst, der in der
Andreas Rothkegel ist Gestalttherapeut mit systemischer Ausbildung und arbeitet als Berater in der ProFamilia-Beratungsstelle Köln. Für den Jahresbericht der Stelle hat er einen sehr lesenswerten Aufsatz über Scham- und Schuldgefühle im Schwangerschaftskonflikt verfasst, der in der 


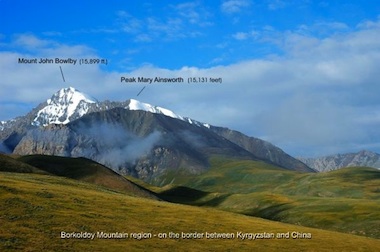
 In seinem Versuch einer postcartesianischen Psychologie, der in Heft 2/2000 der Zeitschrift„systeme“ erschienen ist, schreibt Klaus Kießling, Theologieprofessor und Psychologe sowie Leiter des Seminars für Religionspädagogik, Katechetik und Didaktik sowie des Instituts für Pastoralpsychologie und Spiritualität an der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen (Foto: www.sankt-georgen.de):„Psychologie, wie ich sie kennengelernt habe, hat wichtige emanzipatorische Schritte aus philosophischer Umklammerung vollzogen, läuft aber – in dieser Richtung weiterhin hände- ringend unterwegs – Gefahr, sich dabei ihrer eigenen Wurzeln zu berauben, also saft- und kraftlos zu werden. Einen Brückenbau zwischen Philosophie und Psychologie, näherhin zwischen Phänomenologie und Gestalttheorie einerseits sowie Selbstorganisationskonzepten andererseits halte ich für sehr wichtig: Die Verwindung des Grabens zwischen Philosophie und Psychologie eröffnet letzterer die Möglichkeit, gleichsam ressourcenorientiert vorzugehen, also in einer Weise, wie sie selbst es in Therapietheorien vielerorts lehrt: sie könnte zwar weiterhin andere Disziplinen um Rat bitten – etwa naturwissenschaftliche Fachbereiche – und deren Modelle aufgreifen; sie könnte aber auch einmal ihre eigenen Ressourcen – etwa in der Gestalttheorie – wahr- und ernst nehmen, also auf Hilfe zur Selbsthilfe setzen, anstatt sich damit zu begnügen, auf eine rettende Hand zu warten. Unter Würdigung zentraler Differenzen zwischen beiden Enden einer solchen Brücke möchte ich zeigen, daß sich beide Seiten in der gemeinsamen Abkehr von einer cartesianischen Erkenntnistheorie neu begegnen können. Dabei zeichnet sich eine noch näher zu charakterisierende cartesianische Erkenntnistheorie durch ihren Anspruch auf Letztbegründung und apodikische Gewißheit aus:„Die Erkenntnis soll von einem Zustand des Zweifels aus aufgebaut werden, der durch evidente Intuitionen Schritt um Schritt ausgeräumt und durch unerschütterliche Wahrheiten ersetzt wird“ (Herzog 1991
), so daß sich das erkennende Subjekt an einem archimedischen Punkt findet – jenseits jeder biologischen und biographischen Mittelbarkeit“
In seinem Versuch einer postcartesianischen Psychologie, der in Heft 2/2000 der Zeitschrift„systeme“ erschienen ist, schreibt Klaus Kießling, Theologieprofessor und Psychologe sowie Leiter des Seminars für Religionspädagogik, Katechetik und Didaktik sowie des Instituts für Pastoralpsychologie und Spiritualität an der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen (Foto: www.sankt-georgen.de):„Psychologie, wie ich sie kennengelernt habe, hat wichtige emanzipatorische Schritte aus philosophischer Umklammerung vollzogen, läuft aber – in dieser Richtung weiterhin hände- ringend unterwegs – Gefahr, sich dabei ihrer eigenen Wurzeln zu berauben, also saft- und kraftlos zu werden. Einen Brückenbau zwischen Philosophie und Psychologie, näherhin zwischen Phänomenologie und Gestalttheorie einerseits sowie Selbstorganisationskonzepten andererseits halte ich für sehr wichtig: Die Verwindung des Grabens zwischen Philosophie und Psychologie eröffnet letzterer die Möglichkeit, gleichsam ressourcenorientiert vorzugehen, also in einer Weise, wie sie selbst es in Therapietheorien vielerorts lehrt: sie könnte zwar weiterhin andere Disziplinen um Rat bitten – etwa naturwissenschaftliche Fachbereiche – und deren Modelle aufgreifen; sie könnte aber auch einmal ihre eigenen Ressourcen – etwa in der Gestalttheorie – wahr- und ernst nehmen, also auf Hilfe zur Selbsthilfe setzen, anstatt sich damit zu begnügen, auf eine rettende Hand zu warten. Unter Würdigung zentraler Differenzen zwischen beiden Enden einer solchen Brücke möchte ich zeigen, daß sich beide Seiten in der gemeinsamen Abkehr von einer cartesianischen Erkenntnistheorie neu begegnen können. Dabei zeichnet sich eine noch näher zu charakterisierende cartesianische Erkenntnistheorie durch ihren Anspruch auf Letztbegründung und apodikische Gewißheit aus:„Die Erkenntnis soll von einem Zustand des Zweifels aus aufgebaut werden, der durch evidente Intuitionen Schritt um Schritt ausgeräumt und durch unerschütterliche Wahrheiten ersetzt wird“ (Herzog 1991
), so daß sich das erkennende Subjekt an einem archimedischen Punkt findet – jenseits jeder biologischen und biographischen Mittelbarkeit“