28. Juni 2010
von Tom Levold
Keine Kommentare
 Im von Ralf Wetzel, Jens Aderhold & Jana Rückert-John 2009 herausgegebenen Band„Die Organisation in unruhigen Zeiten. Über die Folgen von Strukturwandel, Veränderungsdruck und Funktionsverschiebung“ (Heidelberg: Carl-Auer-Verlag) ist folgender Beitrag von Peter Fuchs erschienen, dessen Manuskript auch online zu lesen ist:„Wenn man im Blick auf Organisationen von ‚Pressure of change‘ spricht, also die Idee verfolgt, daß diese Sozialsysteme in der Moderne unter Transformationsdrücke geraten und dabei in eine Art sozietale Dystonie verfallen, in eine Unruhe, eine Fahrigkeit, die existenzgefährdend zu wirken scheint, wird typisch übersehen, daß die Ausdifferenzierung von Organisationen eingespannt ist in einen gewaltigen (und nicht selten: krisenhaften) sozialen Wandel, durch den die Moderne bezeichnet werden kann:
Im von Ralf Wetzel, Jens Aderhold & Jana Rückert-John 2009 herausgegebenen Band„Die Organisation in unruhigen Zeiten. Über die Folgen von Strukturwandel, Veränderungsdruck und Funktionsverschiebung“ (Heidelberg: Carl-Auer-Verlag) ist folgender Beitrag von Peter Fuchs erschienen, dessen Manuskript auch online zu lesen ist:„Wenn man im Blick auf Organisationen von ‚Pressure of change‘ spricht, also die Idee verfolgt, daß diese Sozialsysteme in der Moderne unter Transformationsdrücke geraten und dabei in eine Art sozietale Dystonie verfallen, in eine Unruhe, eine Fahrigkeit, die existenzgefährdend zu wirken scheint, wird typisch übersehen, daß die Ausdifferenzierung von Organisationen eingespannt ist in einen gewaltigen (und nicht selten: krisenhaften) sozialen Wandel, durch den die Moderne bezeichnet werden kann:  in die funktionale Differenzierung der Gesellschaft. Organisationen entstehen, wenn man es klassisch formulieren will, als Reaktion auf den Zusammenbruch der stratifizierten Ordnung des Mittelalters. Deutliches Anzeichen dafür ist, daß die europäische Ständeordnung nur wenige organisationsähnliche Einheiten kannte: die Fugger etwa, die Hanse, Söldnerheere, Zünfte, Städte, die katholische Kirche. Die Gegenwart ist jedoch gekennzeichnet durch eine Überfülle von Organisationen, die selbst das alltägliche Leben dominieren: als Unausweichlichkeit, wenn man zum Arzt will, Benzin benötigt, Brautkleider kauft, Energie verbrauchen muß, wählen möchte, etc.pp. Kurz: Die These ist, daß die Organisation Resultat eines immensen gesellschaftlichen Evolutionsschubes ist. Ihre Form läßt sich beobachten als Lösung bestimmter Probleme, die aus diesem Schub abgeleitet werden können. ‚Pressure of change‘ als Sammelausdruck für Schwierigkeiten der Organisationen (oder für eine Funktion des Jammerns über solche Schwierigkeiten) müßte sich dann darauf beziehen, daß es diesen Sozialsystemen nicht mehr umstandslos gelingt, ihre Funktion auszuüben. Wir nehmen an, daß die Ursache dafür im Grunde durch das Problem generiert wird, als dessen Lösung Organisationen gedeutet werden können“
in die funktionale Differenzierung der Gesellschaft. Organisationen entstehen, wenn man es klassisch formulieren will, als Reaktion auf den Zusammenbruch der stratifizierten Ordnung des Mittelalters. Deutliches Anzeichen dafür ist, daß die europäische Ständeordnung nur wenige organisationsähnliche Einheiten kannte: die Fugger etwa, die Hanse, Söldnerheere, Zünfte, Städte, die katholische Kirche. Die Gegenwart ist jedoch gekennzeichnet durch eine Überfülle von Organisationen, die selbst das alltägliche Leben dominieren: als Unausweichlichkeit, wenn man zum Arzt will, Benzin benötigt, Brautkleider kauft, Energie verbrauchen muß, wählen möchte, etc.pp. Kurz: Die These ist, daß die Organisation Resultat eines immensen gesellschaftlichen Evolutionsschubes ist. Ihre Form läßt sich beobachten als Lösung bestimmter Probleme, die aus diesem Schub abgeleitet werden können. ‚Pressure of change‘ als Sammelausdruck für Schwierigkeiten der Organisationen (oder für eine Funktion des Jammerns über solche Schwierigkeiten) müßte sich dann darauf beziehen, daß es diesen Sozialsystemen nicht mehr umstandslos gelingt, ihre Funktion auszuüben. Wir nehmen an, daß die Ursache dafür im Grunde durch das Problem generiert wird, als dessen Lösung Organisationen gedeutet werden können“
Zum vollständigen Text



 In Heft 2/2004 der Zeitschrift systeme erschien ein Beitrag von Stefan Geyerhofer (Foto: www.oeas.at), Johannes Ebmer und Katharina Pucandl, der die Bedeutung der KlientInnenzufriedenheit für die Qualitätssicherung in Systemischer Psychotherapie untersucht:„Anhand einer am Institut für Systemische Therapie (IST) in Wien durchgeführten Evaluationsstudie werden die Ausgangssituation und konkrete Möglichkeiten zur Erfassung der KlientInnenzufriedenheit beschrieben. Ausgewählte, erste Ergebnisse zum Thema Dauer der Therapie, Anzahl der Sitzungen und zur Generalisierung erreichter Lösungen werden beispielhaft mit ihrem Nutzen für die konkrete therapeutische Arbeit, im Sinne der Erhaltung und Verbesserung der Qualität Systemischer Psychotherapie dargestellt. Die Bedeutung und Reliabilität von telefonischen Follow Up Befragungen für die Erfassung von Therapieerfolgen wird diskutiert“ Der Beitrag ist auch online zu lesen,
In Heft 2/2004 der Zeitschrift systeme erschien ein Beitrag von Stefan Geyerhofer (Foto: www.oeas.at), Johannes Ebmer und Katharina Pucandl, der die Bedeutung der KlientInnenzufriedenheit für die Qualitätssicherung in Systemischer Psychotherapie untersucht:„Anhand einer am Institut für Systemische Therapie (IST) in Wien durchgeführten Evaluationsstudie werden die Ausgangssituation und konkrete Möglichkeiten zur Erfassung der KlientInnenzufriedenheit beschrieben. Ausgewählte, erste Ergebnisse zum Thema Dauer der Therapie, Anzahl der Sitzungen und zur Generalisierung erreichter Lösungen werden beispielhaft mit ihrem Nutzen für die konkrete therapeutische Arbeit, im Sinne der Erhaltung und Verbesserung der Qualität Systemischer Psychotherapie dargestellt. Die Bedeutung und Reliabilität von telefonischen Follow Up Befragungen für die Erfassung von Therapieerfolgen wird diskutiert“ Der Beitrag ist auch online zu lesen,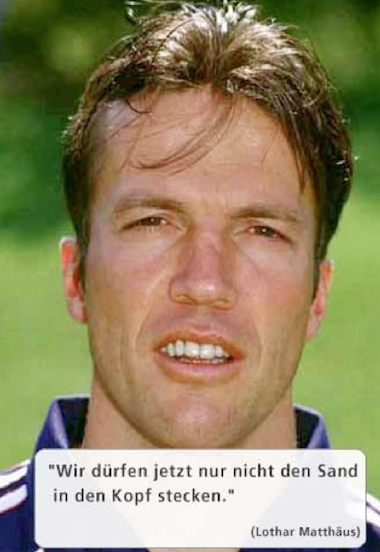
 Bereits 1997, also noch vor dem Inkrafttreten des Psychotherapeutengesetzes mit seiner Betonung der Notwendigkeit der„Wissenschaftlichen Fundierung“ von Psychotherapie-Verfahren, hat Jürgen Kriz einen kritischen Aufsatz über das Verhältnis von Forschung und Praxis in der Psychotherapie in„Psychotherapie Forum“ veröffentlicht, das in systhema nachgedruckt wurde und dortselbst auch online zu lesen ist:„Das Verhältnis zwischen Praxis und Theorie läßt sich als Verhältnis von Landschaft zu Landkarte charakterisieren: Therapeuten sind dann Menschen, deren Qualität sich vornehmlich daran zu zeigen hat, wie sie die Landschaft durchwandern (als begleitende Führer derer, die sich ihnen anvertrauen), wie sie dabei Hindernisse zu überwinden, Gefahren zu erspüren, eisige Nächte und trockene Wüsten zu durchstehen vermögen. Von ganz anderer Art sind die Anforderungen an Kartographen – d. h. die Theoretiker und Forscher: Die Karten, die sie zeichnen, müssen z.B. möglichst klar, detailliert und doch handhabbar sein. Die alte Leitidee, Landkarten sollten wahr sein, hat hingegen die wissenschaftstheoretische Debatte inzwischen – und das nicht erst in der Postmoderne – als science fiction, als Fiktion von Wissenschaft, entlarvt. Es kann nämlich unendlich viele Abbildungen einer Landschaft (z.B. der Stadt Zürich) geben – und ich wähle für einen Moment dieses konkrete Beispiel Zürich, da es mir eher weniger komplex und eher handhabbar erscheint als die Landschaft Psychotherapie: Eine grobe sight-seeing-map ist nicht unwahrer als eine präzise 1:1000 Darstellung der Ebene, sie dient nur anderen Zwecken. Für viele Zwecke ist die sight-seeing-map wegen ihrer Übersichtlichkeit und leichteren Handhabbarkeit aber nicht nur nützlicher, sondern sogar auch präziser als ein dickes und schweres Kartenwerk – so z.B. hinsichtlich der Frage, was viele Menschen gerne besichtigen. Zudem enthält auch das schwerste, umfangreichste Kartenwerk grundsätzlich unendlich viele Aspekte nicht (z. B. über Luftverschmutzung zu einem bestimmten Zeitpunkt, die Vernetzung mit Telefonen, die Besuchshäufigkeit zwischen den Menschen). Wenn man solche Fragen hat, können und müssen Spezialkarten erstellt werden. Damit wird auch sofort deutlich, daß es das Kartenwerk – sprich: die Theorie – nicht geben kann. Man sollte sich daher nicht durch vollmundige Behauptungen mancher Psychotherapieforscher – wie: man habe alles erfaßt und objektiv richtig wiedergegeben – mundtot oder kritikunfähig machen“
Bereits 1997, also noch vor dem Inkrafttreten des Psychotherapeutengesetzes mit seiner Betonung der Notwendigkeit der„Wissenschaftlichen Fundierung“ von Psychotherapie-Verfahren, hat Jürgen Kriz einen kritischen Aufsatz über das Verhältnis von Forschung und Praxis in der Psychotherapie in„Psychotherapie Forum“ veröffentlicht, das in systhema nachgedruckt wurde und dortselbst auch online zu lesen ist:„Das Verhältnis zwischen Praxis und Theorie läßt sich als Verhältnis von Landschaft zu Landkarte charakterisieren: Therapeuten sind dann Menschen, deren Qualität sich vornehmlich daran zu zeigen hat, wie sie die Landschaft durchwandern (als begleitende Führer derer, die sich ihnen anvertrauen), wie sie dabei Hindernisse zu überwinden, Gefahren zu erspüren, eisige Nächte und trockene Wüsten zu durchstehen vermögen. Von ganz anderer Art sind die Anforderungen an Kartographen – d. h. die Theoretiker und Forscher: Die Karten, die sie zeichnen, müssen z.B. möglichst klar, detailliert und doch handhabbar sein. Die alte Leitidee, Landkarten sollten wahr sein, hat hingegen die wissenschaftstheoretische Debatte inzwischen – und das nicht erst in der Postmoderne – als science fiction, als Fiktion von Wissenschaft, entlarvt. Es kann nämlich unendlich viele Abbildungen einer Landschaft (z.B. der Stadt Zürich) geben – und ich wähle für einen Moment dieses konkrete Beispiel Zürich, da es mir eher weniger komplex und eher handhabbar erscheint als die Landschaft Psychotherapie: Eine grobe sight-seeing-map ist nicht unwahrer als eine präzise 1:1000 Darstellung der Ebene, sie dient nur anderen Zwecken. Für viele Zwecke ist die sight-seeing-map wegen ihrer Übersichtlichkeit und leichteren Handhabbarkeit aber nicht nur nützlicher, sondern sogar auch präziser als ein dickes und schweres Kartenwerk – so z.B. hinsichtlich der Frage, was viele Menschen gerne besichtigen. Zudem enthält auch das schwerste, umfangreichste Kartenwerk grundsätzlich unendlich viele Aspekte nicht (z. B. über Luftverschmutzung zu einem bestimmten Zeitpunkt, die Vernetzung mit Telefonen, die Besuchshäufigkeit zwischen den Menschen). Wenn man solche Fragen hat, können und müssen Spezialkarten erstellt werden. Damit wird auch sofort deutlich, daß es das Kartenwerk – sprich: die Theorie – nicht geben kann. Man sollte sich daher nicht durch vollmundige Behauptungen mancher Psychotherapieforscher – wie: man habe alles erfaßt und objektiv richtig wiedergegeben – mundtot oder kritikunfähig machen“
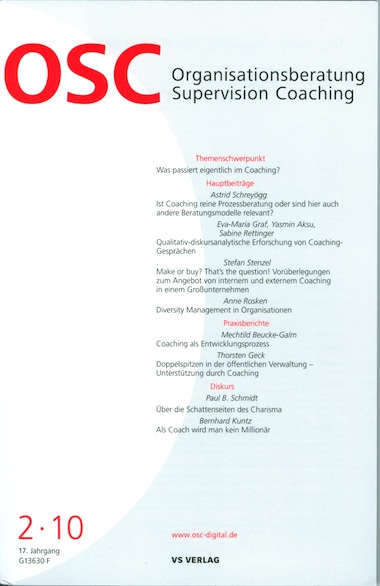


 Im von Ralf Wetzel, Jens Aderhold & Jana Rückert-John 2009 herausgegebenen Band„Die Organisation in unruhigen Zeiten. Über die Folgen von Strukturwandel, Veränderungsdruck und Funktionsverschiebung“ (Heidelberg: Carl-Auer-Verlag) ist folgender Beitrag von Peter Fuchs erschienen, dessen Manuskript auch online zu lesen ist:„Wenn man im Blick auf Organisationen von ‚Pressure of change‘ spricht, also die Idee verfolgt, daß diese Sozialsysteme in der Moderne unter Transformationsdrücke geraten und dabei in eine Art sozietale Dystonie verfallen, in eine Unruhe, eine Fahrigkeit, die existenzgefährdend zu wirken scheint, wird typisch übersehen, daß die Ausdifferenzierung von Organisationen eingespannt ist in einen gewaltigen (und nicht selten: krisenhaften) sozialen Wandel, durch den die Moderne bezeichnet werden kann:
Im von Ralf Wetzel, Jens Aderhold & Jana Rückert-John 2009 herausgegebenen Band„Die Organisation in unruhigen Zeiten. Über die Folgen von Strukturwandel, Veränderungsdruck und Funktionsverschiebung“ (Heidelberg: Carl-Auer-Verlag) ist folgender Beitrag von Peter Fuchs erschienen, dessen Manuskript auch online zu lesen ist:„Wenn man im Blick auf Organisationen von ‚Pressure of change‘ spricht, also die Idee verfolgt, daß diese Sozialsysteme in der Moderne unter Transformationsdrücke geraten und dabei in eine Art sozietale Dystonie verfallen, in eine Unruhe, eine Fahrigkeit, die existenzgefährdend zu wirken scheint, wird typisch übersehen, daß die Ausdifferenzierung von Organisationen eingespannt ist in einen gewaltigen (und nicht selten: krisenhaften) sozialen Wandel, durch den die Moderne bezeichnet werden kann: 
