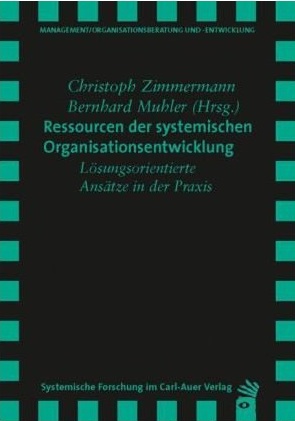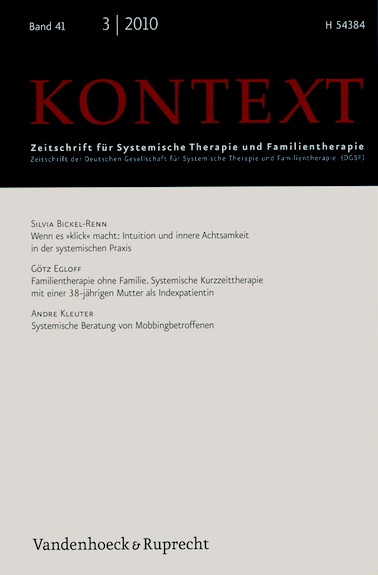15. September 2010
von Tom Levold
Keine Kommentare
In einem interessanten Aufsatz kritisiert der Soziologe Richard Münch die Verwendung des Autopoiese-Begriffs in der Theorie Niklas Luhmanns, die in erster Linie rein analytisch angelegt sei, aber über keine empirische Deckung verfüge:„Der Begriff der strukturellen Kopplung ist eine Antwort von Luhmann, die ihm durch eine zunehmende Kritik aufgezwungen wurde. Diese konnte zeigen, dass die empirische Autonomie von Systemen vor allem von Faktoren konstituiert wird, die sich außerhalb dieser Systeme befindet. Tatsächlich ist die Einführung der strukturellen Kopplungen in das Theoriegebäude nichts geringeres als der Zusammenbruch der Theorie des autopoietischen Systems selbst. Wie kann sich ein System durch seine eigenen Operationen und durch nichts als diese Operationen reproduzieren, wenn wir erfahren, dass seine Existenz gleichzeitig von Operationen abhängt, die außerhalb des Systems selbst liegen? Ein autopoietisches System reproduziert sich selbst, weil es die Fähigkeit besitzt, seine Elemente empirisch und nicht nur analytisch zu reproduzieren. Ein autopoietisches Rechtssystem müsste seine Definitionen von rechtlich richtig oder falsch empirisch reproduzieren. Dies ist jedoch weit von der Wirklichkeit entfernt, weil die empirische Definition von rechtlich richtig oder falsch, der rechtliche Code und noch mehr das Rechtsprogramm nicht nur von eindeutig rechtlichen Konzepten abhängen, sondern auch von kulturellen Gerechtigkeitskonzepten, vom Vertrauen der Menschen in die Gerichte, von der Durchsetzungskraft der juristischen Berufe, von Zahlungen für juristische Dienstleistungen und von politischen Konstellationen. Damit ist die Definition, was rechtlich richtig oder falsch ist, empirisch ein rechtlicher, kultureller, gemeinschaftlicher, ökonomischer und politischer Akt zugleich. Die Autonomie des Rechtssystems in modernen Gesellschaften ist nicht einem wundersamen Zusammentreffen von Autopoiesis und struktureller Kopplung in einem evolutionären Prozess geschuldet, sondern ist ein sehr zerbrechliches Ergebnis von andauernden und niemals endenden kulturellen, gemeinschaftlichen, rechtlichen, ökonomischen und politischen Kämpfen um die Definition des rechtlichen Codes und Programms“ Der Aufsatz ist in einem von Gerhard Preyer, Georg Peter und Alexander Ulfig herausgegebenen Sammelband erschienen, der u.a. auch Beiträge von Luhmann selbst enthält und als Open-Access-Buch bei Humanities Online im Velbrück-Verlag im PDF-Format heruntergeladen werden kann.
Zum Online-Buch