 „According to its supporters, integrated care increases collaboration, improves care, and makes psychotherapy more central to health care and of course, saves insurance companies and public funders a ton of money. What the proposed advantages obscure is the inevitability that, in the name of integration, psychotherapy will become ever more dom- inated by the assumptions and practices of the medical model; that much like an overpowered civilization in the sci-fi adventure Star Trek, we will be assimilated into the medical Borg. The mental health professional of the coming integrated care era (
) will be a specialist in treating specific disorders with highly standardized, scientifically proven interventions. At issue here are not the advantages of greater collaboration with health care professionals or of bringing a psychological or systemic perspective to bear on medical conditions. Rather, at issue is whether we will lose our autonomy as a profession by becoming immersed in the powerful culture of biomedicine, breaking the already tenuous connection to our nonmedical, relational identity. The resulting influx of potential mental health clients into the primary care setting will further promote the conceptualization of mental ‚disorders‘ as biologically based and increase current trends toward medication solutions“ (In: The Heroic Client. A Revolutionary Way to Improve Effectiveness Through Client-Directed, Outcome-Informed Therapy. Jossey-Bass, San Francisco 2004, 2. Ed., S. 5)
„According to its supporters, integrated care increases collaboration, improves care, and makes psychotherapy more central to health care and of course, saves insurance companies and public funders a ton of money. What the proposed advantages obscure is the inevitability that, in the name of integration, psychotherapy will become ever more dom- inated by the assumptions and practices of the medical model; that much like an overpowered civilization in the sci-fi adventure Star Trek, we will be assimilated into the medical Borg. The mental health professional of the coming integrated care era (
) will be a specialist in treating specific disorders with highly standardized, scientifically proven interventions. At issue here are not the advantages of greater collaboration with health care professionals or of bringing a psychological or systemic perspective to bear on medical conditions. Rather, at issue is whether we will lose our autonomy as a profession by becoming immersed in the powerful culture of biomedicine, breaking the already tenuous connection to our nonmedical, relational identity. The resulting influx of potential mental health clients into the primary care setting will further promote the conceptualization of mental ‚disorders‘ as biologically based and increase current trends toward medication solutions“ (In: The Heroic Client. A Revolutionary Way to Improve Effectiveness Through Client-Directed, Outcome-Informed Therapy. Jossey-Bass, San Francisco 2004, 2. Ed., S. 5)
14. September 2010
von Tom Levold
Keine Kommentare


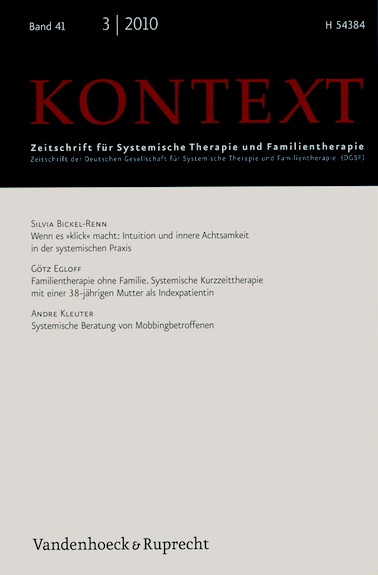


 Auf der website der EFTA findet sich ein sehr persönlicher Bericht von Juan Luis Linares, früherer Vorsitzender der EFTA, über seinen Lernprozess als Therapeut:„However as an art, therapy desperately needs learning III or deutero-learning, Socratic maieutics, aporia, perplexity. And it is here that a factor as important as motivation enters the equation: seduction. The irresistible attraction felt when faced with a certain experience takes us by surprise at an unexpected moment in which the subject becomes aware of something indefinable that has taken hold of and awakened him or her. This seduction may be caused by another person, generally a lecturer or teacher in the case of learning processes, but it may also emerge out of practice and be associated with experiences which have such an impact on the subject that they induce change. Naturally, there are no objective laws that govern such experiences, and we can never be sure which people or situations we will find ourselves being seduced by. What follows is a series of cases or situations, involving individuals or families, which have had a determining influence on me. In all of them I have learnt something important that, in one way or another, has become incorporated into my way of understanding the clinical practice of family therapy. In other words, these people or situations have influenced not only my way of working but also my corresponding theoretical development. For that reason, they can be considered as the co-authors of my therapeutic model“
Auf der website der EFTA findet sich ein sehr persönlicher Bericht von Juan Luis Linares, früherer Vorsitzender der EFTA, über seinen Lernprozess als Therapeut:„However as an art, therapy desperately needs learning III or deutero-learning, Socratic maieutics, aporia, perplexity. And it is here that a factor as important as motivation enters the equation: seduction. The irresistible attraction felt when faced with a certain experience takes us by surprise at an unexpected moment in which the subject becomes aware of something indefinable that has taken hold of and awakened him or her. This seduction may be caused by another person, generally a lecturer or teacher in the case of learning processes, but it may also emerge out of practice and be associated with experiences which have such an impact on the subject that they induce change. Naturally, there are no objective laws that govern such experiences, and we can never be sure which people or situations we will find ourselves being seduced by. What follows is a series of cases or situations, involving individuals or families, which have had a determining influence on me. In all of them I have learnt something important that, in one way or another, has become incorporated into my way of understanding the clinical practice of family therapy. In other words, these people or situations have influenced not only my way of working but also my corresponding theoretical development. For that reason, they can be considered as the co-authors of my therapeutic model“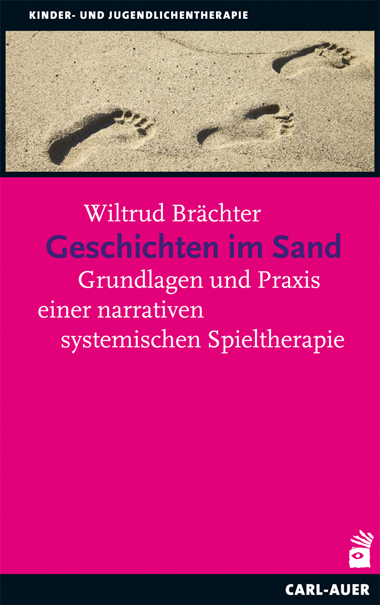
 Können Katastrophenschützer vom systemischen Ansatz profitieren? Detlef Mamrot (Foto: www.ibs-brandschutz.com) ist von der IK Bau NRW anerkannter Sachverständiger für die Prüfung des Brandschutzes und von der IHK Wuppertal-Solingen-Remscheid öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für„Vorbeugender Brandschutz“. Darüber hinaus ist er Mitbegründer der„Schule für vernetztes Denken – Hebewerk“ in Wuppertal. Hebewerk ist Lizenznehmer und Anwender des Sensitivitätsmodells von Prof. Frederic Vester und bereitet den Einsatz dieses Verfahrens im Katastrophenschutz vor. Der Beitrag über das„Komplexitätssyndrom“ stellt eine „systemisch-konstruktivistische Untersuchung über die Wechselwirkung zwischen der dynamischen Komplexität von Systemen und deren Neigung zu Katastrophenereignissen mit dem Ziel der Entwicklung eines Komplexitätsmodells als Grundlage zur Kontrolle und Überwachung eines sich dynamisch verändernden Katastrophenpotentials in Organisationen“ dar.
Können Katastrophenschützer vom systemischen Ansatz profitieren? Detlef Mamrot (Foto: www.ibs-brandschutz.com) ist von der IK Bau NRW anerkannter Sachverständiger für die Prüfung des Brandschutzes und von der IHK Wuppertal-Solingen-Remscheid öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für„Vorbeugender Brandschutz“. Darüber hinaus ist er Mitbegründer der„Schule für vernetztes Denken – Hebewerk“ in Wuppertal. Hebewerk ist Lizenznehmer und Anwender des Sensitivitätsmodells von Prof. Frederic Vester und bereitet den Einsatz dieses Verfahrens im Katastrophenschutz vor. Der Beitrag über das„Komplexitätssyndrom“ stellt eine „systemisch-konstruktivistische Untersuchung über die Wechselwirkung zwischen der dynamischen Komplexität von Systemen und deren Neigung zu Katastrophenereignissen mit dem Ziel der Entwicklung eines Komplexitätsmodells als Grundlage zur Kontrolle und Überwachung eines sich dynamisch verändernden Katastrophenpotentials in Organisationen“ dar.