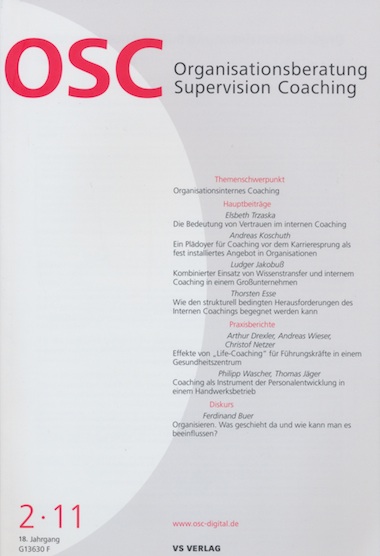Schneller geht’s kaum. Der Kongress hat vom 1. bis zum 3. Juli getagt und nun liegt schon der begeisterte und anregende Tagungsbericht von Andreas Manteufel aus Bonn vor:„Gehens auch zum Ärztekongress?, fragt mich die freundliche Pensionswirtin bei meiner Ankunft in der Mozartstadt. Ich vermute, dass sie eine andere Veranstaltung meint und erkläre, dass ich an einer Tagung über Gehirnforschung und Psychotherapie teilnehme, die viele Berufsgruppen zusammenführt, neben Ärzten auch Psychologen, Philosophen, Sozialwissenschaftler, und neben Wissenschaftlern auch viele Psychotherapeuten. Das ist uns egal, wir sagen Ärztekongress, das ist einfacher, unterweist sie mich darin, dass es sich keineswegs um ein Missverständnis, sondern eher um eine verständliche Komplexitätsreduktion handelt. Neurobiologie der Psychotherapie Perspektiven und systemtherapeutische Innovationen ist für Nichteingeweihte ja auch ein bisschen sperrig“, schreibt Manteufel und erzählt – eingerahmt von eigenen Bildern – dann durchaus nachvollziehbar, was es auf dem Kongress zu hören und zu sehen gab.
Schneller geht’s kaum. Der Kongress hat vom 1. bis zum 3. Juli getagt und nun liegt schon der begeisterte und anregende Tagungsbericht von Andreas Manteufel aus Bonn vor:„Gehens auch zum Ärztekongress?, fragt mich die freundliche Pensionswirtin bei meiner Ankunft in der Mozartstadt. Ich vermute, dass sie eine andere Veranstaltung meint und erkläre, dass ich an einer Tagung über Gehirnforschung und Psychotherapie teilnehme, die viele Berufsgruppen zusammenführt, neben Ärzten auch Psychologen, Philosophen, Sozialwissenschaftler, und neben Wissenschaftlern auch viele Psychotherapeuten. Das ist uns egal, wir sagen Ärztekongress, das ist einfacher, unterweist sie mich darin, dass es sich keineswegs um ein Missverständnis, sondern eher um eine verständliche Komplexitätsreduktion handelt. Neurobiologie der Psychotherapie Perspektiven und systemtherapeutische Innovationen ist für Nichteingeweihte ja auch ein bisschen sperrig“, schreibt Manteufel und erzählt – eingerahmt von eigenen Bildern – dann durchaus nachvollziehbar, was es auf dem Kongress zu hören und zu sehen gab.
Zum vollständigen Tagungsbericht
12. Juli 2011
von Tom Levold
Keine Kommentare

 Vor einigen Wochen war an dieser Stelle ein Vorabdruck aus Peter Fuchs‘ neuem Buch„Die Verwaltung der vagen Dinge“ (Zur Zukunft der Psychotherapie) zu lesen. Im Jahre 2000 erschien von ihm in Koproduktion mit Enrico Mahler in der Zeitschrift„Soziale Systeme“ ein komplexer Text zur„Form und Funktion von Beratung“, der an der„alteuropäischen“ Unterscheidung von Rat und Tat ansetzt und die Beratung nicht als gesellschaftliches Funktionssystem analysiert (wie es ja häufig geschieht), sondern als als„ein Schema der Kommunikation, das in allen gesellschaftlichen Kontexten anwählbar geworden ist“, dessen Funktion unter anderem die„Ausbremsung reflexiver Temporalisierung“ ist, was wiederum erlaubt, die Tat respektive das Handeln der zu Beratenden zu verzögern. In der Einleitung heißt es launig:„Die moderne Gesellschaft erzeugt in einem hohen Masse das Phänomen der Beratung. Zumindest in den Kern- und Schlüsselzonen funktionaler Differenzierung wird kaum jemand den Beratungsangeboten entkommen, die von Ernährungs- und Gesundheitsberatung über Klimakteriumsproblemberatung für Männer in den Endvierzigern, von Ehe- über Partnerschaftsberatung bis hin zu Unternehmens- und Politikberatung reichen und insofern längst reflexiv geworden sind, als die Beratung ihrerseits beraten werden kann durch eigens dafür installierte Beraterberatungen.[1] Bereiche des Helfens und des Heilens (Soziale Arbeit etwa oder systemisch inspirierte Familientherapie) definieren ihre Tätigkeiten seit einiger Zeit als Beraten und scheinen damit, wenn man auf einschlägige Studiengänge und deren Ausstattung mit Lehrgebieten achtet, nicht gerade wenig Erfolg zu haben.[2] Unter diesen Bedingungen läßt sich die moderne Gesellschaft, wenn man auf summarische Kennzeichnungen Wert legt, als Beratungsgesellschaft beschreiben (Fuchs 1994a). Es könnte angesichts dieser Lage aber auch nützlich sein, die Frage zu stellen, was durch Beratung unterschieden wird und wovon sie sich unterscheidet. Wir fragen damit nach der Form der Beratung. Die Annahme lautet, dass diese Form sich als ein zeitbasiertes Schema dem Medium der Kommunikation einschreibt und unter bestimmten sozialen Voraussetzungen doppelt plausibel wird: als anschlussfähige Kommunikation eines Aufschubs und als Option für Leute und Organisationen.[3] Der Grund dafür ist aber nicht unbedingt, dass Beratung als Beratung funktioniert“ Der Text ist seit kurzem auch online zu lesen,
Vor einigen Wochen war an dieser Stelle ein Vorabdruck aus Peter Fuchs‘ neuem Buch„Die Verwaltung der vagen Dinge“ (Zur Zukunft der Psychotherapie) zu lesen. Im Jahre 2000 erschien von ihm in Koproduktion mit Enrico Mahler in der Zeitschrift„Soziale Systeme“ ein komplexer Text zur„Form und Funktion von Beratung“, der an der„alteuropäischen“ Unterscheidung von Rat und Tat ansetzt und die Beratung nicht als gesellschaftliches Funktionssystem analysiert (wie es ja häufig geschieht), sondern als als„ein Schema der Kommunikation, das in allen gesellschaftlichen Kontexten anwählbar geworden ist“, dessen Funktion unter anderem die„Ausbremsung reflexiver Temporalisierung“ ist, was wiederum erlaubt, die Tat respektive das Handeln der zu Beratenden zu verzögern. In der Einleitung heißt es launig:„Die moderne Gesellschaft erzeugt in einem hohen Masse das Phänomen der Beratung. Zumindest in den Kern- und Schlüsselzonen funktionaler Differenzierung wird kaum jemand den Beratungsangeboten entkommen, die von Ernährungs- und Gesundheitsberatung über Klimakteriumsproblemberatung für Männer in den Endvierzigern, von Ehe- über Partnerschaftsberatung bis hin zu Unternehmens- und Politikberatung reichen und insofern längst reflexiv geworden sind, als die Beratung ihrerseits beraten werden kann durch eigens dafür installierte Beraterberatungen.[1] Bereiche des Helfens und des Heilens (Soziale Arbeit etwa oder systemisch inspirierte Familientherapie) definieren ihre Tätigkeiten seit einiger Zeit als Beraten und scheinen damit, wenn man auf einschlägige Studiengänge und deren Ausstattung mit Lehrgebieten achtet, nicht gerade wenig Erfolg zu haben.[2] Unter diesen Bedingungen läßt sich die moderne Gesellschaft, wenn man auf summarische Kennzeichnungen Wert legt, als Beratungsgesellschaft beschreiben (Fuchs 1994a). Es könnte angesichts dieser Lage aber auch nützlich sein, die Frage zu stellen, was durch Beratung unterschieden wird und wovon sie sich unterscheidet. Wir fragen damit nach der Form der Beratung. Die Annahme lautet, dass diese Form sich als ein zeitbasiertes Schema dem Medium der Kommunikation einschreibt und unter bestimmten sozialen Voraussetzungen doppelt plausibel wird: als anschlussfähige Kommunikation eines Aufschubs und als Option für Leute und Organisationen.[3] Der Grund dafür ist aber nicht unbedingt, dass Beratung als Beratung funktioniert“ Der Text ist seit kurzem auch online zu lesen, „Ein Höhepunkt der letzten Zeit war für mich der unerwartete Besuch von Anja, Tochter eines einstmals mit uns befreundeten Paares, das seit zehn Jahren geschieden ist. Wir haben Anja lange nicht gesehen. Kein Wunder. Denn unser Loyalitätskonflikt mit den getrennten Freunden beeinträchtigte während Jahren die Beziehung zwischen ihrer Tochter und uns.
„Ein Höhepunkt der letzten Zeit war für mich der unerwartete Besuch von Anja, Tochter eines einstmals mit uns befreundeten Paares, das seit zehn Jahren geschieden ist. Wir haben Anja lange nicht gesehen. Kein Wunder. Denn unser Loyalitätskonflikt mit den getrennten Freunden beeinträchtigte während Jahren die Beziehung zwischen ihrer Tochter und uns.
 Mit seinem Buch Das erschöpfte Selbst. Depression und Gesellschaft in der Gegenwart ist der französische Soziologe Alain Ehrenberg 2004 auch einem deutschen Publikum bekannt geworden. Darin erklärt er den Aufstieg der Depression zur Volkskrankheit mit den zunehmenden inneren und äußeren Anforderungen, denen die Menschen im Zeitalter des Flexiblen Kapitalismus in ihren Arbeitsprozessen und Beschäftigungsverhältnissen immer stärker ausgesetzt sind. Rudi Schmiede, Professor für Soziologie an der TU Darmstadt (Foto: ifs-tu.darmstadt.de) hat in einem 2011 von Cornelia Koppetsch im VS-Verlag herausgegebenen Sammelband Die Innenwelten des Kapitalismus einen Aufsatz mit dem Titel Macht Arbeit depressiv? Psychische Erkrankungen im flexiblen Kapitalismus verfasst, in dem er Ehrenbergs These bekräftigt: Was folgt aus dieser Diagnose? Für die wissenschaftlichen Bemühungen lässt sich das Postulat formulieren, dass die Arbeits-, Organisations-, Industrie- und Technikforschung ihren Blick stärker auf das Individuum inihrem jeweiligen Untersuchungsfeld richten und weiterentwickeln sollte. Oft vernachlässigte Bereiche der Innenwelten des Kapitalismus wie z.B. die im Kontext von Zielvereinbarungen oder von Projektarbeit veränderten Entlohnungssysteme oder die Vielfalt der (Weiter-)Bildungssysteme und -wege und die damit zusammenhängenden Karrierewege verdienen erhöhte Aufmerksamkeit. Ferner ist die biographische Dimension von Arbeit und Beschäftigung in der Forschung nach wie vor unterbelichtet. Die Forschung müsste deutlich stärker als bisher von der Erkenntnis ausgehen, dass die Wirksamkeit der beschriebenen disziplinierenden, prägenden und potentiell pathogenen Einflussfaktoren direkt mit dem Grad der Unmittelbarkeit der ökonomische markt- und machtvermittelten Durchgriffe des Weltmarkts auf die Individuen, Arbeitsgruppen oder Betriebseinheiten zusammenhängt. Damit sind auch Folgerungen für die Gestaltung der Realität angesprochen: Jede Strategie zur Entkoppelung oder zumindest Dämpfung dieser Unmittelbarkeit ist förderlich, um den Druck auf die Individuen zu vermindern. Der Aufsatz ist auch im Internet zu lesen,
Mit seinem Buch Das erschöpfte Selbst. Depression und Gesellschaft in der Gegenwart ist der französische Soziologe Alain Ehrenberg 2004 auch einem deutschen Publikum bekannt geworden. Darin erklärt er den Aufstieg der Depression zur Volkskrankheit mit den zunehmenden inneren und äußeren Anforderungen, denen die Menschen im Zeitalter des Flexiblen Kapitalismus in ihren Arbeitsprozessen und Beschäftigungsverhältnissen immer stärker ausgesetzt sind. Rudi Schmiede, Professor für Soziologie an der TU Darmstadt (Foto: ifs-tu.darmstadt.de) hat in einem 2011 von Cornelia Koppetsch im VS-Verlag herausgegebenen Sammelband Die Innenwelten des Kapitalismus einen Aufsatz mit dem Titel Macht Arbeit depressiv? Psychische Erkrankungen im flexiblen Kapitalismus verfasst, in dem er Ehrenbergs These bekräftigt: Was folgt aus dieser Diagnose? Für die wissenschaftlichen Bemühungen lässt sich das Postulat formulieren, dass die Arbeits-, Organisations-, Industrie- und Technikforschung ihren Blick stärker auf das Individuum inihrem jeweiligen Untersuchungsfeld richten und weiterentwickeln sollte. Oft vernachlässigte Bereiche der Innenwelten des Kapitalismus wie z.B. die im Kontext von Zielvereinbarungen oder von Projektarbeit veränderten Entlohnungssysteme oder die Vielfalt der (Weiter-)Bildungssysteme und -wege und die damit zusammenhängenden Karrierewege verdienen erhöhte Aufmerksamkeit. Ferner ist die biographische Dimension von Arbeit und Beschäftigung in der Forschung nach wie vor unterbelichtet. Die Forschung müsste deutlich stärker als bisher von der Erkenntnis ausgehen, dass die Wirksamkeit der beschriebenen disziplinierenden, prägenden und potentiell pathogenen Einflussfaktoren direkt mit dem Grad der Unmittelbarkeit der ökonomische markt- und machtvermittelten Durchgriffe des Weltmarkts auf die Individuen, Arbeitsgruppen oder Betriebseinheiten zusammenhängt. Damit sind auch Folgerungen für die Gestaltung der Realität angesprochen: Jede Strategie zur Entkoppelung oder zumindest Dämpfung dieser Unmittelbarkeit ist förderlich, um den Druck auf die Individuen zu vermindern. Der Aufsatz ist auch im Internet zu lesen,