29. Juni 2012
von Tom Levold
Keine Kommentare
28. Juni 2012
von Tom Levold
Keine Kommentare
Einladung zur DGSF-Jahrestagung 2012 in Freiburg vom 3.-6.10.212: Dialog der Kulturen – Kulturen des Dialogs
Im Juni 2011 trafen sich in Freiburg zum wiederholten Mal AusbildungsleiterInnen aus fünf Kontinenten. Die Gruppe arbeitet seit Jahren zusammen an der Entwicklung kultur- und kontextsensitiver Therapie- und Beratungs- weiterbildungen, die an ganz unterschiedlichen Orten der Welt umgesetzt werden, in Peking, Shanghai, Laos, Kambodscha, Isfahan und Uganda. Dies ist Ausdruck einer zunehmenden weltweiten Vernetzung. Die hohe Mobilität, die modernen Kommunikationsmittel und die zunehmende Migration führen zu einer stärkeren Begegnung unterschiedlicher Kulturen. Einheitliche, geschlossene Kulturräume lösen sich auf, neue Begriffe wie Transkulturalität und hybride Identitäten beschreiben diese Entwicklungen. Sie bringen Chancen und Herausforderungen mit sich, auch im beraterischen und therapeutischen Alltag. Kultursensibilität, die Bereitschaft, den Anderen vor dem Hintergrund seiner kulturellen Unterschiedlichkeit zu verstehen und den eigenen Standpunkt zu relativieren, ist eine Grundvoraussetzung für Systemische Therapie und Beratung. Daran schließen sich viele interessante Fragen an: Welche Bedeutung hat eigentlich Kultur im systemischen Kontext? Wie gut verstehen wir die anderen und was können wir von ihnen lernen? Warum gibt es noch so wenige systemische TherapeutInnen mit Migrationshintergrund, und was würde sich ändern, wenn es mehr gäbe? Wir wollen auch den Dialog zwischen den unterschiedlichen therapeutischen Weltanschauungen beleben. Können wir auch hier etwas von anderen lernen? Für einen anregenden Dialog haben wir körpertherapeutische Konzepte und psychoanalytische Mentalisierungskonzepte ausgewählt. Über das Leitthema hinaus werden Sie den gewohnten Markt der Möglichkeiten erleben mit Seminaren, Workshops und Symposien sowie berufspolitischen Foren. Ein Highlight ist die geplante Vorstellung des im Auer-Verlag erscheinenden Lehrbuches der Systemischen Therapie und Beratung, das von weit über 40 AutorInnen aus unterschiedlichen Ländern – von denen viele auch als ReferentInnen nach Freiburg kommen werden – unter der Herausgeberschaft von Tom Levold und Michael Wirsching erarbeitet wird.
Wir laden Sie ein, nach Freiburg zu kommen, zu einem anregenden Austausch, zu einem aufregenden Tagungsfest, in eine Stadt, die sich im Herbst besonders attraktiv zeigt.
Programm und nähere Informationen
26. Juni 2012
von Tom Levold
Keine Kommentare
Coaching in Hochschule und Wissenschaft
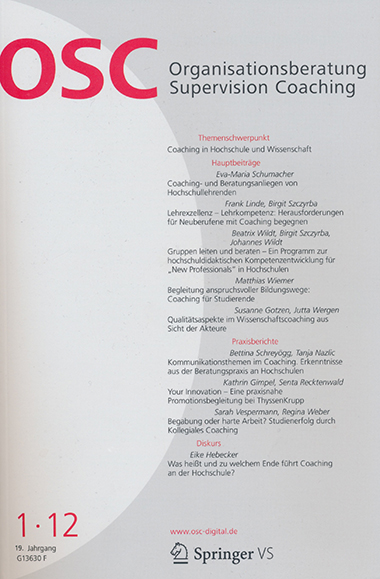
Die Zeitschrift„Organisationsberatung Supervision Coaching“ beschäftigt sich in der ersten Ausgabe dieses Jahres mit dem Thema Coaching an Hochschulen, das sich auf ganz unterschiedliche Anforderungen einzustellen hat. Ferdinand Buer bemerkt dazu in seinem Editorial:„Wenn nun geringe Lehrkompetenz und geringe Studierkompetenz zusammen kommen und das bei unterfinanzierten Rahmenbedingungen , dann ist es verständlich, dass die Ergebnisse nicht sonderlich befriedigen können. Hier kommt nun das Coaching ins Spiel. Im kollektiven Bewusstsein ist mit ihm ein bestimmtes Versprechen verbunden: Durch Coaching kann eine bestimmte Person ihre Leistungsfähigkeit auf einem bestimmten Gebiet so steigern, dass sie ihre Aufgabe gut, wenn nicht sogar exzellent bewältigen kann. Da es nun bisher an den Hochschulen an Grundausbildungen für Hochschullehrer/innen in Lehre und Management, für Nachwuchswissenschaftler/innen in Wissenschaftsherstellungskompetenz, für Studierende in Lernkompetenz nach wie vor mangelt, muss das alles on the job nachgeholt werden. Das führt an jeder Hochschule zu einer anderen bunten Wiese von Angeboten mit ganz unterschiedlichen Sprösslingen. Coaching ist heutzutage jedoch mit Garantie immer dabei“. Die vollständigen abstracts dieser bunten Wiese
finden Sie hier
25. Juni 2012
von Tom Levold
Keine Kommentare
SKEPSIS ALS METHODE
 Stephan Hametner (Foto: Systemische Notizen) ist Musikpädagoge, Radiomoderator und Seminarleiter in der Erwachsenen- und Lehrerfortbildung und unterrichtet Psychologie, Philosophie und Pädagogik. In einem Artikel für die„Systemischen Notizen“ 1/2005 der Wiener„Lehranstalt für systemische Familientherapie“ hat er die„Antiken Zweifler [einem] Vergleich mit dem systemisch-konstruktivistischen Paradigma“ unterzogen:„Die konstruktivistische Wende ist mit Namen wie Heinz von Foerster, Ernst von Glasersfeld, Humberto Maturana, Ernesto Varela, Gregory Bateson oder Paul Watzlawick verbunden. Bei genauerer Lektüre der Philosophiegeschichte ist mir aufgefallen, dass schon lange vor den genannten Autoren in der griechischen Antike nämlich Ansätze für eine konstruktivistische Weltsicht vorhanden waren. Dieser philosophische Zugang wird im Allgemeinen auch als Skepsis bezeichnet. Das griechische Wort sképtomai bedeutet soviel wie ich blicke prüfend umher. Eine kurze Einführung in diese Welt der antiken Skeptiker samt einem angeschlossenen Vergleich skeptischer Grundannahmen mit denen des systemisch-konstruktivistischen Paradigmas soll der Gegenstand der nun folgenden Zeilen sein“.
Stephan Hametner (Foto: Systemische Notizen) ist Musikpädagoge, Radiomoderator und Seminarleiter in der Erwachsenen- und Lehrerfortbildung und unterrichtet Psychologie, Philosophie und Pädagogik. In einem Artikel für die„Systemischen Notizen“ 1/2005 der Wiener„Lehranstalt für systemische Familientherapie“ hat er die„Antiken Zweifler [einem] Vergleich mit dem systemisch-konstruktivistischen Paradigma“ unterzogen:„Die konstruktivistische Wende ist mit Namen wie Heinz von Foerster, Ernst von Glasersfeld, Humberto Maturana, Ernesto Varela, Gregory Bateson oder Paul Watzlawick verbunden. Bei genauerer Lektüre der Philosophiegeschichte ist mir aufgefallen, dass schon lange vor den genannten Autoren in der griechischen Antike nämlich Ansätze für eine konstruktivistische Weltsicht vorhanden waren. Dieser philosophische Zugang wird im Allgemeinen auch als Skepsis bezeichnet. Das griechische Wort sképtomai bedeutet soviel wie ich blicke prüfend umher. Eine kurze Einführung in diese Welt der antiken Skeptiker samt einem angeschlossenen Vergleich skeptischer Grundannahmen mit denen des systemisch-konstruktivistischen Paradigmas soll der Gegenstand der nun folgenden Zeilen sein“.
Zum vollständigen Text
24. Juni 2012
von Tom Levold
Keine Kommentare
systeme 1/2012
Was kann in kulturell gemischten, heterogen zusammengesetzten städtischen Wohnanlagen Kommunikation fördern, Ressentiments abbauen und ein friedliches Zusammenleben unterstützen? Nun ja, offensichtlich: Schach! In der neuen Ausgabe der„systeme“ findet sich ein interessanter Aufsatz über ein Gemeinwesenprojekt in der Stadt Wien, bekannt für ihren städtischen Wohnhausanlagen, in dem die Soziologin, Schachspielerin und -trainerin Sarah Maienschein über ihre Erfahrungen berichtet, innovative Gemeinwesenarbeit über das Medium des Schachspielens zu entwickeln – offensichtlich mit Erfolg. Jürgen Wolf ist ein erfahrender Online-Berater von Jugendlichen bei der Online-Beratungsplattform der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung. Er hat nicht nur gemeinsam mit zwei Ko-Autoren ein Buch über Online-Beratung verfasst (über das sich eine Rezension von Peter Bünder ebenfalls in dieser Ausgabe findet), sondern auch einen umfangreicheren Text für dieses Heft beigesteuert, in der er eine„Hypnosystemische Sicht“ auf seine Erfahrungen bietet. Ansonsten gehört das Heft der Familie Zwack: Julika versucht eine Annäherung aus systemischer Sicht auf das Thema„Selbstachtsamkeit im Beruf“, Bruder Mirko hat mit Arist von Schlippe„Eine kurze Geschichte zur Bedeutung von Geschichten in Organisationen“ verfasst. Abgerundet wird das Heft von zwei Tagungsbeiträgen (Heinz Graumann und Karin Rausch) und einer weiteren Rezension von Peter Kaimer.
Zu den vollständigen abstracts
23. Juni 2012
von Tom Levold
Keine Kommentare
Die neue Netzfeindlichkeit
 Bernhard Pörksen, 43, ist Medienprofessor in Tübingen und in der systemischen Szene als Publizist gut bekannt, vor allem durch seine im Carl-Auer-Verlag erschienenen Gesprächsbücher mit Humberto Maturana und Heinz von Foerster
Bernhard Pörksen, 43, ist Medienprofessor in Tübingen und in der systemischen Szene als Publizist gut bekannt, vor allem durch seine im Carl-Auer-Verlag erschienenen Gesprächsbücher mit Humberto Maturana und Heinz von Foerster . Dieser Tage ist ein gemeinsam mit Hanne Detel verfasstes Buch Der entfesselte Skandal. Das Ende der Kontrolle im digitalen Zeitalter im Herbert von Halem Verlag Köln erschienen. In einem Gastbeitrag für systemagazin setzt sich Pörksen mit der Frage auseinander, welcher Dynamik Skandale im Kontext des Netzes unterliegen und ob die weithin zu beobachtende„Verteufelung des Internet“ einen Beitrag zur„Zivilisierung der öffentlichen Kommunikation“ zu leisten in der Lage ist:
. Dieser Tage ist ein gemeinsam mit Hanne Detel verfasstes Buch Der entfesselte Skandal. Das Ende der Kontrolle im digitalen Zeitalter im Herbert von Halem Verlag Köln erschienen. In einem Gastbeitrag für systemagazin setzt sich Pörksen mit der Frage auseinander, welcher Dynamik Skandale im Kontext des Netzes unterliegen und ob die weithin zu beobachtende„Verteufelung des Internet“ einen Beitrag zur„Zivilisierung der öffentlichen Kommunikation“ zu leisten in der Lage ist:
Die neue Netzfeindlichkeit
Cybermob, Shitstorm, anonyme Aggression die aktuelle Debatten regiert eine neue Netzfeindlichkeit, die eine entscheidende Frage verdeckt: Wie kann es gelingen, öffentliche Kommunikation zu zivilisieren?
Nach Jahren der Euphorie hat das Internet dieser Tage eine ziemlich schlechte Presse. Es gilt nun als das Medium der künstlichen Daueraufregung und als Instrument der Menschenjagd. Das Netz erzeuge eine oberflächliche, dümmliche Aggression, so heißt es. Es brutalisiere Menschen, die nicht mal in der Lage seien, im Mini-Format einer Twitterbotschaft orthographisch korrekt zu formulieren, so bekommt man zu lesen. Man solle den Zugang für Jugendliche sperren, forderte ein erregter Bürger in einer kürzlich ausgestrahlten Radiodiskussion. Ein anderer: Der Mensch befinde sich in der Knechtschaft der Maschine. Wieder ein anderer: Am Sinnvollsten sei es vermutlich, das Internet einfach ganz abzuschalten, zumindest für ein paar Tage.
Die Anlässe der neuen Netzfeindlichkeit sind datierbar. In Emden verdächtigte im März die Polizei zu Unrecht einen 17-jährigen Schüler, ein Mädchen vergewaltigt und umgebracht zu haben. Blitzschnell formierte sich, kaum war der Verdacht in Umlauf, ein Cybermob und forderte seinerseits den Kopf des jungen Mannes. Der zweite Anlass ist mit einer Rache-Aktion der Hochspringerin Ariane Friedrich verknüpft. Sie machte dieser Tage eine sexuelle Belästigung in Form eines eines Fotos und einer Mail öffentlich; sie nannte den Namen und die Adresse des mutmaßlichen Absenders auf ihrer Facebook-Präsenz. Ihr Ziel war es, durch Prangermethoden Vergeltung zu üben, Selbstjustiz zu praktizieren subjektiv verständlich, aber doch falsch.
Interessanter Weise zeigen überdies gerade die genannten Fälle, dass die aktuelle Aufgeregtheit an einer folgenschweren Verwechslung krankt. Denn letztlich verwechseln die schockierten Fundamental-Kritiker der Netzwelt das Medium mit den Menschen, die dieses einsetzen. Sie suchen einen Schuldigen und greifen sich die Technologie, das Instrument zur Verbreitung der bösen Botschaft. Niemand muss jedoch in einem Forum zum Mord an einem Verdächtigen aufrufen. Und was immer man von Facebook hält kein Programmierer hat die Selbstjustiz und die Abschaffung der Unschuldsvermutung zur Standardeinstellung der Kommunikation gemacht. Es war Ariane Friedrich, die durch den Akt der wütenden Ad-hoc-Publikation den Rollenwechsel vollzogen hat und so selbst zur Täterin wurde. Natürlich, es ist schon richtig: Das Netz erlaubt die Blamage auf einer weltweit einsehbaren Bühne. Es lässt sich benützen, um Dokumente der Demontage in Hochgeschwindigkeit zu verbreiten, die sich kaum noch zensieren lassen. Und es macht den Skandal allgegenwärtig und den Reputationsverlust zum unkalkulierbaren Dauerrisiko. Aber es stimmt eben auch: Man kann die neuen Kommunikationstechnologien verwenden, um mit ihrer Hilfe Kriegs- und Schandbilder bekannt zu machen, für Aufklärung und Transparenz zu sorgen und dabei mitzuhelfen, Folterer zu entlarven, Diktatoren einzuschüchtern, sie im Extremfall zu stürzen.
Wer nun das Medium selbst schuldig spricht, der glaubt nicht an die Menschen, die in der Lage sind, dieses auf eine sehr unterschiedliche Weise zu benützen. Er will sie bevormunden, durch Verbote kontrollieren, denn sie sind ihm unheimlich. Und er lässt bei all dem, dies wiegt am Schwersten, die entscheidende Herausforderung aus dem Blick geraten: Wie kann es gelingen, gleichsam von Kindesbeinen an, ein Gespür für Medieneffekte zu entwickeln? Wie sieht ein neues, der Gegenwart gewachsenes Konzept der Medienpädogik aus, das eine Mentalität des empathischen Abwägens befördert? Was heißt Medienkompetenz im digitalen Zeitalter? Man muss es so hart sagen: Die Verteufelung des Internet ist selbst gefährlich. Sie blockiert die dringend gebotene Suche nach Rezepten und Ideen, um öffentliche Kommunikation zu zivilisieren. Und sie ist denen, die bis auf Weiteres an die Mündigkeit des Menschen glauben, nicht würdig.
22. Juni 2012
von Tom Levold
Keine Kommentare
Deutschland gegen Griechenland
20. Juni 2012
von Tom Levold
Keine Kommentare
Einsamkeit systemisch?
Der„Brückenschlag“ ist eine Zeitschrift für Sozialpsychiatrie, Literatur und Kunst, die im Paranus-Verlag Neumünster erscheint und in der Psychosebetroffene ebenso wie Fachleute zu Wort kommen. Für den Band 29, der im Mai 2013, erscheint, ist das Thema Einsamkeit vorgesehen, zu dem systemagazin folgenden Schreibaufruf der Redaktion veröffentlicht:
„Unsere Gesellschaft verändert sich kontinuierlich. Früher lebten die meisten Menschen in Familien. Heute steigt die Zahl der Single-Haushalte. Früher stand man füreinander ein, bei Krankheit und Krise. Heute muss jeder schauen, dass er selbst zurechtkommt. Ist das der Weg zu (noch) mehr Selbstbestimmung und Eigenverantwortung? Neue Freiräume? Oder reisen wir in eine Gesellschaft der Einsamen? Ist Einsamkeit Grund oder Folge von psychischen Erkrankungen?
Die Erfahrung der Psychose oder der Depression macht einsam. Die Erfahrung, mit niemandem teilen zu können, keine verstehbaren Worte dafür zu finden. Psychisch erkrankte Menschen beklagen oft ihre Einsamkeit. Sie würden gerne mit anderen reden, sich verstanden fühlen. Das zwischenmenschliche Gespräch fehlt. Gerade in dem Moment, in dem man es so sehr braucht.
Gesund werden ist dann häufig wie eine Rückkehr aus dem Exil. Und umgekehrt: Das Alleine-Erleben einer Trennung oder eines Arbeitsplatzverlustes ist eine große Herausforderung, die in eine psychische Krise führen kann. Die dann erlebte Einsamkeit ohne Zuspruch, ohne Aussprache – kann krank machen.
Einsamkeit hat mit dem Gefühl, anders zu sein, zu tun. Ich habe einen anderen Musikgeschmack als der Rest der Klasse. Ich kleide mich anders, als es in diesem Sommer hipp ist. Ich stehe dazu und riskiere, mich zu isolieren, einsam zu werden. Ich bleibe allein zurück. Ich verstehe die anderen nicht und sie verstehen mich nicht. Ich gehe beiseite. Einsam. In unserer Wahrnehmung haben wir die Alternative: Zu sich zu stehen und sich zu isolieren. Oder bei den anderen zu sein und sich selbst zu verlieren. Und es müssen nicht die realen Reaktionen der Umwelt sein, die zur Isolation führen, sondern die befürchteten, selbst erwarteten, in der Fantasie vorweggenommenen. Der Säugling kann ohne andere Menschen nicht wachsen. Ist uns Verbundensein näher als Allein-sein? Ist das Allein-sein vieler Menschen nicht eher Ausdruck eines Mangels als einer selbst getroffenen Entscheidung? Wird das Eingehen einer Beziehung, die Gründung einer Familie immer mehr zu einem Karrierehindernis? Ist das Single-Dasein das Modell der Zukunft? Und welche Gesellschaft wird das dann sein?
Aber auch: Bedeutet alleine zu sein zugleich einsam zu sein? Man kann allein sein, ohne einsam zu sein. Wenn man Musik macht, liest, Sprachen lernt. Etwas tut, das einen ausfüllt und bei dem man sich wohl fühlt. Man kann ständig unter Menschen sein, als Vortragsreisender, Musiker, Politiker. Und trotzdem einsam bleiben. Einsam unter vielen.
Man kann sicherlich allein glücklich sein. Allein in der Gartenlaube. Allein beim Gitarrenspiel, beim Lesen. Es gibt Zeiten der Einsamkeit. Zeiten, in denen man am liebsten für sich ist. Gehört der Rückzug, gehört die Einsamkeit nicht zu jedem Leben dazu? Vielleicht ist Einsamkeit ein seelischer Raum, den wir notwendig erfahren müssen, um wachsen zu können?
So weit einige Fragen zum Thema des nächsten Brückenschlags. Vielleicht regen sie Sie an, selbst etwas über Einsamkeit zu Papier zu bringen.
Wir sind gespannt auf Ihre Einsendungen: Bilder und Gedichte, Texte (maximal 10.000 Zeichen incl. Leerzeichen) und Fotos.
Einsendeschluss ist Ende Oktober 2012. Brückenschlag, Paranus Verlag, Postfach 1264, 24502 Neumünster. Bitte Rückporto beilegen.
16. Juni 2012
von Tom Levold
Keine Kommentare
Warum lesen Psychotherapeuten keine Forschungsliteratur?
In einem Beitrag für das Psychotherapeutenjournal 1/2012 macht sich der Berliner Psychotherapeut Thorsten Padberg Gedanken darüber, warum Psychotherapeuten keine Forschungsliteratur lesen, und kommt zu folgenden Ergebnissen:„Da die Produktion dieser Texte einen großen Teil der wissenschaftlichen Aktivitäten ausmacht, die Rezeption zugleich aber so sehr zu wünschen übrig lässt, ist dies Anlass genug, zu betrachten, was diese Texte wirklich leisten (können). Die Untersuchung kommt zu den folgenden Ergebnissen: 1. Forschungsliteratur instruiert nicht, 2. Forschungsliteratur informiert nicht und 3. Forschungsliteratur inspiriert nicht. Als gemeinsame Wurzel dieser drei Mängel wird ein Missverständnis bezüglich der Rolle der Schriften und Begriffe im Wissenschaftsbetrieb der Psychologie benannt. Sie transportieren keine allgemeingültigen Psychotherapieregeln. Vielmehr sind sie Werkzeuge im Ablauf professioneller Praxis“
Zum vollständigen Text
15. Juni 2012
von Tom Levold
Keine Kommentare
Entwicklung im Spannungsfeld zwischen Natur und Kultur
Viele Entwicklungspsychologen und Bindungstheoretiker gehen davon aus, dass sie anthropologische Universalien untersuchen. Dass die Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen einer biologischen Matrix unterliegt, dürfte unbestritten sein. Allerdings ist die kulturelle Varianz von Entwicklungsverläufen und Eltern-Kind-Interaktion so beträchtlich, dass die Entwicklungspsychologin Heidi Keller  den Begriff der Entwicklung„als Konstruktion und Ko-Konstruktion kultureller Inhalte auf der Grundlage biologischer Prädispositionen“ definiert:„Kultur definiert die Inhalte von Entwicklungsprozessen und ist somit das Medium des Menschen zur Anpassung an die Umwelt. Sie umfasst dabei die reale, soziale und mentale Auseinandersetzung mit der physikalischen, kommunikativen und spirituellen Umgebung sowie den daraus entstehenden Produkten. Dabei wird deutlich, dass Kultur sowohl innerhalb als auch außerhalb des Menschen e
den Begriff der Entwicklung„als Konstruktion und Ko-Konstruktion kultureller Inhalte auf der Grundlage biologischer Prädispositionen“ definiert:„Kultur definiert die Inhalte von Entwicklungsprozessen und ist somit das Medium des Menschen zur Anpassung an die Umwelt. Sie umfasst dabei die reale, soziale und mentale Auseinandersetzung mit der physikalischen, kommunikativen und spirituellen Umgebung sowie den daraus entstehenden Produkten. Dabei wird deutlich, dass Kultur sowohl innerhalb als auch außerhalb des Menschen e xistiert und ein Kontinuum der Übergänge beinhaltet. So wie Entwicklung ein Prozess der Veränderung ist, ist auch Kultur ein ontogenetischer und historischer Prozess von Veränderungen“. Gemeinsam mit Athanasios Chasiotis (Fotos: www.uni-osnabrueck.de) hat sie 2008 einen Beitrag für die von M. Hasselhorn & R. Silbereisen herausgegebene Enzyklopädie der Psychologie (Göttingen: Hogrefe) verfasst, der in Band 4„Psychologie des Säuglings- und Kindesalters“ erschienen ist. In diesem Text werden„zunächst drei Kategorien der Betrachtung der Beziehung zwischen Kultur und Entwicklung skizziert (
): die kulturvergleichende, die kulturpsychologische und die indigene Sichtweise. Danach werden die Grundlagen für eine integrative Betrachtung im oben definierten Sinne vorgestellt, nämlich die Natur des Menschen und die kulturellen Variationen. Im Hauptteil dieses Kapitels wird dann die Entwicklung in der frühen Kindheit in verschiedenen Sozialisationspfaden nachgezeichnet, die prototypische kulturspezifische Modelle für universelle Entwicklungsaufgaben darstellen, die dennoch auf verschiedenen Dimensionen variieren können“
xistiert und ein Kontinuum der Übergänge beinhaltet. So wie Entwicklung ein Prozess der Veränderung ist, ist auch Kultur ein ontogenetischer und historischer Prozess von Veränderungen“. Gemeinsam mit Athanasios Chasiotis (Fotos: www.uni-osnabrueck.de) hat sie 2008 einen Beitrag für die von M. Hasselhorn & R. Silbereisen herausgegebene Enzyklopädie der Psychologie (Göttingen: Hogrefe) verfasst, der in Band 4„Psychologie des Säuglings- und Kindesalters“ erschienen ist. In diesem Text werden„zunächst drei Kategorien der Betrachtung der Beziehung zwischen Kultur und Entwicklung skizziert (
): die kulturvergleichende, die kulturpsychologische und die indigene Sichtweise. Danach werden die Grundlagen für eine integrative Betrachtung im oben definierten Sinne vorgestellt, nämlich die Natur des Menschen und die kulturellen Variationen. Im Hauptteil dieses Kapitels wird dann die Entwicklung in der frühen Kindheit in verschiedenen Sozialisationspfaden nachgezeichnet, die prototypische kulturspezifische Modelle für universelle Entwicklungsaufgaben darstellen, die dennoch auf verschiedenen Dimensionen variieren können“
Zum vollständigen Text
14. Juni 2012
von Tom Levold
Keine Kommentare
Coaching-Magazin 2/2012
 Im Coaching-Magazin 2/2012, das nun komplett online vorliegt, gibt es ein interessantes und berührendes Interview mit dem Coach Verena Nussbaume, die mit ihren Klienten nach Delphi und in die Wüste geht, um die wirklich wichtigen Fragen zum Vorschein kommen zu lassen. Darüberhinaus gibt es einen Artikel von Haja Molter und Karin Nöcker, unter Systemikern bestens bekannt, die ein Coaching-Tool mit Namen Raummodell als Landkarte für Coachingprozesse vorstellen, das„jenseits von Sprache Selbstorganisationsprozesse anstoßen soll. Innerhalb dieses Modells gibt es einen Wirklichkeits-, einen Möglichkeits- und einen Zielraum. Diese werden als eine von vielen möglichen Unterscheidungen im Kontext von Beratung und Coaching betrachtet. Das Raummodell soll die Komplexität systemischen Denkens und Handelns angemessen ungewöhnlich reduzieren. Voraussetzung dafür ist eine systemisch-konstruktivistische Haltung, der Coach sollte sich als Prozessbegleiter verstehen und mit Ungewissheit leben können. Die Klienten entscheiden darüber, ob es für sie eine hilfreiche Unterscheidung ist und sie der Einladung folgen können“
Im Coaching-Magazin 2/2012, das nun komplett online vorliegt, gibt es ein interessantes und berührendes Interview mit dem Coach Verena Nussbaume, die mit ihren Klienten nach Delphi und in die Wüste geht, um die wirklich wichtigen Fragen zum Vorschein kommen zu lassen. Darüberhinaus gibt es einen Artikel von Haja Molter und Karin Nöcker, unter Systemikern bestens bekannt, die ein Coaching-Tool mit Namen Raummodell als Landkarte für Coachingprozesse vorstellen, das„jenseits von Sprache Selbstorganisationsprozesse anstoßen soll. Innerhalb dieses Modells gibt es einen Wirklichkeits-, einen Möglichkeits- und einen Zielraum. Diese werden als eine von vielen möglichen Unterscheidungen im Kontext von Beratung und Coaching betrachtet. Das Raummodell soll die Komplexität systemischen Denkens und Handelns angemessen ungewöhnlich reduzieren. Voraussetzung dafür ist eine systemisch-konstruktivistische Haltung, der Coach sollte sich als Prozessbegleiter verstehen und mit Ungewissheit leben können. Die Klienten entscheiden darüber, ob es für sie eine hilfreiche Unterscheidung ist und sie der Einladung folgen können“
Zur vollständigen Ausgabe des Coaching-Magazins
11. Juni 2012
von Wolfgang Loth
Keine Kommentare
Krise der Identität?
 Es bleibt ein Thema, das einen angeht. Und wenn ich das auch noch wörtlich nehme, kommt etwas zum Tragen, was im sprachlastig erscheinenden systemischen Denken bisweilen zu kurz kommt Körper und Leiblichkeit. Kein metaphorisches Sprachspiel, sondern womöglich Methode und im Hinblick auf die zunehmende Bedeutung cyberweltlicher Kontexte eine interessante Frage: geht uns das noch etwas an? Wenn ich unter angehen das Spüren von etwas mitdenke, bin ich an einer Grenze und an dieser entscheiden sich Blickwinkel und Zugehörigkeiten und auf diesem Weg womöglich Bedingungen für Krieg oder Frieden. Für beide sind der Umgang mit dem Thema Identität wichtig, vielleicht ist es Zufall, dass zur Zeit das Thema Hells Angels en vogue ist und mit ihrer/seiner Hilfe das Thema Ausgrenzung/Zugehörigkeit/Gewalt durchgenommen wird. Krise der Identität als vielfältig relevantes Thema also, und Hille Haker (Foto: www.ethik.uni-frankfurt.de) setzt in ihrem informativen, spannenden und anregungsreichen Aufsatz ein Fragezeichen dahinter. Sie liefert einen kompakten und dennoch lesbaren Einstieg in eine Fragestellung, die sich an der Grenze zwischen herkömmlicher und Cyberwelt entwickelt hat. Von der herkömmlichen Erzähl-Identität zur Cyber-Identität geht eine Reise, doch was wie eine zunehmende Entfernung aussehen mag, führt doch wieder zu alten Fragen mit neuen Mitteln. Allerdings kehrt mit dem Internet die Mündlichkeit in ganz neuer Weise wieder, schreibt Haker. Und: Zugleich wird aber auch erkennbar, dass die herkömmlichen sozialen Grenzziehungen eine eindeutige Orientierungsfunktion haben, die sie außerhalb des Netzes selbstverständlich noch immer haben, die aber durch den Kontrast der Netzidentität viel stärker wahrgenommen werden kann und die womöglich durch die flexible Netzidentität zersetzend wirkt. Schapp hatte noch die Leiblichkeit des Menschen auf die Narrativität beziehen wollen heute stellt sich demgegenüber die Frage umgekehrt: gibt es Narrativität ohne die Referenz der Leiblichkeit? Welche Rolle spielt der Körper im Netz? Ist er überflüssig? Wird er, die ‚wetware‘, mit der ‚hardware‘ des Computers überwunden? Und wäre dies das Ende der Moral? Auffällig ist, dass es kaum Möglichkeiten gibt, die Rezeption der Auto-Erzählungen zu überprüfen. Obwohl der Schein der Interaktivität herrscht, sind die Identitätserzählungen, die etwa auf Homepages dargestellt werden, monologisch. Jenseits der Chatrooms mit ihren flexiblen Identitäten fehlt im Netz weitgehend die intersubjektive Kontrolle, sei es durch die Körpersprache des Gegenübers im Gespräch, sei es durch körperliche Individualität. Wenn die narrative Identitätskonzeption zum einen mit Leiblichkeit, zum anderen mit der Theorie der sozial vermittelten Identität zusammenhängt, ist hier erst noch herauszuarbeiten, was das Fehlen der sozialen Kontrolle für die neuen Identitätskonzepte bedeutet. Und schließlich: Die Imagination und das Spiel mit Imaginationen betrifft nicht zuletzt die ethische Frage der Verletzung anderer in ihrer individuellen Integrität und in ihrer sozialen Identität. Hille Hakers Aufsatz Krise der Identität? Leiblichkeit, Körper und erzählte Identität in der Informations- und Wissensgesellschaft erschien 2005 in : G. Berthoud et al. (Hg.): Informationsgesellschaft. Geschichten und Wirklichkeit. 22. Kolloquium der Schweizerischen Akademie der Geistes und Sozialwissenschaften. Fribourg: Academic Press, S. 323-340.
Es bleibt ein Thema, das einen angeht. Und wenn ich das auch noch wörtlich nehme, kommt etwas zum Tragen, was im sprachlastig erscheinenden systemischen Denken bisweilen zu kurz kommt Körper und Leiblichkeit. Kein metaphorisches Sprachspiel, sondern womöglich Methode und im Hinblick auf die zunehmende Bedeutung cyberweltlicher Kontexte eine interessante Frage: geht uns das noch etwas an? Wenn ich unter angehen das Spüren von etwas mitdenke, bin ich an einer Grenze und an dieser entscheiden sich Blickwinkel und Zugehörigkeiten und auf diesem Weg womöglich Bedingungen für Krieg oder Frieden. Für beide sind der Umgang mit dem Thema Identität wichtig, vielleicht ist es Zufall, dass zur Zeit das Thema Hells Angels en vogue ist und mit ihrer/seiner Hilfe das Thema Ausgrenzung/Zugehörigkeit/Gewalt durchgenommen wird. Krise der Identität als vielfältig relevantes Thema also, und Hille Haker (Foto: www.ethik.uni-frankfurt.de) setzt in ihrem informativen, spannenden und anregungsreichen Aufsatz ein Fragezeichen dahinter. Sie liefert einen kompakten und dennoch lesbaren Einstieg in eine Fragestellung, die sich an der Grenze zwischen herkömmlicher und Cyberwelt entwickelt hat. Von der herkömmlichen Erzähl-Identität zur Cyber-Identität geht eine Reise, doch was wie eine zunehmende Entfernung aussehen mag, führt doch wieder zu alten Fragen mit neuen Mitteln. Allerdings kehrt mit dem Internet die Mündlichkeit in ganz neuer Weise wieder, schreibt Haker. Und: Zugleich wird aber auch erkennbar, dass die herkömmlichen sozialen Grenzziehungen eine eindeutige Orientierungsfunktion haben, die sie außerhalb des Netzes selbstverständlich noch immer haben, die aber durch den Kontrast der Netzidentität viel stärker wahrgenommen werden kann und die womöglich durch die flexible Netzidentität zersetzend wirkt. Schapp hatte noch die Leiblichkeit des Menschen auf die Narrativität beziehen wollen heute stellt sich demgegenüber die Frage umgekehrt: gibt es Narrativität ohne die Referenz der Leiblichkeit? Welche Rolle spielt der Körper im Netz? Ist er überflüssig? Wird er, die ‚wetware‘, mit der ‚hardware‘ des Computers überwunden? Und wäre dies das Ende der Moral? Auffällig ist, dass es kaum Möglichkeiten gibt, die Rezeption der Auto-Erzählungen zu überprüfen. Obwohl der Schein der Interaktivität herrscht, sind die Identitätserzählungen, die etwa auf Homepages dargestellt werden, monologisch. Jenseits der Chatrooms mit ihren flexiblen Identitäten fehlt im Netz weitgehend die intersubjektive Kontrolle, sei es durch die Körpersprache des Gegenübers im Gespräch, sei es durch körperliche Individualität. Wenn die narrative Identitätskonzeption zum einen mit Leiblichkeit, zum anderen mit der Theorie der sozial vermittelten Identität zusammenhängt, ist hier erst noch herauszuarbeiten, was das Fehlen der sozialen Kontrolle für die neuen Identitätskonzepte bedeutet. Und schließlich: Die Imagination und das Spiel mit Imaginationen betrifft nicht zuletzt die ethische Frage der Verletzung anderer in ihrer individuellen Integrität und in ihrer sozialen Identität. Hille Hakers Aufsatz Krise der Identität? Leiblichkeit, Körper und erzählte Identität in der Informations- und Wissensgesellschaft erschien 2005 in : G. Berthoud et al. (Hg.): Informationsgesellschaft. Geschichten und Wirklichkeit. 22. Kolloquium der Schweizerischen Akademie der Geistes und Sozialwissenschaften. Fribourg: Academic Press, S. 323-340.
[Nachtrag 29.10.2012: Der Text ist mittlerweile nicht mehr an der ursprünglich angegebenen Stelle im Netz zu finden. Es besteht jedoch die Möglichkeit, den Text zumindest in großen Teilen via google-books einzusehen. hier
link dazu; WL]
10. Juni 2012
von Tom Levold
Keine Kommentare
Lehren des Nicht-Lehrbaren: Zur Qualität der systemischen Psychotherapie-Ausbildung
 In einem sehr schönen Beitrag, den er 1997 in systhema veröffentlicht und der bis heute nichts an Relevanz verloren hat, macht sich Siegfried Essen (Foto: www.siegfriedessen.com) Gedanken über die Ausrichtung der Ausbildung systemischer TherapeutInnen: Sowohl die Entwicklung der psychotherapeutischen Wirksamkeitsforschung als auch die der systemischen Theorie legen nahe, daß angemessene und wirksame Psychotherapie nicht so sehr auf der Anwendung spezifischer Theorie, Methodik und Technik beruht, sondern weit mehr auf der ‚Haltung‘ des Therapeuten und seiner/ihrer Art der Beziehungsgestaltung. Auf der Basis dieser Erkenntnisse werden die Ausbildungsziele systemischer Psychotherapieausbildung neu formuliert und konkrete Ansätze für die Praxis der Ausbildung vorgeschlagen“
In einem sehr schönen Beitrag, den er 1997 in systhema veröffentlicht und der bis heute nichts an Relevanz verloren hat, macht sich Siegfried Essen (Foto: www.siegfriedessen.com) Gedanken über die Ausrichtung der Ausbildung systemischer TherapeutInnen: Sowohl die Entwicklung der psychotherapeutischen Wirksamkeitsforschung als auch die der systemischen Theorie legen nahe, daß angemessene und wirksame Psychotherapie nicht so sehr auf der Anwendung spezifischer Theorie, Methodik und Technik beruht, sondern weit mehr auf der ‚Haltung‘ des Therapeuten und seiner/ihrer Art der Beziehungsgestaltung. Auf der Basis dieser Erkenntnisse werden die Ausbildungsziele systemischer Psychotherapieausbildung neu formuliert und konkrete Ansätze für die Praxis der Ausbildung vorgeschlagen“
Zum vollständigen Text


