 Eines der in der systemischen Szene am weitesten verbreiteten Sätze ist sicherlich der, dass„die Karte nicht das Territorium“ sei. Durch Bateson und Heinz von Foerster bekannt geworden, dürften dennoch die wenigsten seinen Urheber kennen, nämlich Alfred Korzybski (Foto: Wikipedia). In einem interessanten Essay des Philosophen und (u.a.) Bateson-Übersetzers Hans-Günter Holl, der auf seiner website (im .doc-Format) heruntergeladen werden kann, setzt sich dieser 2007 mit dem Verhältnis von Bateson und Korzybski auseinander:„Dieser Essay dient offenkundig nicht der seit langem um Bateson und Korzybski betriebenen Hagiographie, sondern
Eines der in der systemischen Szene am weitesten verbreiteten Sätze ist sicherlich der, dass„die Karte nicht das Territorium“ sei. Durch Bateson und Heinz von Foerster bekannt geworden, dürften dennoch die wenigsten seinen Urheber kennen, nämlich Alfred Korzybski (Foto: Wikipedia). In einem interessanten Essay des Philosophen und (u.a.) Bateson-Übersetzers Hans-Günter Holl, der auf seiner website (im .doc-Format) heruntergeladen werden kann, setzt sich dieser 2007 mit dem Verhältnis von Bateson und Korzybski auseinander:„Dieser Essay dient offenkundig nicht der seit langem um Bateson und Korzybski betriebenen Hagiographie, sondern  will andere, gewiss etwas befremdliche und unorthodoxe Perspektiven eröffnen. Kurz gefasst handelt er von einem Phänomen, das wir aus der Kybernetik zweiter Ordnung kennen: dem Kontext eines Kontextes, namentlich dessen der kulturellen Assimilation. Der Begriff kulturell leitet sich dabei in der Tat von Kult her, denn in ihrer Sonderstellung als Hellseher und Propheten zogen Bateson und Korzybski eine gleichsam kultische Verehrung auf sich, die eine kritische Auseinandersetzung mit ihren Grundannahmen verhindert. Korzybski verurteilte zwar die aristotelische Denkgewohnheit der simplen Identifikation, doch zunächst einmal identifizierte er selbst ein krudes Vorurteil über Aristoteles mit dem, was er angreifen wollte etwa so, wie man ein Phantom jagt. In seiner Nachfolge übernahm Bateson das Konzept der Karte-Territorium-Relation, das sich nahtlos in seine Theorie des Geistes einfügte und der einzige Punkt blieb, den er je aus Korzybskis Schriften zitierte.
will andere, gewiss etwas befremdliche und unorthodoxe Perspektiven eröffnen. Kurz gefasst handelt er von einem Phänomen, das wir aus der Kybernetik zweiter Ordnung kennen: dem Kontext eines Kontextes, namentlich dessen der kulturellen Assimilation. Der Begriff kulturell leitet sich dabei in der Tat von Kult her, denn in ihrer Sonderstellung als Hellseher und Propheten zogen Bateson und Korzybski eine gleichsam kultische Verehrung auf sich, die eine kritische Auseinandersetzung mit ihren Grundannahmen verhindert. Korzybski verurteilte zwar die aristotelische Denkgewohnheit der simplen Identifikation, doch zunächst einmal identifizierte er selbst ein krudes Vorurteil über Aristoteles mit dem, was er angreifen wollte etwa so, wie man ein Phantom jagt. In seiner Nachfolge übernahm Bateson das Konzept der Karte-Territorium-Relation, das sich nahtlos in seine Theorie des Geistes einfügte und der einzige Punkt blieb, den er je aus Korzybskis Schriften zitierte.
Als dessen Hauptwerk allerdings 1933 erschien, war die Bedeutung der doppelt akzentuierten Warnung, dass eine Karte nicht das Territorium ist zumal wenn man Korzybskis eigenen militärischen Hintergrund berücksichtigt , erheblich dadurch mitgeprägt, dass geisteskranke Diktatoren längst planten, ihre Karten mit Waffengewalt auf Territorien zu übertragen.
Nach dem Krieg repazifizierte Bateson die Karte-Territorium-Relation und nutzte sie, um komplexe Verhaltensmuster (wie Spiel oder schizophrene Kommunikation) zu erklären. Die in solchen Sequenzen sich abzeichnende endlose Skala von logischen Ebenen veranlasste ihn schließlich dazu, die Sphäre der streng kontextuell definierten und begrenzten Erkenntnis zu überschreiten und den Geist mit Gott gleichzusetzen. Der fast eine Generation jüngere Gourmet Paul Watzlawick wechselte nicht das Paradigma, sondern die diesem zugrunde liegende Metaphorik. Statt vor der Identifikation von Karten mit Territorien zu warnen, empfahl er uns dringend, nicht die Speisekarte anstelle des Menüs zu essen. Wenn aber Feinschmeckern eine Speisekarte das Menü verheißt, so wie Kennern eine Partitur die Musik oder Invasoren eine Karte das Territorium, wäre Korzybskis Vorbehalt zu revidieren: Eine Karte ist noch nicht das Territorium“
Zum vollständigen Text
19. September 2012
von Tom Levold
Keine Kommentare


 Andreas Taffertshofer (Foto: TU-chemnitz.de) arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Innovationsforschung und nachhaltiges Ressourcenmanagement der TU Chemnitz. 2006 hat einer eine Untersuchung über die Funktionen von Coaching in Organisationen verfasst, die auch online zu lesen ist:„Wenn man die verfügbare Literatur zum Coaching und ergänzend zur Management-Beratung sichtet, fällt auf, dass die Forschungsinteressen kaum einen systematischen Blick für Organisationen bereithalten. Während in der positiv unterstützenden Reflexion das Hauptaugenmerk auf die Gestaltung und Verbesserung der Berater-Klient-Beziehung liegt, konzentrieren sich erste kritische Forschungen auf die Entwicklung gesellschaftlicher Rahmenbedingungen. Als üblicher Verdächtiger wird gerne„die“ Globalisierung genannt, die Organisationen bzw. individuelle Manager soweit verunsichere, dass sie eine zumindest prekäre Sicherheit in den Ratschlägen von Beratern suchen und finden (z.B. Ernst/Kieser 2002). Man konzentriert sich entweder auf die Mikrosituation der Beratungsinteraktion oder man erklärt aus der Makrobedingung Globalisierung, die kaum bestritten für fast alle gegenwärtigen sozialen Phänomene mitverantwortlich gemacht werden kann. Auffällig ist, dass für die beauftragende, ermöglichende und bezahlende Institution Organisation vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit entwickelt wurde. Management- Beratung wie Coaching findet aber nur statt, weil es Organisationen gibt. Inwieweit es dann zum Beispiel um„ganze Personen“ oder nur Teile von Personen bzw. Rollen geht, ist dagegen eine sekundäre Frage. Teilweise greift die inzwischen einsetzende Evaluationsliteratur die Organisationsperspektive auf, versteht aber die Bedeutung von Coaching in Organisationen nicht hinreichend, wenn sie sich auf den Nachweis von Kosteneffekten in Unternehmen beschränkt“
Andreas Taffertshofer (Foto: TU-chemnitz.de) arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Innovationsforschung und nachhaltiges Ressourcenmanagement der TU Chemnitz. 2006 hat einer eine Untersuchung über die Funktionen von Coaching in Organisationen verfasst, die auch online zu lesen ist:„Wenn man die verfügbare Literatur zum Coaching und ergänzend zur Management-Beratung sichtet, fällt auf, dass die Forschungsinteressen kaum einen systematischen Blick für Organisationen bereithalten. Während in der positiv unterstützenden Reflexion das Hauptaugenmerk auf die Gestaltung und Verbesserung der Berater-Klient-Beziehung liegt, konzentrieren sich erste kritische Forschungen auf die Entwicklung gesellschaftlicher Rahmenbedingungen. Als üblicher Verdächtiger wird gerne„die“ Globalisierung genannt, die Organisationen bzw. individuelle Manager soweit verunsichere, dass sie eine zumindest prekäre Sicherheit in den Ratschlägen von Beratern suchen und finden (z.B. Ernst/Kieser 2002). Man konzentriert sich entweder auf die Mikrosituation der Beratungsinteraktion oder man erklärt aus der Makrobedingung Globalisierung, die kaum bestritten für fast alle gegenwärtigen sozialen Phänomene mitverantwortlich gemacht werden kann. Auffällig ist, dass für die beauftragende, ermöglichende und bezahlende Institution Organisation vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit entwickelt wurde. Management- Beratung wie Coaching findet aber nur statt, weil es Organisationen gibt. Inwieweit es dann zum Beispiel um„ganze Personen“ oder nur Teile von Personen bzw. Rollen geht, ist dagegen eine sekundäre Frage. Teilweise greift die inzwischen einsetzende Evaluationsliteratur die Organisationsperspektive auf, versteht aber die Bedeutung von Coaching in Organisationen nicht hinreichend, wenn sie sich auf den Nachweis von Kosteneffekten in Unternehmen beschränkt“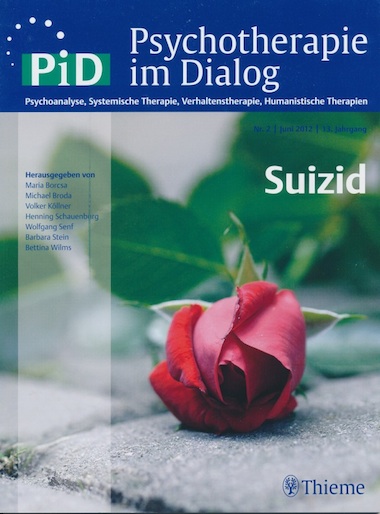
 Hugh Crago dürfte hierzulande nicht allzu bekannt sein, in Australien ist er einer der wichtigen Promotoren des systemischen Ansatzes, gemeinsam mit seiner Frau Maureen, mit der er über lange Zeit das Australian and New Zealand Journal of Family Therapy herausgegeben hat. In diesem Jahr ist ein Buch erschienen, das er mit Penny Gardner verfasst hat, die an der Universität Western Sydney wie auch Crago Lecturer in Counsellung ist, und das sich in erster Linie an Anfänger richtet. Im Vorwort heißt es:„This book is intended for students of counselling and therapy in their first year of training. We have attempted to describe capacities and skills that are fundamental to a range of widely used therapeutic approaches, from generalist counselling to specific models as different as psychoanalytic psychotherapy and cognitive behaviour therapy. Particular models require particular techniques, and we have not attempted a comprehensive coverage of model-specific skills. Instead, we have highlighted the skills that every competent helper needs when dealing with people in emotional distress: the competencies that make a practitioner effective no matter what model she or he professes“ Wolfgang Loth hat das Buch gelesen und resümiert:„Ich finde dieses Buch ebenso kompetent wie warmherzig geschrieben. Es ist kein Lehrbuch über Systemische oder Familientherapie, jedoch ein schönes Beispiel dafür, wie angehende KollegInnen dazu angeregt werden können, KlientInnen respektvoll zu begegnen und sich ihnen mit Zutrauen und Selbstvertrauen zur Verfügung zu stellen. Griffige Zusammenfassungen an den Kapitelenden, Lektüreempfehlungen und ein detailliertes Register runden den guten Eindruck ab“
Hugh Crago dürfte hierzulande nicht allzu bekannt sein, in Australien ist er einer der wichtigen Promotoren des systemischen Ansatzes, gemeinsam mit seiner Frau Maureen, mit der er über lange Zeit das Australian and New Zealand Journal of Family Therapy herausgegeben hat. In diesem Jahr ist ein Buch erschienen, das er mit Penny Gardner verfasst hat, die an der Universität Western Sydney wie auch Crago Lecturer in Counsellung ist, und das sich in erster Linie an Anfänger richtet. Im Vorwort heißt es:„This book is intended for students of counselling and therapy in their first year of training. We have attempted to describe capacities and skills that are fundamental to a range of widely used therapeutic approaches, from generalist counselling to specific models as different as psychoanalytic psychotherapy and cognitive behaviour therapy. Particular models require particular techniques, and we have not attempted a comprehensive coverage of model-specific skills. Instead, we have highlighted the skills that every competent helper needs when dealing with people in emotional distress: the competencies that make a practitioner effective no matter what model she or he professes“ Wolfgang Loth hat das Buch gelesen und resümiert:„Ich finde dieses Buch ebenso kompetent wie warmherzig geschrieben. Es ist kein Lehrbuch über Systemische oder Familientherapie, jedoch ein schönes Beispiel dafür, wie angehende KollegInnen dazu angeregt werden können, KlientInnen respektvoll zu begegnen und sich ihnen mit Zutrauen und Selbstvertrauen zur Verfügung zu stellen. Griffige Zusammenfassungen an den Kapitelenden, Lektüreempfehlungen und ein detailliertes Register runden den guten Eindruck ab“
 Im Internet ist ein Text von Peter Fuch über die erkenntnistheoretischen Implikationen der Systemtheorie zu lesen, der ursprünglich im Band„Theorie als Lehrgedicht – Systemtheoretische Essays I“ (hrsg. von Marie-Christin Fuchs) im Bielefelder transcript-Verlag 2004 erschienen ist:„Wenn es um die Frage der Bedingung der Möglichkeit von (soziologischer) Erkenntnis geht und wenn diese Frage gerichtet wird an die Systemtheorie der Bielefelder Provenienz, dann erhält man ein Antwortpaket, in das verschiedene Motive und Aspekte der Theorie hineinverschlungen sind, die untereinander keine hierarchischen (deduktiven oder induktiven) Beziehungen unterhalten, sondern eher heterarchisch verknotet sind und eine Gemengelage darstellen, in der Führungswechsel leitender Motive vorgesehen sind und in der sich von jedem gerade führenden Motiv aus Re-Arrangements des Erkenntnisproblems ergeben. Deswegen ist jeder (durch Textualität erzwungene) Bau von Sequenzen, in denen bestimmte Theoriemotive auf bestimmte folgen und anderen vorangehen, eigentümlich künstlich. In einer Metapher, die keinen Anspruch auf große Tragweite erhebt, könnte man vielleicht sagen, daß diese Theorie holographisch oder hologrammatisch abgebildet werden müßte, aber vorab nicht so abgebildet werden kann. Alle folgenden Überlegungen sollten unter dieser Kautele gelesen werden“
Im Internet ist ein Text von Peter Fuch über die erkenntnistheoretischen Implikationen der Systemtheorie zu lesen, der ursprünglich im Band„Theorie als Lehrgedicht – Systemtheoretische Essays I“ (hrsg. von Marie-Christin Fuchs) im Bielefelder transcript-Verlag 2004 erschienen ist:„Wenn es um die Frage der Bedingung der Möglichkeit von (soziologischer) Erkenntnis geht und wenn diese Frage gerichtet wird an die Systemtheorie der Bielefelder Provenienz, dann erhält man ein Antwortpaket, in das verschiedene Motive und Aspekte der Theorie hineinverschlungen sind, die untereinander keine hierarchischen (deduktiven oder induktiven) Beziehungen unterhalten, sondern eher heterarchisch verknotet sind und eine Gemengelage darstellen, in der Führungswechsel leitender Motive vorgesehen sind und in der sich von jedem gerade führenden Motiv aus Re-Arrangements des Erkenntnisproblems ergeben. Deswegen ist jeder (durch Textualität erzwungene) Bau von Sequenzen, in denen bestimmte Theoriemotive auf bestimmte folgen und anderen vorangehen, eigentümlich künstlich. In einer Metapher, die keinen Anspruch auf große Tragweite erhebt, könnte man vielleicht sagen, daß diese Theorie holographisch oder hologrammatisch abgebildet werden müßte, aber vorab nicht so abgebildet werden kann. Alle folgenden Überlegungen sollten unter dieser Kautele gelesen werden“ Lange haben wir keine Post mehr aus Perturbistan bekommen, doch nun gibt es wieder einen neuen Beitrag von Lothar Eder zu lesen, der dieses Mal vor allem politically incorrect daherkommt und daher sicherlich perturbierende Wirkung entfalten wird. Mit politisch korrekten Statements ist daher zu rechnen.
Lange haben wir keine Post mehr aus Perturbistan bekommen, doch nun gibt es wieder einen neuen Beitrag von Lothar Eder zu lesen, der dieses Mal vor allem politically incorrect daherkommt und daher sicherlich perturbierende Wirkung entfalten wird. Mit politisch korrekten Statements ist daher zu rechnen.