 Als im Mai 1981 Mehmet Ali Ağca das Attentat auf Papst Johannes Paul II. verübt hatte, sagte der Vater von Oktay Saydam: Wir Türken werden jetzt darunter leiden!. Oktay Saydam lebte mit seiner Familie, einer Arbeitsmigrationsfamilie, in Tübingen. Gegen die generalisierende Betrachtung der Nachbarn wehrte sich der Junge: Türke ja, aber den Papst habe er doch nicht umgebracht! Oktay Saydam lehrt jetzt an der Trakya Universität in Edirne in der Türkei (Foto: trakya.edu.tr) und hat im Jahr 2009 im Rahmen des XI. Türkischen Internationalen Germanistik-Kongresses in Izmir einen Vortrag über die Orientrezeptionen Ernst Blochs und Bertolt Brechts gehalten, mit dem Untertitel: Ein Beitrag zur Rekontextualisierung oder Kontexterweiterung des globalen Humanismus versus Terrorismus. In diesem Zusammenhang erweist sich der 11. September 2001 als ein weiteres wirkungsmächtiges Kürzel für eine in der Folge ansteigende Islamophobie in der sog. Westlichen Welt. Ein Aspekt der Globalisierung, der unter (nicht seltenen) Umständen mit einer erheblichen Strapazierung menschlicher Alltagsbeziehungen im lokalen Nahraum korrespondiert. Saydam stellt viele Fragen und eröffnet fragend einen Gedankenraum, in dem sowohl zeittypische wie auch zeitraumübergreifende Dynamiken im Umgang mit dem Fremden aufscheinen. Er geht u.a. auf die Versuche Ernst Blochs und Bertold Brechts ein, in der Auseinandersetzung mit orientalischen Philosophen den interkulturellen Blick zu weiten und verhehlt nicht, dass die von Bloch rezipierten Philosophen in der islamischen Welt durchgehend als Häretiker eingestuft wurden. Sie wurden verfolgt, ihre Bücher wurden verbrannt. Dies könnte dafür sprechen, dass die kulturübergreifende Homogenität der allgemeinen Praktiken von Machtausübung der Heterogenität weltbildnerischer Alltagsbezüge und deren Stiftung kultureller Identität vorausgeht. Dem könnte ein erkenntnistheoretisches, schriftstellerisches und/oder philosophisches Interesse an einer Globalisierung einer humanen Werteauffassung entgegengesetzt werden. Oktay Saydam fasst seinen Aufsatz so zusammen, er beschränke sich, weitgehend auf die offene, vorurteilsferne, wache und diesseitige Forscher- und Betrachter-Haltung Blochs und Brechts sowie auf die diesseitig orientierten Vertreter des auch türkisch geprägten heterodoxen Islam gegenüber anderen Kulturen und wolle zeigen, dass diese urteils- oder vorurteilsferne Forscher- und Betrachterhaltung eine existenzielle philosophische sowie literarisch/poetische Notwendigkeit ist, um aus anderen Kulturen, Philosophien, Erkenntnisse zu ziehen. Eine solche Betrachtungsweise oder Forscher-Haltung hegen jedoch diejenigen – ungeachtet ihrer Herkunft – die sich m.E. grundsätzlich als humanistisch bezeichnen, bezeichnet werden (S.142). Der Aufsatz kann hier im Volltext heruntergeladen werden. [Bibliographische Angaben: Der Aufsatz erschien in: Yadigar Eğit (Hg.) (2010) XI. Türkischer Internationaler Germanistik Kongress, 20.-22. Mai 2009. İzmir: Ege Üniversitesi Matbaası (S.140-155)].
Als im Mai 1981 Mehmet Ali Ağca das Attentat auf Papst Johannes Paul II. verübt hatte, sagte der Vater von Oktay Saydam: Wir Türken werden jetzt darunter leiden!. Oktay Saydam lebte mit seiner Familie, einer Arbeitsmigrationsfamilie, in Tübingen. Gegen die generalisierende Betrachtung der Nachbarn wehrte sich der Junge: Türke ja, aber den Papst habe er doch nicht umgebracht! Oktay Saydam lehrt jetzt an der Trakya Universität in Edirne in der Türkei (Foto: trakya.edu.tr) und hat im Jahr 2009 im Rahmen des XI. Türkischen Internationalen Germanistik-Kongresses in Izmir einen Vortrag über die Orientrezeptionen Ernst Blochs und Bertolt Brechts gehalten, mit dem Untertitel: Ein Beitrag zur Rekontextualisierung oder Kontexterweiterung des globalen Humanismus versus Terrorismus. In diesem Zusammenhang erweist sich der 11. September 2001 als ein weiteres wirkungsmächtiges Kürzel für eine in der Folge ansteigende Islamophobie in der sog. Westlichen Welt. Ein Aspekt der Globalisierung, der unter (nicht seltenen) Umständen mit einer erheblichen Strapazierung menschlicher Alltagsbeziehungen im lokalen Nahraum korrespondiert. Saydam stellt viele Fragen und eröffnet fragend einen Gedankenraum, in dem sowohl zeittypische wie auch zeitraumübergreifende Dynamiken im Umgang mit dem Fremden aufscheinen. Er geht u.a. auf die Versuche Ernst Blochs und Bertold Brechts ein, in der Auseinandersetzung mit orientalischen Philosophen den interkulturellen Blick zu weiten und verhehlt nicht, dass die von Bloch rezipierten Philosophen in der islamischen Welt durchgehend als Häretiker eingestuft wurden. Sie wurden verfolgt, ihre Bücher wurden verbrannt. Dies könnte dafür sprechen, dass die kulturübergreifende Homogenität der allgemeinen Praktiken von Machtausübung der Heterogenität weltbildnerischer Alltagsbezüge und deren Stiftung kultureller Identität vorausgeht. Dem könnte ein erkenntnistheoretisches, schriftstellerisches und/oder philosophisches Interesse an einer Globalisierung einer humanen Werteauffassung entgegengesetzt werden. Oktay Saydam fasst seinen Aufsatz so zusammen, er beschränke sich, weitgehend auf die offene, vorurteilsferne, wache und diesseitige Forscher- und Betrachter-Haltung Blochs und Brechts sowie auf die diesseitig orientierten Vertreter des auch türkisch geprägten heterodoxen Islam gegenüber anderen Kulturen und wolle zeigen, dass diese urteils- oder vorurteilsferne Forscher- und Betrachterhaltung eine existenzielle philosophische sowie literarisch/poetische Notwendigkeit ist, um aus anderen Kulturen, Philosophien, Erkenntnisse zu ziehen. Eine solche Betrachtungsweise oder Forscher-Haltung hegen jedoch diejenigen – ungeachtet ihrer Herkunft – die sich m.E. grundsätzlich als humanistisch bezeichnen, bezeichnet werden (S.142). Der Aufsatz kann hier im Volltext heruntergeladen werden. [Bibliographische Angaben: Der Aufsatz erschien in: Yadigar Eğit (Hg.) (2010) XI. Türkischer Internationaler Germanistik Kongress, 20.-22. Mai 2009. İzmir: Ege Üniversitesi Matbaası (S.140-155)].
29. Oktober 2012
von Wolfgang Loth
Keine Kommentare


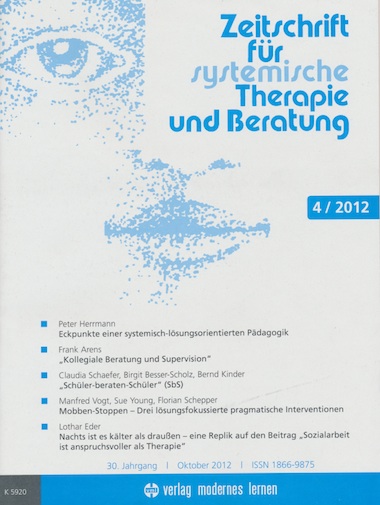
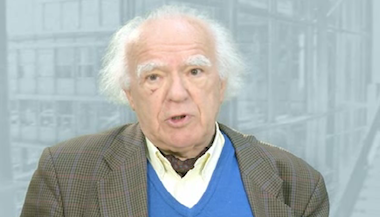

 Ein nicht unwesentlicher Aspekt der systemisch-konstruktivistischen Kritik an psychoanalytischen Ansätzen galt schon immer der Deutung im therapeutischen Gespräch. Mit einer Deutung wird das Handeln einer anderen Person in dem Sinne deutet, dass dieser Gründe und Motive für ihr Handeln zugerechnet werden, die die gemeinte Person selbst nicht geltend gemacht hat – oder sogar abstreitet. Wird die Deutung in der Psychoanalyse mit einem Wahrheitsanspruch oder mit überlegenem Experten-Zugriff auf die„eigentliche“ Wirklichkeit ausgestattet, wie es durchaus bei einigen psychoanalytischen Autorinnen und Autoren den Anschein hat, liegt es auf der Hand, damit nicht übereinstimmende andere Wahrnehmungen, Selbsterleben der Klienten etc. als Widerstand gegen die Aufdeckung der eigenen wahren Motive zu verstehen. Mit einer solchen Perspektive kann sich dann der Therapeut gegen die interaktive Zumutung unterschiedlicher Wahrnehmungen immunisieren.„Einer Person Beweggründe zuzuschreiben, die von ihr nicht geteilt werden, bedeutet aber nicht nur, die Ebene der Intersubjektivität zu verlassen und die Person als Objekt zu behandeln, sondern heißt darüber hinaus, in Anspruch zu nehmen, die Beweggründe der Person besser zu kennen als diese selbst“. Nun sind Deutungen aber ja nicht nur eine therapeutische Technik, sondern ein Alltagsphänomen, das immer dann zu finden ist, wenn Verhalten von Menschen von anderen Menschen erklärt bzw. diesen Motive zugeschrieben werden, die sie selbst nicht in Anschlag bringen. In einem sehr lesenswerten Artikel hat
Ein nicht unwesentlicher Aspekt der systemisch-konstruktivistischen Kritik an psychoanalytischen Ansätzen galt schon immer der Deutung im therapeutischen Gespräch. Mit einer Deutung wird das Handeln einer anderen Person in dem Sinne deutet, dass dieser Gründe und Motive für ihr Handeln zugerechnet werden, die die gemeinte Person selbst nicht geltend gemacht hat – oder sogar abstreitet. Wird die Deutung in der Psychoanalyse mit einem Wahrheitsanspruch oder mit überlegenem Experten-Zugriff auf die„eigentliche“ Wirklichkeit ausgestattet, wie es durchaus bei einigen psychoanalytischen Autorinnen und Autoren den Anschein hat, liegt es auf der Hand, damit nicht übereinstimmende andere Wahrnehmungen, Selbsterleben der Klienten etc. als Widerstand gegen die Aufdeckung der eigenen wahren Motive zu verstehen. Mit einer solchen Perspektive kann sich dann der Therapeut gegen die interaktive Zumutung unterschiedlicher Wahrnehmungen immunisieren.„Einer Person Beweggründe zuzuschreiben, die von ihr nicht geteilt werden, bedeutet aber nicht nur, die Ebene der Intersubjektivität zu verlassen und die Person als Objekt zu behandeln, sondern heißt darüber hinaus, in Anspruch zu nehmen, die Beweggründe der Person besser zu kennen als diese selbst“. Nun sind Deutungen aber ja nicht nur eine therapeutische Technik, sondern ein Alltagsphänomen, das immer dann zu finden ist, wenn Verhalten von Menschen von anderen Menschen erklärt bzw. diesen Motive zugeschrieben werden, die sie selbst nicht in Anschlag bringen. In einem sehr lesenswerten Artikel hat 
 Die SCRIPT CORPORATE+PUBLIC COMMUNICATION GmbH, eine Frankfurter Agentur für Unternehmenskommunikation, feiert ihr 10jähriges Jubiläum mit einem interessanten Internet-Projekt:
Die SCRIPT CORPORATE+PUBLIC COMMUNICATION GmbH, eine Frankfurter Agentur für Unternehmenskommunikation, feiert ihr 10jähriges Jubiläum mit einem interessanten Internet-Projekt:  Psychotherapie ist ein komplexes Geschäft. Das wird spätestens dann deutlich, wenn man sich therapeutische Kommunikation unter einer mikroanalytischen Perspektive betrachtet. Janet Beavin Bavelas (Foto: web.uvic.ca), die bereits in den 60er Jahren gemeinsam mit Paul Watzlawick und Don D. Jackson den Klassiker„Menschliche Kommunikation“ verfasst hat, ist seit dieser Zeit als Forscherin mit der Mikroanalyse therapeutischer Prozesse beschäftigt. Gemeinsam mit Dan McGee, Bruce Phillips und Robin Routledge hat sie 2000 im Journal„Human Systems: The Journal of Systemic Consultation & Management“ einen wunderbaren Aufsatz über ihre Arbeit verfasst. Im abstracts heißt es:„Microanalysis, which is the close examination of actual communication sequences, can be a useful way to understand how therapeutic communication works. This is a preliminary report on our research groups applications of microanalysis to communication in psychotherapy. We first describe the historical origins in the Natural History of an Interview Project of the 1950s and then the subsequent evolution of an alternative paradigm for psychotherapy, which has two key tenets: communication as co-constructive (vs. merely information transmission) and a more positive (vs. pathological) view of clients. Next, we use microanalysis to illustrate how communication in therapy, examined closely, cannot be nondirective. Finally, we describe the functions of three specific discursive tools available to therapists: Questions both embed the therapists presuppositions and invite the client to co-construct a particular version of events. Formulations (such as paraphrasing or reflection) inevitably transform, to some degree, what the client has said. Lexical choice, or the decision to use particular words or phrases, can create new perspectives. Each of these tools is illustrated by contrasting their use in traditional and alternative therapeutic approaches. We propose that the effects of each of these tools are inevitable; the only choice is how to use them“
Psychotherapie ist ein komplexes Geschäft. Das wird spätestens dann deutlich, wenn man sich therapeutische Kommunikation unter einer mikroanalytischen Perspektive betrachtet. Janet Beavin Bavelas (Foto: web.uvic.ca), die bereits in den 60er Jahren gemeinsam mit Paul Watzlawick und Don D. Jackson den Klassiker„Menschliche Kommunikation“ verfasst hat, ist seit dieser Zeit als Forscherin mit der Mikroanalyse therapeutischer Prozesse beschäftigt. Gemeinsam mit Dan McGee, Bruce Phillips und Robin Routledge hat sie 2000 im Journal„Human Systems: The Journal of Systemic Consultation & Management“ einen wunderbaren Aufsatz über ihre Arbeit verfasst. Im abstracts heißt es:„Microanalysis, which is the close examination of actual communication sequences, can be a useful way to understand how therapeutic communication works. This is a preliminary report on our research groups applications of microanalysis to communication in psychotherapy. We first describe the historical origins in the Natural History of an Interview Project of the 1950s and then the subsequent evolution of an alternative paradigm for psychotherapy, which has two key tenets: communication as co-constructive (vs. merely information transmission) and a more positive (vs. pathological) view of clients. Next, we use microanalysis to illustrate how communication in therapy, examined closely, cannot be nondirective. Finally, we describe the functions of three specific discursive tools available to therapists: Questions both embed the therapists presuppositions and invite the client to co-construct a particular version of events. Formulations (such as paraphrasing or reflection) inevitably transform, to some degree, what the client has said. Lexical choice, or the decision to use particular words or phrases, can create new perspectives. Each of these tools is illustrated by contrasting their use in traditional and alternative therapeutic approaches. We propose that the effects of each of these tools are inevitable; the only choice is how to use them“