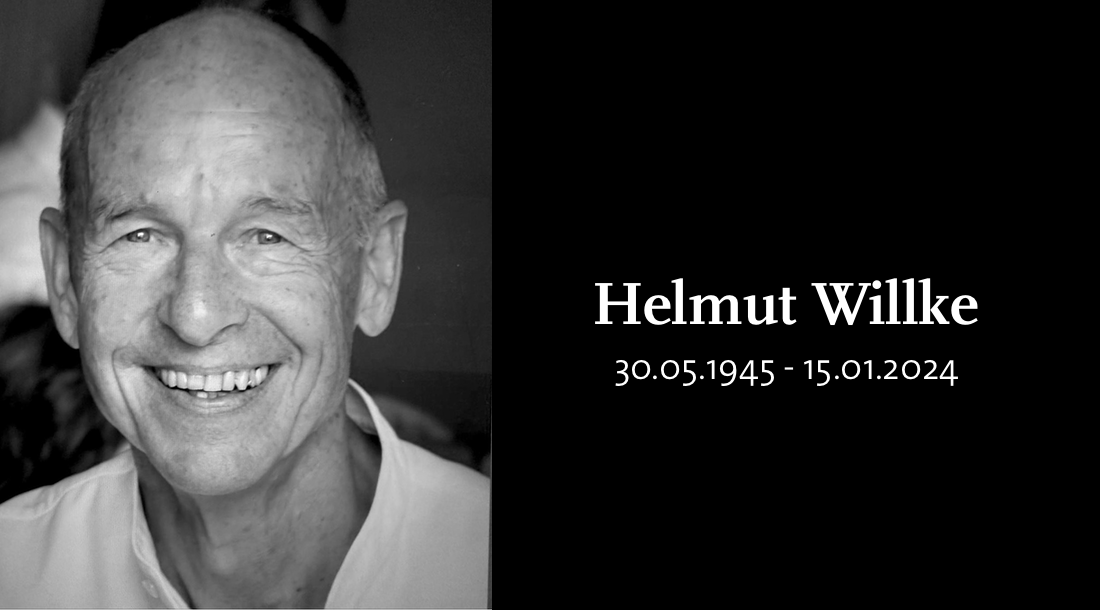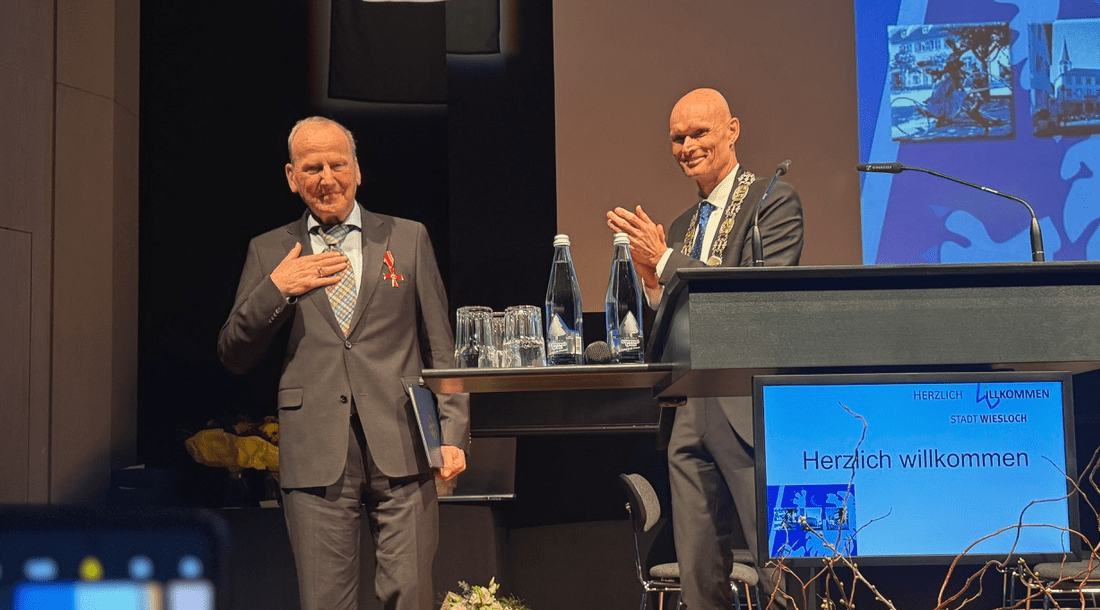23. Dezember 2023
von Tom Levold
2 Kommentare
Zwei Welten, die Unterschiede machen – zu Weihnachten
Passend zur Adventszeit und für eines dieser Kalendertürchen habe ich recherchiert, was Bateson wohl zu Weihnachten gesagt hat oder hätte. Geschenke, Rentier, Tannenbaum, Spekulatius – nichts dergleichen findet sich in den Schlagwortverzeichnissen seiner Hauptwerke. Umpf…
Bei genauerem Hinschauen bin ich doch noch fündig geworden. Auch wenn nicht klar ist, ob er diese zu Weihnachten verschenken wollte, aber Bateson hat im Laufe seines Lebens zwei Kisten gepackt (1979, S. 14f) – und es spricht ja nichts dagegen, sie jetzt im Advent mal auszupacken. Auch wenn sich nur Beschreibungen und Probleme darin befinden; aber das ist ja zur Weihnachtszeit bekanntlich gar nichts so Ungewöhnliches.
Also Bateson hat zwei Kisten gepackt.
In die eine Kiste hat er „die Beschreibungen von Stöcken, Steinen und Billardkugeln“ (1979, S. 14) gesteckt. In die andere „Krebse, Menschen, Probleme der Schönheit und Probleme des Unterschieds“ (Ebd.). Jede dieser Kisten beinhaltet nun eine Welt: die erste die des Unbelebten, die zweite die des Lebendigen[1]. So weit – so gut. Und nun? Was macht das für einen Unterschied?
Ich denke an sein Beispiel mit dem Stein und dem Hund (Ebd., S. 126f): Ersterer fliegt auf einigermaßen vorhersehbare Weise, wenn wir ihn treten. Mit Stöcken und Billardkugeln wird es sich wohl ähnlich verhalten, je nach Talent und Übung. Anders der Hund – ob er jault, beißt oder auch fliegt, wenn wir ihn treten[2], wissen wir vorher nicht, da nützen auch Talent und Übung nichts. Mit Krebsen und Menschen wird es sich wohl ähnlich verhalten, aber Probleme der Schönheit und des Unterschieds treten? Hm…
Jedenfalls scheint es wichtig zu sein, sich dieser zwei Welten bewusst zu sein, wie Watzlawick schreibt:
„Wir müssen umdenken lernen. Wie das aussehen kann, dafür bietet uns Bertrand Russell einen sehr wichtigen und brauchbaren Hinweis. Er verweist darauf, daß ein häufiger Fehler in der Wissenschaft darin liege, zwei Sprachen zu vermengen, die streng voneinander getrennt sein müßten. Nämlich die Sprache, die sich auf die Objekte bezieht, und die, die sich auf Beziehungen bezieht. Ein Beispiel: wenn ich sage, dieser Apfel ist rot, dann habe ich in der Objektsprache eine Eigenschaft dieses Objektes Apfel bezeichnet. Sage ich dagegen, dieser Apfel ist größer als jener, dann habe ich eine Aussage über die Beziehung gemacht, die sich nicht mehr auf den einen oder den anderen Apfel zurückführen läßt. Die Eigenschaft des Größerseins kann nur in Bezug auf die Beziehung verstanden werden. Das ist so schwer zu begreifen. Unser beginnendes Verständnis der Eigenschaften von Beziehungen ist noch ein sehr rudimentäres und gibt uns bisher eigentlich mehr Rätsel auf als Erklärungen.“ (1992, S. 26f)
Ob Bateson diese rätselhaften Kisten wohl mal zu Weihnachten verschenkt hat? Dazu ist nichts überliefert. Für mich sind sie dennoch ein Geschenk.
Bateson, G. (1979). Geist und Natur. Eine notwendige Einheit. (4. Auflage, 1984). Frankfurt: Suhrkamp.
Watzlawick, P. (1992). Vom Unsinn des Sinns oder vom Sinn des Unsinns. Wien: Picus.
[1] Diese zweite Kiste ist übrigens Inhalt seines Buches „Geist und Natur“ (1979).
[2] Ich gehe nicht davon aus, dass Bateson das selbst ausprobiert hat oder es zu tun empfehlen würde.