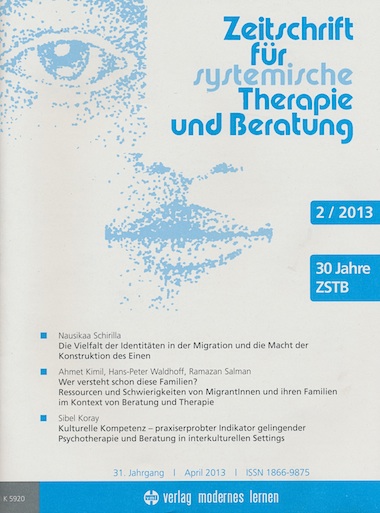16. Mai 2013
von Tom Levold
Keine Kommentare
 Im Berliner Parodos-Verlag, einem jungen philosophischen Verlag mit den Fachgebieten Philosophie, Psychiatrie, Psychoanalyse, Sozialwissenschaften, Politische Wissenschaften sowie Kultur- und Medienwissenschaften erschien 2007 ein Band zum Thema„Subjektivität und Gehirn“, herausgegeben von Thomas Fuchs, Kai Vogeley und Martin Heinze. Ein Rezensent attestierte den Herausgebern, dass es ihnen„in hervorragender Weise gelungen (sei), das Subjektive wieder in sein Recht zu setzen: Das Jahrzehnt des isolierten Gehirns ist vorbei“ Auch Günter Schiepek (Foto) hat für diesen Band einen Beitrag verfasst, der auch online zu lesen ist, in dem er sich mit dem Verhältnis von neuronalen und mentalen Prozessen aus Sicht der Synergetik auseinandersetzt. Im abstract heißt es:„Der Beitrag thematisiert die Möglichkeit, Bewusstsein und die Erfahrung des Selbst mit Hilfe neuronaler Selbstorganisation zu erklären. Dabei wird deutlich, dass die Synergetik als Wissenschaft der Selbstorganisation grundlegende Prinzipien der Funktionsweise des Gehirns beschreibt, die unter anderem auch in der Erfahrung des
Im Berliner Parodos-Verlag, einem jungen philosophischen Verlag mit den Fachgebieten Philosophie, Psychiatrie, Psychoanalyse, Sozialwissenschaften, Politische Wissenschaften sowie Kultur- und Medienwissenschaften erschien 2007 ein Band zum Thema„Subjektivität und Gehirn“, herausgegeben von Thomas Fuchs, Kai Vogeley und Martin Heinze. Ein Rezensent attestierte den Herausgebern, dass es ihnen„in hervorragender Weise gelungen (sei), das Subjektive wieder in sein Recht zu setzen: Das Jahrzehnt des isolierten Gehirns ist vorbei“ Auch Günter Schiepek (Foto) hat für diesen Band einen Beitrag verfasst, der auch online zu lesen ist, in dem er sich mit dem Verhältnis von neuronalen und mentalen Prozessen aus Sicht der Synergetik auseinandersetzt. Im abstract heißt es:„Der Beitrag thematisiert die Möglichkeit, Bewusstsein und die Erfahrung des Selbst mit Hilfe neuronaler Selbstorganisation zu erklären. Dabei wird deutlich, dass die Synergetik als Wissenschaft der Selbstorganisation grundlegende Prinzipien der Funktionsweise des Gehirns beschreibt, die unter anderem auch in der Erfahrung des  Bewusstseins und des Selbst münden. Die Frage ist dabei, wie transiente Kohärenzen, Synchronisationsmuster und Ordnungsübergänge neuronaler Netze und ihres Funktionierens entstehen. Der Beitrag beschreibt, welche Hirnstrukturen die Voraussetzungen für die Selbstorganisation von Bewusstsein und Selbst bereitstellen. Damit ist allerdings der qualitative Sprung in die subjektive Erfahrung, in die Qualia-Qualität und in die Erste-Person-Perspektive nicht aufgelöst; es bleibt bei Theorien der Ermöglichung und bei Korrelaten wenngleich diese der Komplexität des Geschehens durchaus gerecht werden mögen. Somit werden schließlich auch die Grenzen der Möglichkeit deutlich, Bewusstsein und Selbst über (Varianten der) Emergenz zu erklären“
Bewusstseins und des Selbst münden. Die Frage ist dabei, wie transiente Kohärenzen, Synchronisationsmuster und Ordnungsübergänge neuronaler Netze und ihres Funktionierens entstehen. Der Beitrag beschreibt, welche Hirnstrukturen die Voraussetzungen für die Selbstorganisation von Bewusstsein und Selbst bereitstellen. Damit ist allerdings der qualitative Sprung in die subjektive Erfahrung, in die Qualia-Qualität und in die Erste-Person-Perspektive nicht aufgelöst; es bleibt bei Theorien der Ermöglichung und bei Korrelaten wenngleich diese der Komplexität des Geschehens durchaus gerecht werden mögen. Somit werden schließlich auch die Grenzen der Möglichkeit deutlich, Bewusstsein und Selbst über (Varianten der) Emergenz zu erklären“
Zum vollständigen Text geht es hier
 Die aktuelle Kritik am neuen DSM-V kommt nicht nur von denen, die ohnehin den Nutzen der standardisierten Diagnostik-Systeme bezweifeln, sondern direkt aus den eigenen Reihen. Allen Frances, 71, ist US-amerikanischer Psychiater und war Leiter der Task Force, die die Version IV des Diagnostic and Statistical Manual zu verantworten hatte. Nun ist er einer der bekanntesten Kritiker des DSM-V aus den Reihen der Psychiatrie geworden – siehe auch hier. Im Dumont-Verlag ist gerade sein Buch„NORMAL: Gegen die Inflation psychiatrischer Diagnosen: Der Kampf um die Definition geistiger Gesundheit“ erschienen. Auch im Internet ist einiges von ihm zum Thema zu lesen,
Die aktuelle Kritik am neuen DSM-V kommt nicht nur von denen, die ohnehin den Nutzen der standardisierten Diagnostik-Systeme bezweifeln, sondern direkt aus den eigenen Reihen. Allen Frances, 71, ist US-amerikanischer Psychiater und war Leiter der Task Force, die die Version IV des Diagnostic and Statistical Manual zu verantworten hatte. Nun ist er einer der bekanntesten Kritiker des DSM-V aus den Reihen der Psychiatrie geworden – siehe auch hier. Im Dumont-Verlag ist gerade sein Buch„NORMAL: Gegen die Inflation psychiatrischer Diagnosen: Der Kampf um die Definition geistiger Gesundheit“ erschienen. Auch im Internet ist einiges von ihm zum Thema zu lesen,
 Gestern starb der Theologe, Journalist und Schriftsteller Ernst Klee im Alter von 71 Jahren. Wie kein anderer hat er die Geschichte der Tötung von Psychisch Kranken und Behinderten im Dritten Reich recherchiert und veröffentlicht, einem nationalsozialistischen Massenmord, der am längsten verleugnet und nicht beachtet worden ist. Seine Bücher sind
Gestern starb der Theologe, Journalist und Schriftsteller Ernst Klee im Alter von 71 Jahren. Wie kein anderer hat er die Geschichte der Tötung von Psychisch Kranken und Behinderten im Dritten Reich recherchiert und veröffentlicht, einem nationalsozialistischen Massenmord, der am längsten verleugnet und nicht beachtet worden ist. Seine Bücher sind 
 Bewusstseins und des Selbst münden. Die Frage ist dabei, wie transiente Kohärenzen, Synchronisationsmuster und Ordnungsübergänge neuronaler Netze und ihres Funktionierens entstehen. Der Beitrag beschreibt, welche Hirnstrukturen die Voraussetzungen für die Selbstorganisation von Bewusstsein und Selbst bereitstellen. Damit ist allerdings der qualitative Sprung in die subjektive Erfahrung, in die Qualia-Qualität und in die Erste-Person-Perspektive nicht aufgelöst; es bleibt bei Theorien der Ermöglichung und bei Korrelaten wenngleich diese der Komplexität des Geschehens durchaus gerecht werden mögen. Somit werden schließlich auch die Grenzen der Möglichkeit deutlich, Bewusstsein und Selbst über (Varianten der) Emergenz zu erklären“
Bewusstseins und des Selbst münden. Die Frage ist dabei, wie transiente Kohärenzen, Synchronisationsmuster und Ordnungsübergänge neuronaler Netze und ihres Funktionierens entstehen. Der Beitrag beschreibt, welche Hirnstrukturen die Voraussetzungen für die Selbstorganisation von Bewusstsein und Selbst bereitstellen. Damit ist allerdings der qualitative Sprung in die subjektive Erfahrung, in die Qualia-Qualität und in die Erste-Person-Perspektive nicht aufgelöst; es bleibt bei Theorien der Ermöglichung und bei Korrelaten wenngleich diese der Komplexität des Geschehens durchaus gerecht werden mögen. Somit werden schließlich auch die Grenzen der Möglichkeit deutlich, Bewusstsein und Selbst über (Varianten der) Emergenz zu erklären“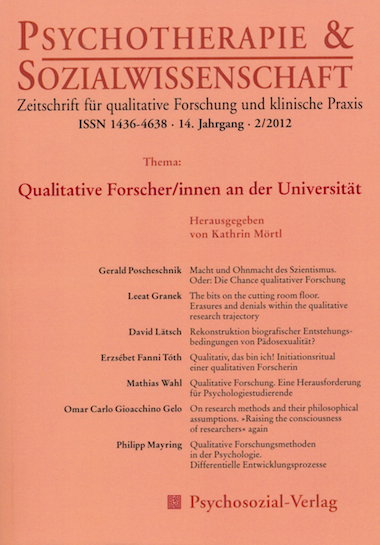
 Forschers, ihrer akademischen Sozialisation, ihrer Interessen und Karrierewünsche ebenso wie ihrer emotionalen Involvierung in den Forschungsprozess in die Betrachtung ihrer Forschungsvorhaben. Kathrin Mörtl (Foto: SFU Wien), die in der Einleitung auch von ihren eigenen Ambivalenzen und Erfahrungen berichtet, ist es gelungen, ein außerordentlich interessantes Heft zusammenzustellen, dessen Beiträge das Spannungsfeld von professioneller und persönlicher Perspektive ausloten uns sowohl den wissenschaftspolitischen und grundlagentheoretischen Kontext thematisieren als auch z.B. der Frage nachgehen, was es mit Verleugnungen und Löschungen im Prozess qualitativer Forschung auf sich hat: was bleibt„off the record“ (Gedanken, die zwar im Prozess auftauchen, aber den Weg in die Forschungsberichte nicht schaffen), was bleibt„off the books“, wird also niemals veröffentlicht und was bleibt„off the charts“, also unbewusste oder auch einfach nicht erwünschte persönliche Aspekte der Forschung. Ein tolles Heft, das Forschungsinteressierte zur Kenntnis nehmen sollten!
Forschers, ihrer akademischen Sozialisation, ihrer Interessen und Karrierewünsche ebenso wie ihrer emotionalen Involvierung in den Forschungsprozess in die Betrachtung ihrer Forschungsvorhaben. Kathrin Mörtl (Foto: SFU Wien), die in der Einleitung auch von ihren eigenen Ambivalenzen und Erfahrungen berichtet, ist es gelungen, ein außerordentlich interessantes Heft zusammenzustellen, dessen Beiträge das Spannungsfeld von professioneller und persönlicher Perspektive ausloten uns sowohl den wissenschaftspolitischen und grundlagentheoretischen Kontext thematisieren als auch z.B. der Frage nachgehen, was es mit Verleugnungen und Löschungen im Prozess qualitativer Forschung auf sich hat: was bleibt„off the record“ (Gedanken, die zwar im Prozess auftauchen, aber den Weg in die Forschungsberichte nicht schaffen), was bleibt„off the books“, wird also niemals veröffentlicht und was bleibt„off the charts“, also unbewusste oder auch einfach nicht erwünschte persönliche Aspekte der Forschung. Ein tolles Heft, das Forschungsinteressierte zur Kenntnis nehmen sollten! „Wenn sich Deutsche und Spanier streiten, muss es nicht immer an den interkulturellen Unterschieden liegen. Transnationale Projekte bieten eine ganze Palette an möglichen Konfliktlinien. Braucht es hier Kulturexperten? Oder erfahrene Mediatoren? Können wir als systemische Berater nur noch mit einem ausländischen Counterpart erfolgreich sein?“ Diesen Fragen gehen Ute Clement (Foto: Carl Auer Verlag) und Bettina Nemeczek in einem lesenswerten Aufsatz mit dem Titel„Mythos Kultur Erfahrungen in einer transnationalen Projektberatung“ nach, der in der Ausgabe 4/2000 in der Zeitschrift Organisationsentwicklung erschienen ist. Beide Autorinnen arbeiten als systemische Beraterinnen von internationalen und transnationalen Projekten.
„Wenn sich Deutsche und Spanier streiten, muss es nicht immer an den interkulturellen Unterschieden liegen. Transnationale Projekte bieten eine ganze Palette an möglichen Konfliktlinien. Braucht es hier Kulturexperten? Oder erfahrene Mediatoren? Können wir als systemische Berater nur noch mit einem ausländischen Counterpart erfolgreich sein?“ Diesen Fragen gehen Ute Clement (Foto: Carl Auer Verlag) und Bettina Nemeczek in einem lesenswerten Aufsatz mit dem Titel„Mythos Kultur Erfahrungen in einer transnationalen Projektberatung“ nach, der in der Ausgabe 4/2000 in der Zeitschrift Organisationsentwicklung erschienen ist. Beide Autorinnen arbeiten als systemische Beraterinnen von internationalen und transnationalen Projekten.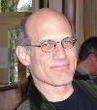 m psychiatriekritischen Internetforum„Mad in America. Science, Psychiatry and Community“ haben Eugene Epstein (Foto), Manfred Wiesner und Lothar Duda anlässlich der aktuellen Veröffentlichung des DSM-V einen
m psychiatriekritischen Internetforum„Mad in America. Science, Psychiatry and Community“ haben Eugene Epstein (Foto), Manfred Wiesner und Lothar Duda anlässlich der aktuellen Veröffentlichung des DSM-V einen