Thorsten Padberg hat vor einiger Zeit ein längeres Gespräch mit Jürgen Hargens geführt, das ursprünglich für einen anderen Veröffentlichungskontext gedacht war und nun im systemagazin erscheint.
Thorsten Padberg, Berlin: „Wenn die Leute kommen, ist Beziehung da…“. Ein Gespräch mit Jürgen Hargens
Für eine Zeitschrift soll ich einen Text zur Langzeittherapie schreiben: „Schwere Störungen brauchen lange Therapien.“ Jürgen Hargens und ich kennen uns per Email, weil wir beide über Therapien schreiben und uns gelegentlich austauschen. Als ich ihn frage, ob er mir etwas zu langen Therapien aus Sicht eines Kurzzeittherapeuten erzählen will, sagt er sofort ja. Treffpunkt wird das Schwarze Café in Berlin. Um uns herum wird Essen serviert, es ist laut und wuselig. Jürgens Hargens stört das nicht, er kennt sein Thema und spricht gerne darüber. Er hat viel mehr dazu zu sagen, als am Ende in einen kurzen Text zur Langzeittherapie hineinpassen wird. Unser Gespräch über schwere Diagnosen, schnelle Lösungen und schlaue Klienten in voller Länge:
Sie sind ja einer der prominentesten Vertreter der lösungsorientierten Therapie in Deutschland…
Das sagen Sie so. Ja, ja. Gut.
… und haben viel dazu veröffentlicht. Was glauben Sie: Wie kommt die lösungsorientierte Therapie so schnell zu ihren Erfolgen, was ist der Wirkfaktor?
Ich glaube, das sind zwei/drei Aspekte. Jeder Aspekt hat viele Unteraspekte: Die Leute, die zur sogenannten „Therapie“ kommen, ernst zu nehmen, ihr Leiden zu würdigen und letztlich immer ein Ohr dafür zu haben, wo diese Leute Kompetenzen haben und gezeigt haben. Das ist etwas, das für die Leute völlig neu ist. Jemand, der leidet, fühlt sich einfach nur schlecht. Und jetzt kommen Leute und ich sage – ich nehm‘ mal ein ganz plattes Beispiel – „du hast mit diesem Leiden zwanzig Jahre überlebt. Das ist ja auch eine Fähigkeit. Die macht das Leben nicht leichter.“
Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied, glaube ich. Die lösungsorientierten Leute nehmen ihr Gegenüber sehr ernst, respektieren die Person, würdigen sie und reden ihr Leben nicht schön. Und deshalb: Das Lösungsorientierte ist etwas anderes als ‚positiv denken‘. Und es ist auch keine Technik. Es ist eine gnadenlos anstrengende Haltung, nämlich darauf zu vertrauen: „Ich glaube, dass Du es schaffst“. Oder wie Insoo Kim Berg immer so schön gesagt hat: „Ich weiß nicht wann, ich weiß nicht, wie du dich änderst – ich weiß nur, dass du dich änderst!“

Thorsten Padberg
Sie nennen das eine Haltung. In der klassischen Psychotherapieforschung wird ja inzwischen davon ausgegangen, dass die therapeutische Beziehung das hauptsächlich Heilsame am therapeutischen Prozess ist. Da würden Sie zustimmen?
Ja. Es gibt allerdings interessante Untersuchungen dazu, die das in einem ganz anderen Licht erscheinen lassen, nämlich Untersuchungen, die sagen: Die therapeutische Beziehung – oder wie immer man es nennen will – hat einen hohen Anteil am Therapieerfolg. Allerdings so, wie die Betroffenen die Beziehung sehen – nicht, wie die Fachleute die Beziehung sehen. Und das macht einen Unterschied. Wenn ein Betroffener mit seinem Therapeuten nicht zufrieden ist, sagt der Therapeut: „Widerstand“. Der lösungsorientierte Therapeut sagt dagegen: „Hm, ich bin wahrscheinlich nicht auf dem richtigen ‚Dampfer‘, weil die Person etwas anderes will als das, was ich gerne wollte, dass er tun sollte“, und fragt dann erneut, was er erreichen möchte. Und das macht einen gravierenden Unterschied.
Wie bauen lösungsorientierte Therapeuten dann eine Beziehung auf? Was ist das spezifisch Lösungsorientierte an der Therapiebeziehung?
Ich glaube, dass lösungsorientierte Leute sich wenig Gedanken über Beziehungen machen – weil sie sagen: „Wenn die Leute zur Arbeit kommen, zur Therapie kommen, ist eine Beziehung da. Es geht jetzt nur darum, sie in einem positiven Sinne für die Betroffenen aufrecht zu erhalten und zu verbessern. Und das ist relativ einfach, indem ich die Leute frage: „Oh, schön, dass Sie da sind. Wie kann ich Ihnen helfen?“. Und nicht: „Schön, dass Sie da sind – jetzt zeige ich Ihnen mal, was Sie machen müssen“. Das möchte keiner.
Das wäre das spezifisch lösungstherapeutische Beziehungsangebot.
Ja, man macht sich viel zu viele Gedanken über Beziehung. Man muss sie pflegen oder erstmal herstellen…. Wenn die Leute kommen, ist Beziehung da. Sonst sind die ja gar nicht da. Und dann geht’s nur darum: Was hat Vorrang? Und die lösungsorientierten Leute – das ist meine Einschätzung und meine Erfahrung – die gehen davon aus: Wichtig ist, an dem zu arbeiten, was die Leute wollen – so verrückt das auch manchmal erscheinen mag. Aber die Leute haben für das, was sie wollen, gute Gründe. Und oft wird dann vergessen, dass das, was die Leute zeigen, in ihrem Verhalten – auch in negativem Verhalten oder im Leiden – Fähigkeiten beinhaltet. Also ich erzähle immer dieses etwas gemeine Beispiel von dem Jugendlichen, der es schafft, innerhalb von zwei Sekunden in der Familie Chaos herzustellen: Die Eltern hängen unter der Decke, wissen nicht weiter, sind verzweifelt und grollen rum. Das Ergebnis ist für das Familienleben ziemlich schlecht. Aber die Fähigkeit dieses Jugendlichen, das in zwei Sekunden hin zu kriegen – das schafft nicht jeder Jugendliche. Das muss er sich irgendwie beigebracht haben. Das heißt, er hat Fähigkeiten, das heißt, er ist lernfähig – das sind alles Fähigkeiten, auf die man sich beziehen kann. Und das schafft Irritation bei den Leuten. Wir unterscheiden oft – glaube ich – viel zu wenig zwischen dem Ergebnis und der Fähigkeit, die in dem Ergebnis enthalten ist, egal wie schlecht es aussieht.
Das heißt, Sie würden nicht das chaotische Ergebnis, sondern die gestalterische Kraft, die dahinter steckt, nutzen.
Ja. Und das verblüfft die Leute, weil sie das ja als Defizit sehen. „Ja, das Ergebnis, das ist einfach unter aller Sau. Aber dass du das kannst – das kann nicht jeder.“
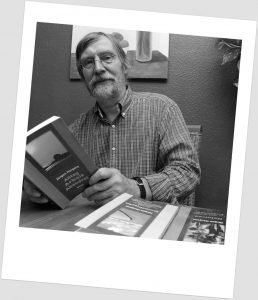
Jürgen Hargens (Foto: J. Hargens)
Würden Sie dem Jugendlichen zu seiner Fähigkeit, Chaos zu stiften, noch mehr sagen?
‚Wie gewinnen Jugendliche oder Kinder Fähigkeiten?‘ Das sind ja letztlich alles Erziehungserfolge der Eltern. Und das irritiert die Familie, weil erstens die Eltern dadurch gestärkt werden, dass ihr Kind Fähigkeiten hat. Das ist ja auch etwas Neues für die, weil sie denken, da ist nur Chaos. Und zweitens steht der Jugendliche oder das Kind vor dem Dilemma, dass er sich nicht dahinter verschanzen kann, dass er nicht lernfähig ist, denn er hat ja was gelernt – nämlich, seine Eltern auf die Palme zu bringen. Und die Frage ist, ob er das weiter so nutzen will. Und das führt zu Irritationen und in der Regel zu Reflexionsprozessen – das ist meine Erfahrung.
Ist das ausreichend?
Ich glaube, das ist der erste Schritt, die Solidität von Selbstbildern ein bisschen anzuschubsen, anzustoßen. Und zwar auf eine wertschätzende Art. Sie haben ja danach gefragt, was das Lösungsorientierte ausmacht – ich glaube, das Wertschätzen macht sehr, sehr viel aus. Wertschätzen ist etwas anderes als Schönreden. „Du bist es wert. Nur das, was du zeigst, ist nicht akzeptabel“.
Kann man das komplett trennen von den Fragetechniken, die normalerweise gelehrt werden in der lösungsorientierten Therapie, wie die Wunderfrage oder die Ausnahmefrage?
Meine Erfahrung ist, dass Lösungsorientierung etwas mit Haltung zu tun hat. Und jetzt ist die Frage: ‚Wie lehrt man Haltung?‘ Über Techniken. Nur ist die Technik als solche noch keine Haltung. Und da ist immer wieder der Reflexionsprozess: Wie verbinden sich Technik und Haltung? Und insofern ist das im lösungsorientierten Bereich auch heute noch teilweise so, dass das mehr über die richtige Fragetechnik definiert wird. Ich kenne zum Beispiel ganz viele Leute, die sagen: „Wenn Du als Therapeut viel arbeitest, dann ist es keine gute Sitzung, weil es der Kunde ist, der arbeiten muss“. Ich sage dazu: Natürlich ist es gut, wenn der Kunde arbeitet, und ich trage meinen Teil dazu bei, dass er arbeitet. Und das ist verdammt harte Arbeit! Die darf nur nicht so aussehen. Es gibt das Beispiel von den Artisten in der Zirkuskuppel, die am Trapez ihre Kunst zeigen. Die fliegen da ganz leicht durch die Luft. Das sieht wunderbar leicht aus, nur wieviel Jahre intensivsten Trainings steckt dahinter, dass es so aussieht? So ähnlich ist es, glaub ich, mit der Lösungsorientierung. Das ist harte Arbeit. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber sinngemäß lautet ein Zitat: ‚Diszipliniert und einfach zu arbeiten, ist harte Arbeit und erfordert viel, viel Training‘. Bei lösungsorientierten Beratern, die sich nur über die Technik definieren, geht für mich ein Teil verloren. Ich habe in meiner Praxis Patienten, kundige Menschen, die sagen mir: „Lassen Sie mal diese Fragen, die kenn ich schon alle!“.
Was machen Sie dann?
Stell ich andere Fragen!
Ist es dann trotzdem noch lösungsorientiert?
Ja. Also erstmal bestätige ich die Leute und mache ihnen ein dickes Kompliment dafür, dass sie so klar sagen, was sie nicht wollen. Und die nächste Frage ist: „Und was möchten Sie hier erreichen?“. Und dann sind wir wieder im Geschäft. Es ist relativ einfach. Das heißt aber nicht, dass es leicht ist. Und das wird oft verwechselt.
Ja: einfach, aber nicht leicht. Viele Leute bekommen ja schon von anderer Stelle schwere Diagnosen gestellt: Borderline z.B., Persönlichkeitsstörungen, schwere Depressionen, mehrere Diagnosen. Man sagt, dass das nicht schnell behandelbar ist. Es gibt inzwischen große Anstrengungen, genau das auch empirisch nachzuweisen. Geht’s auch schneller?
Ja! Es ist eine vertrackte Geschichte, dass Lösungsorientierung oft mit „schnell“ assoziiert wird, es muss schnell gehen. Und ich glaube, es geht nicht darum, dass es schnell geht, sondern dass es lösungsorientiert bleibt. Das kann auch Jahre dauern. Das ist keine Frage der Zeit, sondern der Haltung. Also… wenn es sogenannte ‚schwere Störungen‘ gibt, ist doch die erste Frage: Wer stellt fest, dass es schwer ist? Das ist ja meist ein Etikett, das die Fachleute verpassen. Und die lösungsorientierten Leute – das ist für mich einer der Quantensprünge des lösungsorientierten Arbeitens – gehen ja davon aus, dass die Leute, die zur Therapie kommen, letztlich immer bereit sind, zu kooperieren. Auf ihre Art. Die sagen auch manchmal „Ne, das ist Mist, was Sie machen!“. Das ist ihre Art, zu kooperieren. Und die lösungsorientierten Leute bemühen sich einfach, damit wertschätzend, respektvoll umzugehen. So, jetzt kommt jemand und sagt, „Ich war schon bei fünf Therapeuten, ich hab ‘ne ganz schwere Störung usw. usw.“. Das ist doch als erstes etwas, was diese Person besonders macht und auszeichnet. Das kann man erstmal würdigen, dass diese Person so etwas hat, so etwas überlebt hat und offen darüber redet.
Und immer wieder Hilfe sucht.
Und Hilfe sucht. Und nicht aufgibt! D.h., Zutrauen zu sich hat. Das sind doch ganz viele positive Aspekte. Und dann ist die Frage: „Und was möchten Sie jetzt hier erreichen?“ Und oft wird dann danach gesucht‚ woran es liegt, dass es schief gegangen ist. Ich erzähl dazu gerne eine Anekdote aus meiner eigenen Praxis: Es kam jemand zu mir, und ich frage ihn: „Was ist Ihr Ziel?“ Ich lass mal weg, welche Störung das ist. Das Ziel war: „Ich möchte wissen, woran es liegt“. Darauf sage ich: „Ja, das heißt, wenn wir rausgearbeitet haben, woran das liegt, dann hört die Arbeit hier auf“. Die Antwort war ein erstauntes „Ne!“. Ich sage: „Wieso, dann wissen Sie doch, woran es liegt, das wollen Sie doch erreichen!“. „Ja, dann will ich’s ändern!“. Ich sage: „Ah ja, und jetzt hab ich es nicht verstanden. Wollen Sie wissen, woran es liegt oder wollen Sie es ändern?“. Nach einer kurzen Pause: „Ja, eigentlich will ich das ändern!“. Und dann ist die Frage: „Und was hätten Sie gerne anders?“ Und dann bin ich wieder beim Ziel. Ich muss nicht durch das Tal der Tränen gehen. Viele Leute denken, ich muss über diesen großen Berg rüber. Und wenn ich über den Berg rüber will – heißt das doch, ich will auf die andere Seite! Ich geh‘ einfach außen rum, das ist viel einfacher.
Sie argumentieren immer praktisch – man kann das ja auch gut nachvollziehen – was man tun kann. Gefragt wird oft auch nach der Forschung. Gibt es Forschung zu schweren Störungen, die mit lösungsorientierter Therapie behandelt worden sind?
Es gibt eine interessante Sache über die sogenannte „single session therapy“ –Therapie in einer Sitzung – darüber hat Moshe Talmon geforscht. Die haben festgestellt, der Modalwert über alle Therapien – also der am häufigsten auftretende Sitzungswert – ist eins. Das wird nur ignoriert. Und Forschung geht ja immer davon aus, dass sie objektive Fakten produziert. Letztlich weiß man ja, dass Forschung sozusagen ein Konsens der Wissenschaftsgemeinde produziert, aber nicht unbedingt die Wahrheit. Und die Frage ist doch immer: Wer forscht, und wer hat die Forschungsmittel? Und da sind wir dann in einem ganz andern Kontext. Forschungsmittel werden an wissenschaftliche Institute vergeben, die werden i.d.R. von nicht-lösungsorientierten Leuten dominiert – also werden die auch nicht viel lösungsorientiert forschen. Die kommen nur interessanterweise auf lösungsorientierte Ideen, die sie dann anders verkaufen. Also gerade die Verhaltenstherapeuten – da ist ja Grawe sehr aktiv gewesen – und der ist ja dann irgendwann zu dieser Idee gekommen, dass Ressourcenaktivierung eine hohe Bedeutsamkeit hat. Und das ist doch das, was die lösungsorientierten Leute schon seit einer ganzen Zeit machen: „Welche Ressourcen hast du? Und wie kannst du die nutzen, um das, was du erreichen möchtest, zu erreichen?“ Ich glaube einfach, dass genau dann, wenn es um wissenschaftliche Anerkennung geht, eine Rolle spielen könnte, dass wissenschaftliche Anerkennung immer auch mit einem materiellen Überleben in der sozialen Wirklichkeit verbunden ist: Wer kriegt das Geld? Und dann ist es nicht die Frage ‚Wer hat Recht?‘, sondern ‚Wer hat die Macht?‘. Diese Frage soll nur nicht thematisiert werden, weil man dann angeschossen wird nach dem Motto ‚Ja, aber Wissenschaft beweist doch’. Gut, und das ist der Punkt, wo ich mich dann gelassen zurücklehne und lächle.
Auch auf die Gefahr hin, dass man Sie für unwissenschaftlich hält.
Ja. Das definiere ich inzwischen als Kompliment. Ich arbeite unwissenschaftlich – d.h., ich bin erfolgreich.
Nach welchen Kriterien?
Indem ich einfach praktisch mit Leuten arbeite. Welcher forschende Wissenschaftler arbeitet konkret mit Leuten, die im praktischen Alltag Probleme haben? Viele Forschungen sind mit Studierenden durchgeführt worden. Das ist nicht das klassische Klientel. Und ja, einfach ein bisschen mehr – Bateson hat es ‚Demut und Bescheidenheit‘ genannt. Das würde allen gut anstehen, damit man im Gespräch bleiben kann. Und das halte ich für den wichtigen Punkt. Nicht, wer Recht hat, sondern im Gespräch zu bleiben. Und nicht immer über die Leute zu reden, sondern mit ihnen zu reden. Und das fällt Experten schwer, glaube ich. Also, das Interessante, um nochmal auf die Wirksamkeit und die Forschung zurück zu kommen: Ich glaube, es ist inzwischen relativ unbestritten in der Forschung, dass Therapie wirkt. Man weiß nur immer noch nicht wie. Und es gibt eine interessante Aussage von zwei Amerikanern – die haben das bei der APA mal veröffentlicht – die sagten ‚Ja, dass jede Therapie im Grunde wirkt, könnte doch daran liegen, dass die Klienten das, was ihnen von den Therapeuten angeboten wird, so nutzen, dass sie kriegen, was sie wollen – unabhängig davon, was angeboten wurde‘. Und es ist ja manchmal verblüffend: Zu einem sagt man, „Mach das!“, und der macht das. Und der andere sagt, „Bist du bescheuert?“.
Interessanterweise steht das inzwischen sogar im ‚Bergin und Garfield‘ – dieses dicke Psychotherapieforschungshandbuch: ‚Offensichtlich gibt es eine große Subgruppe von Patienten, die so findig sind, dass sie noch vor Einsatz therapeutischer Interventionen ihre eigenen Lösungen gefunden haben’.
Ja, diese beiden Amerikaner haben diesen interessanten Beitrag geleistet – das finde ich so schön zum Nachdenken – die haben die Frage gestellt, ‚Wieso heißt das, was Therapeuten tun, „Intervention“, und das, was Klienten tun, „Reaktion“? Das könnte man auch umdrehen. ‚Ich geh jetzt zur Therapie, weil ich das und das von meinem Therapeuten hören möchte‘. Und der Therapeut macht das. – Ja, wer hat dann reagiert, und wer interveniert? Das ist ein Geschäft auf Gegenseitigkeit und hat mir die Arbeit erleichtert. Ich habe dann irgendwann aufgehört, von ‚Therapie‘ zu reden. Ich rede von „Arbeit“, weil sich zu ändern harte Arbeit ist. Und ich rede auch nicht mehr von „Klienten“ oder „Patienten“. Eine Zeitlang hab ich mich auch an diesen Begriff gewöhnt, von „Kunden“ zu reden, den finde ich aber nicht so passend.
Ja, das hat was sehr Kapitalistisches.
Ja. Deshalb hab ich das inzwischen geändert, das ist dann ein Wortungetüm: Ich spreche von „kundigen Menschen“. Und es macht was anderes. Und sobald ich das Leuten, die Therapie bei mir machen wollen, sage, „Können wir uns auf ‚Arbeit‘ einigen?“, kommt als erstes immer ein leichtes Lächeln. Wenn Du richtig krank bist, brauchst du eine schwere Behandlung, Therapie. Das ist so die Erfahrung: ‚Es ist schwer und hart‘.
Aber es reicht auch, wenn es drei Stunden lang schwer und hart ist in der ‚Beratung‘?
Also ich sag den Leuten – die leiden immer, wenn sie kommen -, dass es ihnen schon schlecht genug geht. Warum sollen die denn die Stunde, die sie bei mir sind, auch noch leiden? Da geht’s doch einfach darum, ihnen auch Möglichkeiten aufzuzeigen. Weil ich einfach denke, dass viele in so einer Falle sitzen: Entweder krank oder gesund. Das sind die berühmten zwei Seiten einer Medaille. Das ist Blödsinn, jede Medaille hat noch eine schmale Seite. Es gibt mindestens drei Seiten. Wenn es drei Seiten gibt, kann es auch noch mehr geben. Also raus aus diesem ‚entweder-oder‘.
Und man kann vielleicht auch die Frage stellen, ob Begriffe wie „gesund“ und „krank“ überhaupt Sinn machen im psychologischen Bereich.
Ja. Also die lösungsorientierten Leute haben hier eine faszinierende Idee entwickelt, die – vereinfacht gesagt – so lautet: ‚Menschen haben für alles das, was sie tun, gute Gründe. Gute Gründe. Gute Gründe. Aber wenn sie mit ihrem Leiden zu Experten kommen, wird ihnen erstmal klar gemacht: Das ist schlecht. Wo sind da die guten Gründe? Und das ist etwas, was in der Regel ein bisschen Irritation bei den Leuten hervorruft, wenn ihr Leid gewürdigt wird. Auch als Fähigkeit, auch als guter Grund. Und die fühlen sich dann in der Regel viel stärker respektiert und ernst genommen, glaube ich.
Die Frage, ob man Leiden sinnvoll findet oder nicht, kommt ja auch schon mit Vorfestlegungen. Wenn man mit manchen Psychiatern spricht, ist für die Leiden ja immer komplett sinnlos, das muss einfach weg-mediziert werden. Während Psychologen – selbst die problemorientierten – dem Ganzen ja meist noch einen gewissen Sinn zusprechen.
Ja, aber auf der anderen Seite ist es doch so: Also wenn’s mir schlecht geht und ich leide, ist doch die Frage: ‚Ist das für mich ok, oder ist es nicht ok? Oder ist es nur etwas zu viel, oder ist es nur etwas zu lange? Oder will ich gar nicht mehr?‘ – das macht doch einen Unterschied. Also gerade beim Leiden – ich kenn sowas auch: Leuten, die erzählt haben, dass sie leiden und dass es ihnen schlecht geht oder so, denen habe ich oft Geschichten von mir erzählt! Ich habe gesagt: Ich kenne solche Situationen auch. Ich bin unterwegs und weiß, es wird ein Scheiß-Tag. Und dann komm ich irgendwann wieder nach Hause und denke „Ja, das war wirklich ein Scheiß-Tag“. Und es geht mir gar nicht gut. Dann überlege ich immer „Hast du noch was Gutes zu essen zuhause?“ Einen guten Wein habe ich immer. Und dann gibt’s vielleicht noch die Schleife um das Geschäft, um etwas Gutes zu essen zu kaufen. Ich komme nach Hause, mach mir ein schönes Essen, mit schönem Wein, und dann steh ich vor dem CD-Regal und überlege, welche CD legst du jetzt auf, die dich so richtig runterzieht? Dann leg ich die CD auf, schönen Wein, schön essen, und es geht mir saumäßig schlecht – irgendwie gut! Schlecht – irgendwie gut. Dann gehe ich ins Bett, schlafe, am nächsten Morgen geht’s mir besser. Das habe ich vielen Leuten so erzählt. Und die Reaktion war bei 95% der Leute: Die gucken mich an und sagen, „Das kenn‘ ich auch“. Und das hat oft dazu geführt, dass, wenn die Leute zur letzten Sitzung kamen und sich an der Tür verabschieden, sie sagten, „Ja, ich hab noch was für Sie. Wir wissen ja, wie Sie das machen – vielleicht eine CD oder eine Flasche Wein. Es ist relativ normal, zu leiden.“
Das ist eine wichtige Botschaft.
Ja, und das soll man nicht weg machen, aber die Frage ist: „Passt mir das, oder möcht ich irgendwie anders leiden?“ Es gibt ja diesen schönen Satz – wie heißt das – „Lerne leiden, ohne zu klagen“. Ich formuliere den inzwischen immer um, ich sage „Lerne klagen, ohne zu leiden!“ Ja, und solche Sprachspiele führen dazu, dass die Leute oft lächeln. Und das setzt etwas frei. Alex Molnar und die Barbara Lindquist haben früher mit Steve de Shazer zusammen gearbeitet. Die haben mal so schön ein chronisches Problem definiert. Sie haben gesagt, ein chronisches Problem ist eines, über das du noch nicht lachen kannst. Das fand ich am Anfang ‚typisch US-amerikanisch’. So ein bisschen vereinfachend. Und im Laufe der Jahre dachte ich, ‚Ne, da ist was dran: Wenn ich darüber lächeln kann, hab ich meinem Problem schon signalisiert: Also, Du bist schon ganz in Ordnung. Manchmal nervst du mich, aber in Ordnung bist du.’ Und das hat bei mir zu dieser völlig verrückten Idee geführt: Probleme sind wie Menschen. Die wollen geliebt werden. Wenn sie geliebt werden, gehen sie auch leichter, weil sie werden ja geliebt. Wenn sie nicht geliebt werden …
… müssen sie um Liebe betteln.
Genau, und dann bleiben sie dran. Oder wie ich das dann im Scherz immer sage: Das ist meine Depression, die ich mit der rechten Hand umarme, das ist mein Alkoholismus, den ich mit dem linken Arm umarme, und dann geh ich in die Kneipe. Ja, wir kriegen sofort immer einen Platz.
Ich würde jetzt gerne nochmal zurück auf einen früheren Punkt. Sie hatten gesagt, lösungsorientiertes Arbeiten ist nicht notwendigerweise kurz, das kann Jahre dauern. Jetzt ist die Frage nach Langzeittherapie eng mit ökonomischen Fragen verbunden. Es ist ja eigentlich ein Verkaufsargument für die lösungsorientierte Therapie, dass sie verspricht, schnell zu sein. Ken Gergen sagt dazu: ‚Das, was ich an den lösungsorientierten Leuten mag, ist, dass sie gesagt haben, dass das, von dem alle andern immer gesagt haben, es dauert lange, das kann auch schnell gehen’. Wie lang ist denn dann „ok“, wann müssen wir Schluss mit der Therapie machen?
Ja, es gibt unterschiedliche Varianten. Und ich habe das für mich in meiner Praxis so umgesetzt, dass ich die Kundigkeit der Leute voraussetze. Und hab den Leuten immer zu verstehen gegeben: ‚Für Termine bin nicht ich zuständig, sondern Sie. Wenn Sie denken, es macht Sinn, müssen Sie sich um Termine kümmern.’ Man wird mich immer leicht los. Aber man kriegt mich immer leicht ins Spielfeld, man fragt einfach nach einem Termin, das hat sich bewährt. Und es gibt die ganze Bandbreite: Manche Leute sind einmal gekommen, manche dreimal, manche zehnmal, aber es war immer deren Entscheidung. Und es beginnt immer mit derselben Frage: „Was möchten Sie heute erreichen?“.
Jetzt arbeiten Sie ja vermutlich vorwiegend mit Selbstzahlern. Wenn der Staat da rein kommt, ändert sich die Situation. Der Staat will natürlich auch wissen, ‚Wo investier ich meine Mittel am effektivsten?‘ Die Befürchtung, die dahinter steht, ist, dass a) die Therapeuten ein finanzielles Interesse daran haben, dass Leute lange kommen und b) Klienten es sich in der Therapie einfach gut gehen lassen. Wie kann man als Therapeut dafür sorgen, dass es nicht länger als „notwendig“ dauert – was immer „notwendig“ in diesem Zusammenhang heißen soll.
Ja. Für mich bedeutet „Notwendigkeit“, dass das eine Entscheidung der kundigen Menschen ist, nicht meine. Und ich glaube, wenn ich lösungsorientiert arbeite, ist die Zeit, die die Leute bei mir während dieser Arbeitssitzung verbringen harte Arbeit. Das machen die nicht, weil sie es toll finden oder sich gut fühlen. Natürlich fühlen sie sich auch gut, sonst würden sie ja nicht wiederkommen. Das ist harte Arbeit.
Beißt sich das etwas mit der Idee, dass die therapeutische Beziehung so ausgesprochen wichtig ist und dass man so stark wertgeschätzt wird. Und wenn man so wertgeschätzt wird, ist das doch ausgesprochen schön.
Ja, nur ich kann ja auch dafür wertschätzen, dass jemand sagt „Ich komm wieder, ich arbeite dran, ich hab’s gemacht“, oder nach dem Motto „Ich hab’s versucht, hat nicht geklappt“ – das kann ich auch wertschätzen. Das spricht ja für Kompetenz. Und das ist das, was die Leute schätzen. Und dann merken sie auch, das ist harte Arbeit, das ist kein Zuckerschlecken. Sich zu ändern ist unglaublich schwere und harte Arbeit. Und das wird deutlich, aber immer in einem wertschätzenden – oder wie man das auch viel freundlicher und verfänglicher sagen kann – in einem liebevollen Rahmen. Und der ist wichtig! Also, es ist – gerade, wenn ich mit Jugendlichen gearbeitet habe und deren Eltern – so: Einige Leute, die das miterlebt haben, sagen: „Du bist ja irgendwie direktiv und konfrontativ!“. Und ich sage: „Nein, ich bin nur wertschätzend!“. Und Jugendliche spielen da mit!
Haben Sie ein Beispiel?
Ja, da ist immer so der, der irgendwie nicht zur Schule gehen will und auch keine Hausaufgaben machen will, und die Eltern sagen, „Du musst doch die Schule schaffen“. Und die Frage an ihn ist: „Und was ist mit Dir, willst‘ Du die Schule schaffen?“ Und die meisten sagen: „Ja!“ Und dann frag ich: „Ist mir jetzt nicht ganz klar. Wie machst du das? Einfach nicht zur Schule gehen, keine Hausaufgaben, nicht lernen, die Schule schaffen – find‘ ich genial.“ Und das Extrem: Ich habe mal jemandem gesagt: „Schade, dass ich dich nicht früher kennengelernt hab“ Guckt der mich an, ich sag so: „Ja, weißte, nicht zur Schule gehen, nicht lernen und die Schule schaffen – genial. Also ich mach dir ‘n Angebot: Du erzählst mir, wie das geht. Ich tipp‘ das ab – Verlag finden wir – das wird der Bestseller schlechthin, du kriegst 80%, ich 20%, keiner von uns braucht mehr arbeiten: Wann erzählst du mir das?“ „Äh, ja, hm, äh…“. Ich sage: „Was, wann?“ „Ja…“ Daraufhin sagte er, dass das nicht geht. „So ein Mist, ich habe mich schon gefreut!“. Aber da sind wir im Gespräch. Und ich mache ihm nicht klar: ‚Du bist ein Idiot, weil das geht nicht – weißt du doch selber‘, sondern ich sage, ich nehme dich ernst. Und das ist das Schlimmste, was den Leuten passieren kann. Keine pädagogischen Diskussionen, ich nehme dich ernst. Und dann kommt: „Ja, das hängt doch davon ab, ob ich versetzt werde, hängt doch vom Lehrer ab.“ Daraufhin ich: „Ist doch Blödsinn, ich war auch mal zur Schule, und ich weiß, wie man Lehrer manipuliert – weißte doch auch – also wirst du versetzt?“ Und irgendwann kommt: „Ja, dann müsst‘ ich ja was tun.“ „Ich weiß. Mich interessiert nicht, ob du was tun musst, ich will wissen, ob du versetzt wirst!“ Und das Interessante ist, dass die Jugendlichen mitgehen und das auch als sehr wertschätzend empfinden und nicht als konfrontativ, weil jemand sie ernst nimmt und weitergeht. Und das ist ein Teil der Herausforderung dieser Arbeit: wertschätzend am Ball zu bleiben.
Um nochmal auf das Beendigungskriterium zu schauen: Es gibt ja zwei Arten von ‚Fehlern‘. Einmal: die Therapie endet zu früh, und es bleiben quasi ‚Reste‘, und die müssen dann später nachbehandelt werden, oder es wird sogar noch schlimmer. Und auf der anderen Seite droht immer diese Frage: „Sitzen da nicht lauter Leute in Therapie, die es eigentlich gar nicht brauchen?“.
Ich lächle immer darüber, weil ich jahrelang mit Ärzten zusammen gearbeitet habe, auch in psychosomatischen Projekten. Und es gibt diese Idee ‚einmal zur Psychotherapie, und ich bin für mein Leben kuriert‘. Ich finde, wer diese Idee hat, sollte mal so ein halbes Jahr lang oder regelmäßig zu bestimmten Zeiten in Arztpraxen gehen. Er wird dann immer die gleichen Leute finden, die immer das gleiche Symptom zeigen. Aber es ist immer eine andere Krankheit. Es ist immer wieder die Grippe – aber es ist immer eine neue Grippe.
Das ist ein gutes Bild.
Und bei den Psychotherapeuten ist es: „Ach, die Angst ist wieder da, die war gar nicht weg – müssen wir mehr machen“. Statt so: ‚Ach, die Angst war weg, toll! Ach, jetzt ist wieder eine Angst da – ah ja‘. Damit kann man die Psychos aufschrecken: „Der kommt ja schon wieder“. Wieso eigentlich? Und Lösungsorientierung hat – das ist meine Erfahrung – noch einen ungeheuer präventiven Aspekt, der oft unterschätzt wird. In vielen Jahren Praxis kriegte ich immer wieder Anrufe von Leuten, die sich meldeten mit dem Hinweis „Ja, ich war schon, ich war schon vor ’n paar Jahren mal bei Ihnen und ich brauch‘ ganz dringend ‘nen Termin“. Gut, die kriegen dann in der Regel auch relativ schnell einen, und dann kommen die – jetzt überzeichne ich mal ein bisschen – ich brauch die manchmal gar nicht zu fragen, was sie wollen, sondern die kommen mit dem Gedanken „Ich brauch mal wieder ‘ne neue Perspektive von Ihnen, Sie haben immer so interessante Perspektiven gehabt.“ „Welche hätten Sie denn gerne?“ „Ja die und die und die“ – das geht ganz schnell, dann sind die wieder weg. Das heißt, die Leute entwickeln die Idee, dass es nicht unbedingt darum geht, ein Verhalten zu verändern, sondern damit anzufangen, einen anderen Blick darauf zu werfen. Und dann passiert etwas. Und das finde ich eine ganz spannende Geschichte.
Eine Frage, die sich mir in dem Zusammenhang immer stellt, ist: Wenn Leute schon seit Jahren dasselbe Problem haben, kann man denen dann auch schnell helfen?
Ja. Wenn Leute seit Jahren immer das gleiche Problem haben, haben die doch auch eine bestimmte Kompetenz, an Problemen festzuhalten und sich das auch zu trauen. Und die Frage ist: „Das können Sie gut, und was ist jetzt Ihr Ziel, wenn Sie zu mir kommen? Soll ich Sie davon abbringen? Oder soll ich Sie stärken, dass Sie’s gut behalten?“ Und dann müssen die Leute Farbe bekennen. Und das ist ein Unterschied. Und oft wird ja versucht, über die Vergangenheit zu gehen, weil da die Ursache liegt. Ich sag‘ immer, dadurch werde ich ursachen- und problemsensibel. Ich lerne, herauszufinden, wann es passiert. Ich komme in soziale Situationen und sage: „Da ist es wieder, da ist es wieder!“ – bums, und dann ist es passiert. Jetzt kann ich die Leute ja auch lösungssensibler machen. Es gibt bestimmte Kontexte, in denen das besser ist: „Ach, das ist besser, das ist besser, das ist besser“ – dann wird es besser. Das ist die alte Geschichte: Rede über Probleme – sie werden größer. Rede über Lösungen – sie werden größer. Und wir neigen dazu, zu verallgemeinern. Das ist immer mein Lieblingsbeispiel aus der Psychiatrie mit den Diagnosen: Erst bekommst du eine Diagnose, dann hast du eine Diagnose. Erst bekommst du die Diagnose „depressiv“, dann hast du die Diagnose und dann bist du depressiv. Gut. Das könnte man auch mit einem Auto machen: Erst bekommst du ein Auto, dann hast du ein Auto, und dann bist du ein Auto. Das ist verrückt!
Eine der Möglichkeiten, aus ökonomisch schwierigen Situationen oder schwierigen Arbeitsprozessen auszusteigen ist ja auch, psychische Störungen zu entwickeln. Wie würden Sie das würdigen?
Das ist jetzt eine schwer zu beantwortende Frage, weil das ein fiktives Beispiel ist. Das ist eine Idee: Jemand will sich rauswinden und entwickelt eine psychische Störung. Die Frage ist für mich: Will er irgendwas ändern? Und dann ist es völlig unerheblich, aus welchen Gründen er diese psychische Störung entwickelt hat. Die Frage ist: Was will er denn dann?
Also ich denke an Klienten, die kommen und sagen, „Ich würde ja wieder arbeiten gehen, aber da ist diese schreckliche Chefin und bevor ich nicht sicher bin, dass ich das aushalte, geh‘ ich da nicht mehr hin“.
Und das ist ja eine Problembeschreibung. Und die Frage ist ja: „Und was möchten Sie jetzt?“.
Also zum Beispiel: „Ich muss innere Stärke und Gelassenheit entwickeln“.
Ok, gut, das ist ja ein Ziel, und das muss man dann präzisieren: „Was genau heißt das? Was machen Sie dann? Was machen Sie dann, was Sie jetzt nicht machen? Wie zuversichtlich sind Sie, dass Sie das hinkriegen?“ Und dann sind wir im Gespräch. Das ist immer das Gleiche. Und ich glaube einfach, dass sich Fachleute oft dazu verführen lassen, in das Problem einzusteigen, das die Leute schildern.
Der Hirnforscher Gerhard Roth hat gesagt, massive Verbesserungen der psychotherapeutischen Versorgung ließen sich erreichen, wenn es aufhört, dass Klient und Therapeut sich darauf einigen, wann die Sitzungen zu Ende sind. Und man das stattdessen mit objektiven Messmethoden bestimmen würde. Solange es nichts Besseres gibt, nehmen wir Becks Depressions-Inventar oder die Hamilton-Skala. Und sobald die Werte über einen längeren Zeitraum nach unten gegangen sind, hören wir auf.
Es gibt im Grunde aus meiner Sicht zwei Kriterien, sozusagen: Es gibt die Leute, die im Risiko stehen, sich selber was anzutun oder andern was anzutun. Da muss ich sehr sauber unterscheiden: Kann ich da therapeutisch unter Offenheit arbeiten, oder kann ich deutlich machen: ‚Gib mir zu verstehen, dass du dir und andern nichts antust, sonst muss ich etwas unternehmen. Das, finde ich, ist eine ganz wichtige Entscheidung, die ich treffen muss. Es geht auch um Essstörungen: Wenn jemand sich zu Tode hungert, ist es wichtig, irgendwann zu sagen: „So, du kannst bis zu diesem Punkt, aber wenn du den unterschreitest, kann ich dir sagen, was passiert.“ Das finde ich wichtig, weil ich finde, das ist auch menschlich. Und das andere ist: Was sind denn objektive Kriterien? Objektive Kriterien heißt in diesem Falle: Die wissenschaftliche Fachwelt stellt fest, das muss so sein. Was ist daran objektiv. […] Und für mich übersetze ich das immer so ‚Ja, wenn du wissen willst, ob die Therapie wirksam ist – frag dein Gegenüber, den kundigen Menschen, weil der weiß es am besten‘. Die Frage ist: Was trau ich meinem Gegenüber zu?
Genau, und viele würden – z.B. bei Persönlichkeitsstörungen – sagen: Nicht so viel, weil gerade da weiß man ja als Betroffener oft gar nicht, was das Problem ist.
Ja. Und dann kann ich den doch fragen! Und dann muss er mir antworten, und mit der Antwort kann ich umgehen. Ich hab mal zu einem Paar gesagt, es ging tendenziell auch um Gewalt – Mann gegen die Frau: „Ich arbeite gerne mit Ihnen weiter, nur ein Kriterium: Während wir zusammenarbeiten keine Gewalt.“ Alle nicken. Ich sage zu dem Mann: „Ja, Entschuldigung, aber überzeugen Sie mich mal, dass Sie in der Zeit keine Gewalt ausüben.“ „Wie soll ich das denn machen?“ „Ja entschuldigen Sie, das ist nicht mein Problem!“.
Und die lassen sich dann etwas einfallen?
Die arbeiten dran. Weil, das anders ist. Weil ich ihnen deutlich mache: Du kannst mir viel erzählen, und es gibt Erfahrungen über Dich. Die Erfahrung lautet: Du hast es immer gemacht, und die nehme ich ernst. Und wieso sollte das anders sein? Das ist Deine Verantwortung, das klar zu machen – nicht meine. Ich glaube Dir gerne, aber die Anzeigen sprechen eine andere Sprache.
Der Autor und Psychotherapeut Gary Greenberg nennt psychiatrischen Diagnosen „noble Lügen“. Er sagt irgendjemand muss sagen, wofür Geld aufgewandt wird, wer beraten werden darf. Und dafür sind Diagnosen erfunden worden. Niemand weiß, ob es diese Störungen gibt oder nicht. Aber es gibt Experten, die sagen: Wir dürfen das, wir verteilen diese Diagnosen. Das ist quasi das Ticket dafür, dass man mit jemandem kostenlos reden darf. Das heißt, wir brauchen sie doch?
Nein! Wieder nur ein praktisches Beispiel – es kommt jemand zu mir: „Was möchten Sie denn?“ – „Ich hab‘ ‘ne Depression“. Sage ich: „Äh, ist das Ihr Begriff, oder wo haben Sie’s her?“ „Das ist mein Begriff.“ „Wie haben Sie’s gemerkt?“ Dann kommen Beschreibungen: weinen, alles so schwarz sehen und andere Verhaltensweisen. Dann sage ich: „Ja, und wie ging’s dann weiter?“ „Dann bin ich zum Arzt gegangen.“ „Ja und dann?“ „Ja, der hat gesagt, ich hab ‘ne Depression.“ „Ach, der Arzt hat gesagt, Sie haben Depression!“ Mit „Depression“ kann ich nicht arbeiten, aber mit den konkreten Verhaltensweisen!
Ich glaube, für den praktischen Teil der Arbeit, haben Sie Recht: Die Frage, die dahinter steht, ist ja wieder eine ökonomische. Es werden staatliche Gelder investiert, um genau diese ‚Krankheiten‘ zu behandeln. Wenn wir von dem Krankheitsbegriff wegkämen, würde man möglicherweise sagen‚ das ist dein Privatvergnügen‘ – dann bleiben aber nur noch die Leute über, die sich einen Termin bei Herrn Hargens leisten können. Und das kann wahrscheinlich ein großer Teil der Bevölkerung nicht.
Das weiß ich nicht. Das geht wieder auf ein ganz anderes Gleis: Wie wird das soziale Gesundheitssystem organisiert? Also ich bleibe jetzt mal bei der Medizin: Wieso gibt es noch Mediziner in freien Praxen, die Geld verdienen müssen? Wieso sagt man nicht gleich: Jeder Arzt verdient im Monat – ich weiß nicht – 15.000 oder 20.000 Euro plus Praxiskosten. Dafür arbeitet er dann. Und da geht jeder hin. Das Geld ist da! Es wird nur so nicht gemacht, weil es ja alles ökonomisch, wirtschaftlich organisiert sein muss. Wieso soll ein Krankenhaus Profit erwirtschaften? Wie sollen jetzt die Leute mit Gesundheit wirtschaften? Man kann doch Psychologen genauso bezahlen: „Du hast hier eine Praxis und du arbeitest so-und-so, und dafür kriegst du dein Geld. Und was du nachweisen musst, ist die Arbeit, die du leistest.“
Das hieße, man müsste das Gesundheitssystem verändern.
Das ist kein Problem der Psychotherapie, sondern ein politisches Problem. Da muss man Kontexte klären, und das wird oft nicht gemacht.
(Dieses Gespräch fand Mitte März 2017 in einem Berliner Café statt. Wir danken Sylvia Krafcyk, die dieses Gespräch hervorragend transkribiert hat)


Das ist ein grandioser Beitrag aus den praktischen Gewässern – so arbeite ich, so isses. Vielen Dank!