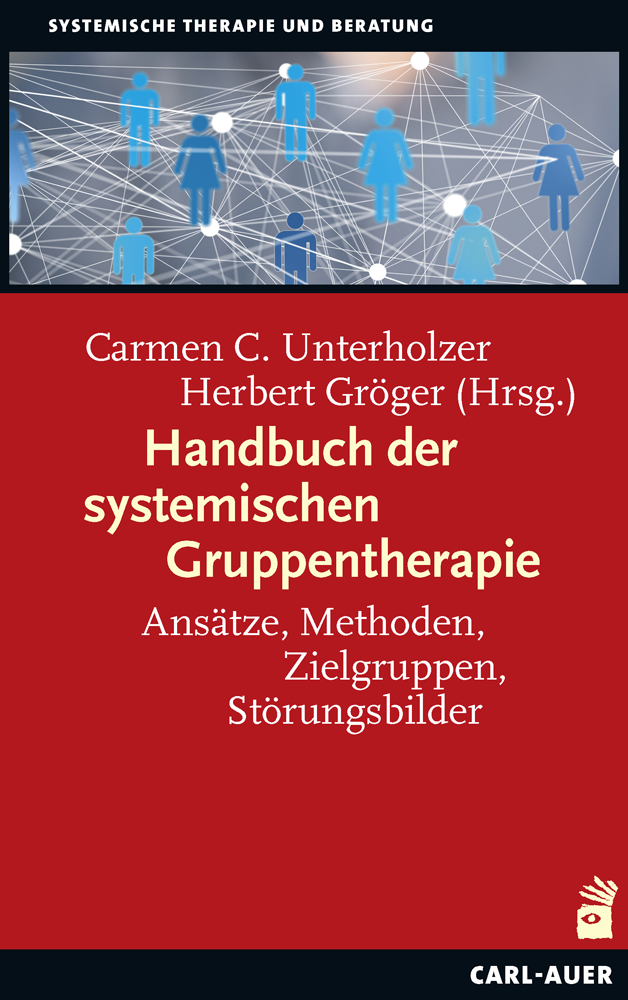Systemische Therapie mit Familien und Paaren, heutzutage sogar überwiegend mit Einzelpersonen, ist seit Jahrzehnten fest im psychotherapeutischen Repertoire verankert. Die Frage nach der systemtherapeutischen Arbeit mit Gruppen ist in dieser Zeit immer nur hier und da einmal aufgetaucht, was verwundert, ist doch das Plädoyer für die Arbeit mit dem Mehrpersonensetting von Beginn an ein Mantra der systemischen Bewegung gewesen. Ein sehr umfangreiches Handbuch zum Thema ist bereits 2022 im Carl-Auer-Verlag erschienen, Andrea Brandl-Nebehay hat es rezensiert.
Andrea Brandl-Nebehay, Wien
Ein großes, mutiges Vorhaben, das Carmen Unterholzer und Herbert Gröger, beide seit vielen Jahren am Institut für systemische Therapie (IST) in Wien tätig, in Angriff genommen haben: Die Grundlagen, Methoden und Anwendungsfelder der systemischen Gruppentherapie auszuloten und praxisfreundlich in ein Handbuch zu fassen.
Ich habe die beiden Herausgeber:innen in einer der ersten systemischen Ausbildungsgruppen, die ich als angehende Lehrtherapeutin leiten durfte, kennengelernt und hege den Verdacht, dass den beiden schon damals ein Defizit deutlich wurde: Systemische Ausbildung findet zwar hauptsächlich in Gruppen statt und wird in diesem Rahmen als Ort und Raum der Vermittlung, Erprobung und Selbsterfahrung genutzt, jedoch wird Gruppentherapie bislang wenig reflektiert, damals wie heute. Dies erscheint umso erstaunlicher, als sich Systemiker:innen – unter Verweis auf ihre familientherapeutischen Wurzeln – ihre besondere Kompetenz für die Arbeit in Mehrpersonensettings auf die Fahnen schreiben und somit für die therapeutische Arbeit mit Gruppen besonders gut gerüstet sein könnten.
Erste Versuche, dieses Defizit ausgleichen, führten Carmen Unterholzer und Herbert Gröger zunächst zu intensiven Literaturrecherchen (mit magerem Ergebnis), später zu eigener Forschung und Publikationen und schließlich zur Entwicklung eines Curriculums zur systemischen Gruppentherapie, das nun seit einigen Jahren am Institut für systemische Therapie (IST) in Wien angeboten wird. Thematische Schwerpunkte dieser Seminare bilden die unterschiedlichen Ansätze in der systemischen Gruppentherapie (lösungsorientiert, narrativ, hypnosystemisch), Methoden- und Settingfragen sowie Überlegungen zu bestimmten (störungsspezifischen) Zielgruppen im stationären und ambulanten Bereich. Aus dem Pool der – durchwegs renommierten – Referent:innen dieser Curricula, die im deutschsprachigen Raum in unterschiedlichen stationären Einrichtungen oder im klinisch-ambulanten Bereich tätig sind, rekrutieren sich im Wesentlichen auch die insgesamt 30 Autor:innen des vorliegenden Werks zur systemischen Gruppentherapie.
Das schwergewichtige Handbuch gliedert sich in sechs jeweils unterschiedlich umfangreiche Teile: Grundlagen (1), Ansätze (2), Methoden (3) und Zielgruppen (4) systemischer Gruppentherapie; die letzten beiden Teile befassen sich mit Störungsbildern (5) und mit Fragen der Forschung (6). Flankiert und bereichert werden die Hauptteile des Buchs von einem Vorwort von Fritz Simon und einer begleitenden Einführung der beiden Herausgeber:innen. Von der sorgfältigen Arbeit, die in dieses Produkt eingeflossen ist, zeugt auch das Literaturverzeichnis, das allein 32 Seiten umfasst.
Die Lücke in den theoretischen Grundlagen (Teil 1) zu schließen oder zumindest das oben angesprochene Defizit abzumildern, ist das Anliegen der ersten beiden Beiträge. Während Carmen Unterholzer und Herbert Gröger in gewohnt ressourcenorientierter Herangehensweise auf die reichhaltige Praxiskompetenz von Systemiker:innen in der Arbeit mit Gruppen verweisen und „die Lücke“ eher in der fehlenden theoretischen Beschreibung verorten („viel Praxis, wenig fachlicher Diskurs“), stellt der Artikel von Haja Molter und Christopher Klütmann die gängigen systemischen Theorien in Hinblick auf ihre Praxisrelevanz für die Arbeit mit Gruppen auf den Prüfstand: Woher wissen wir, was wir tun?
Teil 2 skizziert vier Ansätze und Richtungen systemischer Gruppenpsychotherapie: hypnosystemisch, narrativ, lösungsorientiert, gruppendynamisch. Zunächst kommt Gunther Schmidt zu Wort und umreißt die Grundzüge, Prämissen und Interventionen hypnosystemischer Gruppentherapie, wie sie von ihm und seinen Mitarbeiter:innen u.a. in der Klinik sysTelios in Siedelsbrunn praktiziert wird. Gruppen fungieren in diesem Verständnis als „Kompetenztreibhäuser“, die das Erleben von Selbstwirksamkeit fördern. Die Teilnehmer:innen übernehmen füreinander therapeutische Funktionen, die Gruppenleitung sorgt für ausreichende „Produktinformation“ und lädt zur Einnahme einer Metaposition ein.
Den narrativen Zugang zur systemischen Gruppentherapie skizziert Axel Gerland aus Hannover unter der programmatischen Überschrift „Daraus werden Geschichten“. Unter Verweis auf Foucault, Lyotard, Wittgenstein und Kenneth Gergen wird hier die Gruppe als dialogisches System definiert, das die Entfaltung von Vielstimmigkeit fördert. Die Gesprächsmoderation erfolgt aus einer Haltung des „Nichtwissens“, der Genderorientierung, der Mehrparteilichkeit; eine demokratische Gesprächskultur, die Ambivalenzen zulässt und die Weisheit der Gruppe reflektiert.
Im Artikel über lösungsorientierte Gruppenpsychotherapie stellt Cornelia Hennecke aus Weinheim zunächst die interessante Frage, ob und wie Therapeut:innen Freude an der oft recht anstrengenden und fordernden Arbeit mit Gruppen finden können: Warum tut man sich das an? Die Antwort findet sie kurz und pragmatisch in nützlichen systemisch-lösungsorientierten Haltungen: Wertschätzung der Eigenstruktur der Gruppenmitglieder, die Kunst der Unterschiedsbildung, respektvolle Respektlosigkeit und andere Leitsätze (die in einem „Spickzettel“ zusammengefasst werden), lassen das Gruppengeschehen zu einem „inspirierenden Wir“ werden, das auch das Herz der Gruppenleiter*in erfreut.
Einen ganz anderen, historischen Zugang wählt Corina Ahlers in ihrer Gegenüberstellung von gruppendynamischer und systemischer Gruppentherapie. Sie zeichnet eine Linie von frühen Gruppenkonzepten (Kurt Lewin, Jakob Moreno, Wilfried Bion, Virginia Satir) bis hin zur antipsychiatrischen Bewegung Franco Basaglias und der „Wiener gruppendynamischen Schule“ von Raoul Schindler. Einer mit Anekdoten angereicherten Darstellung ihrer eigenen gruppendynamischen Ausbildung im Wien der späten 70er-Jahre und der damals populären „T-Gruppen“ (samt manchen Nebenwirkungen) folgt die Zäsur der konstruktivistischen Wende und ihrer einschneidenden Folgen für das neuere systemische Verständnis, das die objektive Beobachtbarkeit von Gruppenprozessen in Frage stellt.
Im bunt gemischten dritten Teil wird eine breite Palette von Methoden, Interventionsformen und Anwendungsfeldern (z. B. Körper-, Musik-, Kunsttherapie, Schreibgruppen) vorgestellt, deren Zusammenfassung unter dem Begriff „Methoden“ mich zunächst ein wenig verwirrt hat. Dieser Überschrift voll und ganz gerecht wird zunächst Gunther Schmidt mit seinem zweiten Beitrag in diesem Buch. In seiner vertieften Darstellung hypnosystemischer Techniken wird man als Praktiker:in auf der Suche nach nützlichen Interventionsformen in Gruppenprozessen viel Bekanntes (Blitzlichtrunden), viel Bewährtes (positives Spekulieren), viel Raffiniertes (Hilfen für die bewusste Rekonstruktion von Problemtrance), und viel typisch Hypnosystemisches à la Gunter Schmidt (Problemlösungsgymnastik) finden.
Die nächsten beiden Beiträge – von Annika Jaffé über Musiktherapie („Unerhörtes hörbar machen“) und von Michael Krämer und Alexander Herr über Körpertherapie („Ohne Körper und Berührung geht es nicht“) – stammen ebenfalls von Mitarbeiter:innen der sysTelios-Klinik und folgen hypnosystemischen Leitideen: Das Medium Musik bzw. der Körper wird als Kooperationspartner genutzt, der wichtige Hinweise auf verborgene Ressourcen, Potentiale, Veränderungswünsche und Bedürfnisse gibt.
„Ausdruck erzeugt Eindruck“ – so überschreibt Alexandra Mesensky, Kunst- und Psychotherapeutin in Wien, ihren Aufsatz, der in der Leserin anschauliche Bilder davon entstehen lässt, wie in den von ihr angebotenen kunsttherapeutischen Gruppen mit Papier, Pinsel, Farben und Händen kreativ gewerkt wird. Die Deutung der Bilder bleibt der gestaltenden Person überlassen, Zugänge zur inneren Welt und die dort auffindbaren Ressourcen werden im Austausch mit den anderen Gruppenteilnehmer:innen erkundet.
Zwei Expertinnen in der Kunst, Sprachlosigkeit überwinden zu helfen, kommen in den nächsten beiden Kapiteln zu Wort, die gruppentherapeutischen Methoden rund um das Schreiben gewidmet sind. Petra Rechenberger-Winter aus Hamburg lässt uns in ihre Schreibgruppen hineinschnuppern und „Verblüffung und Erstaunen“ durch die sich dabei neu eröffnenden Perspektiven miterleben. Carmen Unterholzer, selbst Autorin von mehreren Publikationen zum Thema „therapeutisches Schreiben“ (Unterholzer 2017, 2021) schaut bekannten narrativ arbeitenden systemischen Therapeut:innen über die Schulter, wie sie im Kontext therapeutischer (Groß)gruppen arbeiten. Wir erfahren, wie die ursprünglich für ein Einzelsetting konzipierten Methoden wie Re-telling, Re-membering und Erzählungen rund um den „Tree of Life“ sich durch die Zeug:innenschaft und die Reflexion der anderen Teilnehmenden noch mehr verdichten lassen.
Historisch verortet und an Hand eines eindrucksvollen Fallbeispiels illustriert, werfen wir dann einen Blick zurück (und auch nach vorn) auf das altehrwürdige Instrument der Familienrekonstruktion, ohne dessen Einsatz in den 70er-Jahre keine familientherapeutische Ausbildung denkbar war. Wie Familienrekonstruktionen auch weiterhin sinnvoll eingesetzt werden können, vermittelt uns Ilke Crone aus Osnabrück in ihrem Beitrag: Familienrekonstruktion als gruppentherapeutisches Format.
Und schließlich bekommen wir noch Einblicke in die Herausforderungen, in die Rahmenbedingungen, den mehrphasigen Ablauf und in die gelebte Praxis der Multifamilientherapie, wie sie etwa von Katja Scholz und ihren Kolleg:innen in einer Familientagesklinik in Dresden angeboten wird.
Wir haben uns damit bis zum Teil 4 vorgearbeitet, der den „klassischen“ Zielgruppen systemischer Gruppentherapie (Kinder, Jugendliche, Angehörige, ältere Menschen) gewidmet ist. Der erste Text gilt Kindern, mit denen uns Manfred Vogt aus Bremen in bester lösungsfokussierter Manier in Kontakt bringt. Im zweiten Beitrag überlegt Björn Enno Hermans aus Essen gemeinsam mit einer Gruppe von Jugendlichen: „Soll ich oder soll ich nicht?“ Er soll, weil er an Hand zahlreicher Fallvignetten aus seiner Arbeit in Schulen und anderen Kontexten anschaulich deutlich macht, worauf im Umgang mit belasteten Jugendlichen aus dieser Altersgruppe besonders zu achten ist, um sie für das uncoole Unterfangen einer Gruppentherapie zu gewinnen (Stichworte sind hier Anvisieren, Anfüttern, Koppeln, Beflügeln, Herauspicken).
Über Besonderheiten der Gruppentherapie mit belasteten Angehörigen referiert Bettina Wilms aus Querfurt/Saalekreis. Besonders interessant fand ich hier ihren Hinweis auf das häufig relativ kleine Zeitfenster, das Betroffene zwischen dem Zeitpunkt des Auftretens der Belastung („ist nicht so schlimm, das schaff ich allein“) und der bereits eingetretenen Überforderung („hab keine Zeit mir Unterstützung zu holen) erleben.
Besonders berührend erlebe ich auch den Text von Herta Schindler aus Kassel, die sich u. a. auf die systemisch-gruppentherapeutische Biografiearbeit mit älteren und sehr alten Menschen spezialisiert hat. „Das Zeitliche segnen“, das Zur-Sprache-Bringen von Jahrhunderten an Lebenserfahrungen geschieht im behütenden Rahmen von Gruppengesprächen, die die Teilnehmenden bei ihrer Erkundungs-Trauer- und Versöhnungsarbeit begleiten.
Die in der systemischen Community wohlbekannte Langzeitkontroverse über den Stellenwert von Diagnosen und störungsspezifischen Interventionen greift der Essay auf, der den fünften Teil des Buches über „Störungsbilder“ eröffnet. Vanja Poncioni-Rusnov, Markus Daimler und Hannah Bischof diskutieren hier am Beispiel einer Wiener Psychotherapie-Ambulanz über das Für und Wider störungsspezifischer Gruppenangebote wie z. B. „Depressionsgruppen“. Das Fazit fällt erwartungsgemäß nicht eindeutig aus, ist aber interessant zu lesen.
Die folgenden Kapitel, die ich hier nicht im Einzelnen referieren kann, seien all jenen wärmstens empfohlen, die sich in einem der hier detailliert beschriebenen Felder bewegen. Im Beitrag von Kornelia Kofler und Ages Burghard-Distl geht es um Gruppentherapie mit sozial ängstlichen Kindern, unter Einbeziehung musiktherapeutischer Methoden. Wer mit Jugendlichen mit Essstörungen zu tun hat, kann sich im Artikel von Dagmar Pauli „Zuerst Familientherapie, dann Gruppentherapie“ Anregungen holen. Die Gruppenarbeit mit drogenabhängigen Menschen („Das Problem als Lösung“) wird von Nina Schöninkle beleuchtet, und Patrick Burkard lässt uns an seinen Erfahrungen mit Gruppen von alkoholsüchtigen Menschen – ein „Experimentierfeld zu autonomem Denken und Handeln“ – teilhaben. Einen ungewöhnlichen, innovativen Zugang zur Erkundung von Geschlechtsidentitäten beschreibt schließlich Esther Strittmatter in ihrem Beitrag über Multifamilientherapie für geschlechtsinkongurenten Kinder, Jugendliche und ihre Familien.
Finale, Teil 6, Forschung: Kirsten von Sydow hat im Rahmen ihrer Recherchen an der Universität Hamburg weltweite Studien (Primär- und Metaanalysen) über die Wirksamkeit von systemischer Gruppentherapie bei unterschiedlichen Störungen und Krankheiten von Erwachsenen und Kindern zusammengetragen und kritisch gesichtet. Erfreuliches, grob vereinfachtes Zwischenergebnis: Meist stellen sich „signifikante positive Effekte“ ein, zumindest bei bestimmten Diagnosegruppen wie z.B. bipolaren Störungen.
Auf die Suche nach Wirkfaktoren machen sich die beiden Herausgeber:innen im letzten Kapitel: was wirkt allgemein, was ganz spezifisch, was erzeugt Unterschiede in der therapeutischen Arbeit mit welchen Gruppen? Besser groß oder klein, besser kurz oder lang, besser geschlossen oder (halb)offen, besser homogen oder bunt gemischt, stationär oder ambulant? Neben diese allgemeinen Faktoren treten die spezifischen Merkmale, die systemische Gruppentherapie von anderen therapeutischen Verfahren unterscheiden: Aspekte wie Kontextualisierung, Perspektivenerweiterung, Stärkung von Autonomie und Selbstwirksamkeit, Lösungsfokussierung, Ressourcenorientierung spielen in der praktischen Tätigkeit eine große Rolle, wobei der Stellenwert dieser einzelnen Merkmale für die Wirksamkeit systemischer Gruppentherapie schwer zu bestimmen ist. Welche Faktoren wirken bei welcher Art von Gruppe wie? Noch interessanter scheint die Frage, wie diese Wirkfaktoren noch erweitert und ergänzt werden können – eine Anregung zu weiterer Entwicklung und Forschung.
Carmen Unterholzer und Herbert Gröger ist herzlich dafür zu danken, dass sie mit diesem Handbuch das bisher unterbelichtete Terrain der systemischen Gruppentherapie ins Scheinwerferlicht rücken. Es fasst die in der einschlägigen Literatur verstreuten theoretischen Fundamente kompakt zusammen und bietet einen guten Überblick über die verschiedenen systemischen Zugänge, wobei die hypnosystemische Ausrichtung als der methodisch am meisten elaborierte Ansatz den größten Raum einnimmt. Beeindruckend ist auch die Vielfalt an Methoden und Anwendungsfeldern, die in den verschiedenen Beiträgen praxisnah und mit vielen Fallbeispielen illustriert werden.
Wer selbst schon viel mit Gruppen gearbeitet hat, wird sich vielleicht bestätigt sehen und dennoch aus der bunten Palette von Beiträgen interessante Anregungen mitnehmen können. Und hoffentlich hilft dieses neue Standardwerk jungen Kolleg:innen dabei, Interesse und Freude an der Praxis und Weiterentwicklung systemischer Gruppenarbeit zu finden, neue Formate zu erproben und erprobte Methoden zu verfeinern.
Literatur
Unterholzer Carmen (2017): Es lohnt sich, einen Stift zu haben. Schreiben in der systemischen Therapie und Beratung. Heidelberg (Carl-Auer)
dies. (2021): Selbstwirksam schreiben. Wege aus der Rat- und Rastlosigkeit. Heidelberg (Carl-Auer)
(mit freundlicher Genehmigung aus systeme 2/2024)

Carmen Unterholzer & Herbert Gröger (Hrsg.)(2022): Handbuch der systemischen Gruppentherapie. Ansätze, Methoden, Zielgruppen, Störungsbilder. Heidelberg (Carl-Auer)
Mit einem Vorwort von Fritz B. Simon
422 Seiten, kart., 12 Abb.
ISBN: 978-3-8497-0437-7
Preis: 59,00 €
Verlagsinformationen:
Trotz ihrer großen Expertise im Hinblick auf Mehrpersonensetting wurde die Arbeit mit Gruppen in der Systemischen Therapie lange Zeit vernachlässigt. Dabei sind Gruppen wahre Treibhäuser für die Entwicklung von Kompetenzen. Dieses Handbuch stellt umfassend die Grundlagen, Methoden und Anwendungsfelder der systemischen Gruppentherapie multiperspektivisch zusammen, d. h. nach Anlässen, Herangehensweisen, Zielgruppen und Settings. Die Beiträge der renommierten Autor:innen zeichnet aus, dass ihre methodischen Überlegungen immer wieder in praktische Beispiele und Beschreibungen konkreter Abläufe münden. Daraus ergibt sich eine Vielzahl an Ideen und Anregungen für die tägliche Arbeit mit Gruppen jeglicher Art.
Mit Beiträgen von: Corina Ahlers • Hannah Bischof • Agnes Burghardt-Distl • Patrick Burkard • Ilke Crone • Markus J. Daimel • Axel Gerland • Herbert Gröger • Cornelia Hennecke • Björn Enno Hermans • Alexander Herr • Anika Jaffé • Christopher Klütmann • Kornelia Kofler • Michael Krämer • Alexandra Mesensky • Haja Molter • Dagmar Pauli • Vanja Poncioni-Rusnov • Petra Rechenberg-Winter • Herta Schindler • Gunther Schmidt • Katja Scholz • Nina Schöninkle • Esther Strittmatter • Kirsten von Sydow • Carmen C. Unterholzer • Manfred Vogt • Bettina Wilms.
Über die Herausgeber:
Carmen C. Unterholzer, Dr. phil, Psychotherapeutin, systemische Einzel-, Paar- und Familientherapie am Institut für Systemische Therapie, Wien; Lehrtherapeutin für systemische Familientherapie in der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für systemische Studien und Forschung, Wien (ÖAS); Weiterbildung in Poesie- und Bibliotherapie (Fritz-Perls-Institut, Düsseldorf) und Hypnotherapie (nach Milton H. Erickson); Lehrtätigkeit an den Universitäten Innsbruck und Klagenfurt; Leiterin von Seminaren, Coaching- und Supervisionstätigkeit im Bildungs- und Sozialbereich. Arbeitsschwerpunkte: therapeutisches Schreiben und andere kreative Methoden in der systemischen Psychotherapie, systemische Gruppenpsychotherapie, Essstörungen, Depression, Burnout, Borderline-Persönlichkeitsstörung, Achtsamkeit, Schreibcoaching. Autorin zahlreicher Fachartikel, weitere Publikationen.
Herbert Gröger, Dr. phil.; Psychotherapeut (systemische Einzel-, Paar-, Familien- und Gruppenpsychotherapie), Supervisor (ÖVS, ÖBVP, ÖAS) und Coach am Institut für Systemische Therapie (IST, Wien), Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeut (VPA, ÖAS), Lehrbeauftragter für Einzellehrselbsterfahrung in systemischer Familientherapie der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für systemische Therapie und systemische Studien (ÖAS, Wien) an der Sigmund Freud Privatuniversität (SFU, Wien), langjährige Lehrtätigkeit an Fachhochschulen und Gesundheits- und Krankenpflegeschulen, Kommunikationstrainer und Organisationsberater (Themen u. a. Konfliktmanagement, Kommunikation, Teamentwicklung, Führungskompetenzen, Entscheidungsfindung, Selbst- und Zeitmanagement, Burnout-Prävention.