Jürgen Hargens, Meyn: So kann’s gehen ..
Der Frühling kündigte sich an – mit zunehmender Wärme und Sonne. Blauer Himmel, Windstille, klare Luft. Da konnte ich endlich wieder aufblühen. Die mich manchmal belastende Bleischwere der dunklen Jahreszeit, dieses Gefühl der Kälte, der scheinbar endlosen Dunkelheit und des nie enden wollenden Zwielichts schienen sich aufzulösen, gewissermaßen mit der wärmenden Sonne in die Luft zu verschwinden.
Mit dieser inneren Freude und Begeisterung setzte neben dem Lächeln auch eine andere Art meines Nachdenkens ein, wohlwollender, gelassener, positiver. Anders gesagt: frühlingsangemessen.
Wenn ich daran dachte, wie es mir noch vor ein paar Tagen gegangen war, konnte ich nur noch den Kopf schütteln. Griesgrämig, schwermütig. Ich selber dachte manchmal schon, ich hätte eine Depression. Klar, nur eine leichte. Allerhöchstens eine mittelschwere. Eben eine, die mit der wärmenden, erhellenden Sonne wieder verschwand.
Gibt es Zufälle? Keine Ahnung. Ist auch nicht wichtig.
Ich las gerade das Buch von Allen Frances, in dem er sich vehement gegen die Inflation psychiatrischer Diagnosen aussprach. Sein kleines Beispiel einer Party, auf der er mit Freunden dahin driftete, plauderte, vom Büffet naschte, sich nicht mehr der Namen aller dort auftauchenden Bekannten erinnerte – all das hätte ihm nach neuester Diagnostik rasch vier oder mehr Störungen von Krankheitswert beschert.
Ich legte sein Buch aus der Hand und dachte nach – über Diagnosen. Und darüber, was sie bewirken könnten. Je länger ich vor mich hin sinnierte, umso unwohler fühlte ich mich.
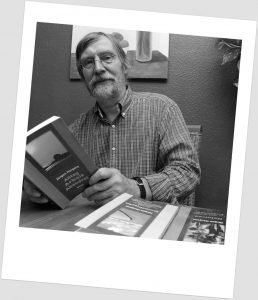
Jürgen Hargens
Wenn ich, was ich gelegentlich mache, wenn meine Hausmittel nicht mehr helfen, zum Doktor gehe, zum Hausarzt, dann erzähle ich ihm, woran ich meine Beschwerden festmache. Er hört zu, fragt nach, macht ein paar medizinische Untersuchungen, verkündet mir dann seine Diagnose und schlägt vor, was ich tun soll oder muss. Dann weiß ich, was ich habe, und das ist tatsächlich so. Ich habe einen Schnupfen, eine Magenverstimmung, was auch immer.
Wenn ich dann an einen meiner Kumpel denke, der wegen seiner Niedergeschlagenheit im Winter von seinem Arzt zum Psychotherapeuten überwiesen wurde, dann schaudert’s mich. Er wurde überwiesen wegen einer „Depression, mittelschwer“ und nicht, weil er sich einfach mies fühlte. Es musste schon eine „richtige“ Diagnose sein, was immer das bedeuten mochte, sonst würde die Kasse nicht zahlen. Auf jeden Fall hatte er entsprechend krank zu sein. Also hatte er seine Diagnose bekommen – Depression. Doch das war dann – leider – nur der Anfang.
Als er mir von seinem Besuch beim Psychotherapeuten erzählte – heißt das Besuch oder müsste ich einen handfesteren Ausdruck wählen? Ich weiß es nicht -, sprach er nicht mehr davon, dass er eine „Depression, mittelschwer“ hatte. Nein, er sagte wörtlich: ich bin depressiv.
Er hatte nicht nur etwas, er war auch etwas geworden, etwas Anderes, Neues, das ihm anhing und nie wieder loslassen würde. Dabei hatte er, jedenfalls so wie ich meinen Kumpel kenne, noch viel mehr und anderes – durchaus sehr Positives. Handwerkliches Können, zwei tolle Kinder, eine, wie ich finde, liebevolle Frau. Ich höre einfach mal auf.
Je länger ich darüber nachdachte, desto nachdenklicher wurde ich. Wieso, fragte ich mich, bekommt man beim Arzt eine Diagnose und hat sie dann neben all dem anderen, was man noch so hat. Beim Psychotherapeuten aber scheint man nicht nur eine Diagnose zu bekommen, sondern ist sie dann auch. Und da kommt man dann nur noch schwer raus. Vor allem, weil alle Welt erwartet, dass man sich auch so verhält. Depressiv und gut gelaunt, lachend – das geht nun einmal einfach nicht.
„Ich bin depressiv“ – einerseits kann es befreiend sein, einen Begriff dafür zu haben, was man „hat“, andererseits aber scheint es so, als verschwinde man dahinter und wird eben genau diese Diagnose, die das eigene Leben von da an überschattet. Erst bekommst du die Diagnose Depression, dann hast du eine Depression und dann bist du depressiv.
Bei einem Schnupfen, einer Erkältung ist das doch offenbar ganz anders. Erst bekommst du die Diagnose Schnupfen, dann hast du einen Schnupfen und das war es dann. Du wirst nie „schnupfig“. Höchstens verschnupft, aber das meint dann etwas ganz anderes.
Ja, und dann fiel mir noch etwas anderes ein, was irgendwie auch dazugehört, denke ich.
Ich war gelegentlich, das sagte ich schon, bei meinem Hausarzt und dort traf ich im Laufe der Zeit immer wieder dieselben Menschen und oft mit deutlich immer denselben Leiden. Wunderte mich nicht, denn auch mir ging es ähnlich. Nur über eines war ich mir ganz sicher. Wenn ich später, nachdem meine Krankheit über lange Zeit verschwunden war, wegen derselben Geschichte wieder in der Praxis auftauchte, war es nie dieselbe Krankheit. Ich war ja gesund, geheilt worden. Es war eine neue Krankheit. So etwas passiert eben.
Dann habe ich mich in meinem Bekanntenkreis umgehört. Da waren schon etliche beim Psycho gewesen. Manche schon jahrelang. Allerdings mit Pausen zwischendrin, wo sich ihr Leiden nicht zeigte. Wenn es sich dann wieder zeigte, waren sie sehr niedergeschlagen, weil sie eben nicht gesund oder geheilt gewesen waren. Hier scheint die Idee zu herrschen, dass nach einer Behandlung diese Krankheit – zutreffender wäre wohl zu sagen: diese Diagnose – nie mehr vorkommen dürfte.
Ich schüttelte den Kopf. Jetzt wunderte mich nicht mehr, dass psychotherapeutische Behandlungen lange dauern mussten, manchmal sogar das ganze Leben. Nur dann, wenn der Psycho Urlaub machte, dann kam der Leidende auch ohne ihn zurecht. Doch das war offenbar nie Thema der Therapie. Schade, denn Leute können doch so viele tolle andere Sachen.
Mir schwirrt seitdem der Kopf. Dieser kleine Unterschied zwischen „haben“ und „sein“. Was ich habe, sagt nicht unbedingt etwas darüber aus, was ich bin. Umgekehrt gilt es auch: was ich bin, sagt nicht unbedingt etwas darüber aus, was ich habe.
All dies habe ich vor knapp drei Wochen aufgeschrieben. Und jetzt, das kann ich mit Fug und Recht sagen, schwirrt mir der Kopf nicht mehr. Dazu hat sicher auch die Sonne beigetragen wie auch genau dieser Unterschied: Ich habe etwas – ich bin etwas. Und ich vertraue zunehmend darauf, dass ich das selber für mich entscheide: bin ich depressiv oder habe ich eine Depression. Will ich Hilfe und Unterstützung haben oder bin ich jemand, der das alles selbst in die Hand nimmt? Da gibt es für mich jetzt zwei Wunder- oder Zauberworte: zutrauen und respektieren.


[…] und schließt vielleicht ein wenig an die Diskussion zum Beitrag von Jürgen Hargens an, der am 21.3. im systemagazin […]
Lieber Jürgen Hargens, lieber Wolfgang – das ist eine bekannte Debatte (mit bekannten Mitspielern, ich spiele ja auch zuverlässig mit).
Mir kommt als erstes in den Sinn: was würde wohl die Witwe Enke dazu sagen? „War“ ihr Mann depressiv oder „hatte“ er eine Depression? Welche Rolle – jenseits von Epistemologie – spielt das? Als zweites kommt mir: wer als Psychotherapeut eine mittelgradige Depression nicht von einem kurzfristigen „sich mies fühlen“ unterscheiden kann, macht etwas falsch.
Und als drittes, sollten sich Diagnosekritiker mE die Feefrage stellen: Angenommen, die systemische Fee würde zaubern und es gäbe keine Psychodiagnosen mehr – dann gäbe es auch keine kassenfinanzierten Therapien mehr und Menschen, die an seelischen Krankheiten leiden, bekämen Tabletten, kalte Wassergüsse und alle 4 Wochen eineinhalb Minuten Gespräch beim Hausarzt. Es gäbe auch keine Diskurse mehr darüber, welche individuellen und gesellschaftlichen Bedingungen zu „Depression“ führen, da ja dann jede(r) was ganz eigenes „hat“, das nicht mit anderem vergleichbar ist. „Bei allem was du tust (und denkst) – bedenke das Ende“ – wir bleiben im Gespräch, da bin ich zuversichtlich, denn diese Debatte ist noch lange nicht zu Ende.
Ich gönne mir übrigens gerade eine kleine Auszeit auf den Kanaren – um erlebe dies als ein wunderbares Antidepressivum – muchos saludos!
Lieber Lothar,
Du hast recht, dass dieses Thema seine Debatte schon lange nährt, und das ist ja auch etwas Gutes. Selbst wenn sie manchmal erscheint, als wende sie dasselbe Argument ein weiteres mal um, so mag doch auf diese Weise die Möglichkeit lebendig bleiben, miteinander weiterzukommen.
Zum Thema hier: Ob es für jemanden einen bedeutsamen (hilfreichen) Unterschied macht, ob er/sie eine Depression „hat“ oder depressiv „ist“, dürfte von verschiedenen Aspekten abhängig sein – und nicht immer den gleichen. Für mich, mein Verständnis von unserer Arbeit als Gratwanderung zwischen „drinnen“ und „draußen“, ist die „ist/haben“-Zuschreibung ein Thema für das „draußen“: Theorie, Selbstvergewisserung, fachlicher Diskurs, etc. Im „drinnen“ des unmittelbaren Kontakts mit den Hilfesuchenden spielt das nur dann eine Rolle, wenn – aus welchen Gründen auch immer – etwas für die Hilfesuchenden selbst dran hängt. Wenn sich daran für sie selbst als wichtig erachtete Folgeunterscheidungen ableiten. Dann sollte ich der „ist/hat“-Frage nicht ausweichen, sondern auch darüber im Gespräch bleiben können mit den Hilfesuchenden. Für das „drinnen“ spielt es aus meiner Sicht keine weitere Rolle. Da ist es tatsächlich wichtiger, miteinander ein klares Gespür dafür zu bekommen, ob sich da etwas überdauernd breit gemacht hat, was grundlegend daran hindert, sich den notwendigen Lebensaufgaben mit ausreichend Selbstvertrauen, Zuversicht und Können zuzuwenden. Ob es also ausreicht, „Mut zu machen“ oder ob es zum Wenden der Not eine umfassendere Unterstützung braucht.
Du merkst, dass ich versuche, in einer Sprache zu bleiben, die nicht festlegt oder objektiviert und dennoch der Schärfe der Frage nicht ausweicht. Das wäre für mich ein Kennzeichen der Art von unserer Arbeit, die mir vorschwebt. Ich bewege mich damit vermutlich außerhalb des Phänomenbereichs, den Du mit der Feefrage ins Spiel bringst, also außerhalb der Spielregeln kassenfinanzierter Psychotherapie. Insofern habe ich gut reden… Was nicht bedeutet, dass ich mir keine Gedanken machen würde, ob ich mit meiner Denke und Handlungsvorliebe denen gerecht werde, die sich an mich wenden. Das ist, neben aller Notwendigkeit handwerklichen Könnens, auch immer eine existenzielle Frage. Das setze ich also voraus.
Bei Deiner Folgerung aus der angenommenen systemischen Feenkunst bin ich etwas ambivalent. Zum einen teile ich Deine Einstellung gegenüber den implizierten Äußerungsformen einer unempathischen, „nicht-hörenden“ Behandlung, sowie die Befürwortung weitgehender Diskurse über Bedingungen erlebten Leides. Ich stolpere nur über die Implikation: wenn es keine Psychodiagnosen mehr gäbe, gäbe es dann noch „seelische Krankheiten“? Hier zeigt sich m.E. der frustrierende Teil der langen Debatte zum Thema: Wieso sollte das angemessene Umgehen mit Menschen, die sich als langanhaltend und erheblich leidend beschreiben, von Diagnosen abhängen? Um einem möglichen Missverständnis vorzubeugen: ich unterscheide hier klar zwischen seelischem Leiden und körperlichen Verletzungen, Gebrechen, Erkrankungen. Da lassen sich sehr oft klare Beschreibungen von Erkanntem anfertigen, die man aus praktisch-pragmatischen Gründen als „Ursachen“ annehmen kann, vermutlich verkürzend, doch praktisch brauchbar für den erwünschten Effekt. Dass das selbst im eigentlich „klaren“ Fall chirurgischer Aufgaben nicht immer so klar und eindeutig ist, zeigen die Schriften von Bernd Hontschik (B. Hontschik & Th.v. Uexküll (1999) Psychosomatik in der Chirurgie; B. Hontschik (2006) Körper, Seele, Mensch). Zurück zum Leiden am Erleben von sich in der Welt: Als Themen im Gespräch können Diagnosen hilfreich sein unter Umständen, doch wenn sie zum Leitkriterium des Gesprächs werden sollen, können sie unter Umständen den Kontakt entwerten. Und zu den Umständen, unter denen das der Fall ist, zähle ich die Unterwerfung des nach hilfreichen Wendungen suchenden Gesprächs unter hierarchische Rahmenbedingungen. Wie gesagt, das ist für mich der frustrierende Teil der Debatte. Mit Menschen wie Dir darüber inhaltlich zu streiten („Streiten verbindet!“) gehört nicht zum frustrierenden Teil. Da setze ich immer noch und weiterhin darauf, dass im wohlwollenden gemeinsamen Ringen um menschenfreundliche Bedeutungen der Faden stark genug ist. Und sich daraus zu einer Zeit vielleicht „neue“, zumindest aber brauchbare Ideen entwickeln.
Hab eine gute Zeit auf den Kanaren! Und sei herzlich gegrüßt von
Wolfgang
Lieber Wolfgang,
danke für Deine ausführliche Antwort!
Es geht in dem Themenkreis um sehr viele Aspekte, die man hier gar nicht alle erörtern kann. Aus meiner Perspektive (wohlwissend, daß ich in diesem Kontext eine Randposition einnehme), geht es um ein Verständnis von Therapie und Diagnostik. Da gibt es alte systemische Zöpfe, die mir seit 30 Jahren begegnen, Mythos: Therapien müssen kurz sein. Dachte ich auch mal. Ganz am Anfang meiner Kassenzulassung. Dann haben mich einige Patienten von dieser Einstellung kuriert. Die Patienten sagen einem schon wenns reicht. Mythos: seelische und körperliche Krankheiten sind nicht vergleichbar. Achtung: materialistischer Reduktionismus! Demzufolge zählt nur, was man sehen, anfassen, riechen etc. kann. Dann wäre das Seelische exkommuniziert.
Mythos: seelische Störungen sind stets leicht, fluid und durch „Zurechtrücken“ der Perspektive zu beheben. Der Bekannte von Jürgen Hargens ist doch handwerklich so geschickt, hat eine glückliche Familie, warum sieht er das nicht? Ganz einfach: in der Depression ist eben das genau das Muster, daß alles nicht mehr zählt. Das kann ich dem Patienten nicht ausreden (wenn ich es könnte, täte ich es, aber es ist halt so eine Sache mit der instruktiven Interaktion …).
Würde man bei einem Koronarpatienten, jemandem, dem beide Nieren fehlen, jemandem, der Krebs hat, auch sagen: naja, nach ein paar Besuchen beim Arzt muß jetzt aber genug sein? Nein, man würde nicht. Es wäre unverantwortlich. Und es gibt reichlich seelische Notlagen, die sind wie Herzinfarkt oder Krebs. Das muß man als verantwortlicher Therapeut wissen und sehen. Ich kann mit einer schwer traumarisierten Person keine Kurzzeittherapie machen, das geht fachlich einfach nicht! Und woher weiß Jürgen Hargens, dass dies bei der einen oder anderen Person, die zum „Psycho“ (!) geht, nicht der Fall ist. Sowas ist kein Thema beim Gespräch übern Gartenzaun oder beim Bier!
Systemiker verstehen, das ist meine Sichtweise, einfach nicht, was Diagnostik ist, bzw. was sie sein könnte. Sie denken immer, Diagnose sind Etiketten, die man anderen zu Unrecht aufpappt. Diagnostik ist jedoch was völlig anderes als einen ICD Code zu bestimmen. Es ist, mit Pat. gemeinsam, herauszufinden, WAS eigentlich der Fall ist. Es nutzt dem Pat. nichts, wenn ICH glaube zu wissen, was mit ihm/ihr ist. ER muß sich verstehen, seine Muster und lernen, sich anders, besser zu regulieren. Und diese Muster sind eben nicht je individuell, sie sind vergleichbar, obwohl jeder Mensch anders ist. Von diesem Denken hat die deutschsprachige systemische Szene sich seit den 80er Jahren verabschiedet und sie verliert dadurch etwas.
Draußen bewegt sich eine Bananenstaude im Wind, weiter hinten ist die Bergkette der Caldera de Taburiente zu sehen und wenn ich nach links schaue, sehe ich den blauen Atlantik. Die wollen jetzt meine Aufmerksamkeit.
Lass(t) uns im Gespräch bleiben. Sehr herzliche Grüße, Lothar
Sehr geehrter Herr Eder,
zu eins: Dieses Gedankenspiel – öffentlich – finde ich grenzwertig, ja übergriffig!
Zweitens: Natürlich!
Drittens: Da würden wir andere Wegen gehen dürfen. Hier bleiben Sie im Althergebrachten! Im Entweder oder. Wir müssten anders denken, andere konkrete Lösungen suchen, wenn Menschen leiden!!!!
Viertens: JA! GENIEßEN Sie; alleine die Erwähnung. Sie freut!
Warum „müssen“ „wir“ „andere Wege“ finden? – Und was meinen Sie mit „althergebracht“, bezieht sich Ihre Einschätzung auf Psychotherapie? Und was meinen Sie mit „entweder-oder“? Und inwiefern müssen „wir“ „anders denken“, welche „anderen Lösungen“ finden? Wie kommen sie auf die Idee, dass die in der Psychotherapie aktuell praktizierten verändert werden müssen? Ich sehe das nach mehr als 3 Jahrzehnten Arbeit in diesem Beruf ein wenig anders.
Wenn man der Auffassung ist, dass die psychotherapeutische Versorgung und Ihre Wirkungen, so wie sie sind, in Ordnung ist, verstehe ich Ihre Argumentationen sofort – und dass alle Ideen – etwa die Infragestellung eines Krankheitsmodellen bzw. schon allein die Frage nach Notwendigkeit von Diagnosen – nicht notwendigerweise, doch durchaus eine Veränderung implizieren und damit abzulehnen sind.
Ich schildere Ihnen nur kurz, als Beispiel, was mich schmerzlich bewegte, als ich in einem psychiatrischen Umfeld arbeitete und auch erlebte, was geschieht, wenn Menschen, psychotisch, stationär-psychiatrisch behandelt wurden.
In dieser Zeit stieß ich auf Texte von Aderhold und seine fundierten Reflexionen über Arzneimittelstudien (Neuroleptika). Später schrieb er auch über eine Vorgehensweise, in einem kleinen Verwaltungsbezirk in Finnland, unter dem Stichwort „Offener Dialog“. Wenn Menschen dort in eine extreme Lebenskrise kommen, d.h. z.b. „psychotisch“ werden, „kommt“ die Psychiatrie zu jene, anstatt dass jene in die Psychiatrie kommen. D.h. Innerhalb von 24 h wird ein Zusammenkunft in der Nähe dieses Menschen organisiert, mit all seinen wichtigen Bezugspersonen und es wird gemeinsam beratschlagt, welche konkrete Hilfeunterstützung für ALLE jetzt hilfreich sind. Medikamente werden nur, wenn erwünscht, in Bezug auf unmittelbare Symptome eingesetzt, etwa gegen Angst oder Schlaflosigkeit. Die Ärzte treten hier nicht als Behandler auf, als Krankheitsexperten, sondern Menschen, die einen (kommunikativen) Rahmen schaffen. (Offener Dialog)
Eine der Konsequenzen: Neuroleptika mit ihren verheerenden Nebenwirkungen werden nicht mehr verschrieben. Die Diagnose „Schizophrenie“ gibt es in diesem Verwaltungsbezirk nicht mehr, weil das Kriterium eines 6 monatigen Anhaltens dieser Symptomatik nicht mehr erfüllt wird.
Auch gibt es natürlich – da dieses Modell jetzt schon über Jahre praktiziert wird, (wissenschaftlich begleitet) – auch indirekte Auswirkungen auf das Gemeinwesen.
Welch ein Unterschied!
Sehr geehrter Herr Mall,
Sie machen genau das, was im systemischen Umfeld ein leider systematischer Fehler ist: es werden Kontexte vermischt. Fortwährend, so beobachte ich es, werden psychiatrische und psychotherapeutische Kontexte in der Diskussion miteinander vermischt. Meine Rede bezog sich auf PSYCHOTHERAPIE und NICHT auf PSYCHIATRIE. Dass dort einiges im Argen liegt, darauf könnte man sich wohl rasch einigen. In meiner Supervisionsgruppe erzählte mit ein Kollege, der noch älter ist als ich, daß es in den 70er Jahren selbst in psychosomatischen (nicht: psychiatrischen) Kliniken absolut verpönt war, Pat. mit Psychopharmaka z.B. Antidepressiva zu behandeln. Heute kommen Patienten zu mir, denen hat der Hausarzt bereits Antidepressiva verschrieben!
Psychotherapie ist genuin Entwicklungsarbeit und Potentialentwicklung beim Patienten! Wir haben, bei aller Kritik, weltweit die beste psychotherapeutische Versorgung. Die andere Seite: wir als bindungskorrodierende Leistungsgesellschaft mit zunehmendem Verlust an Sinnhorizonten, „konsumistisch“ kompensierend und das bei diesem oft trüben Wetter (wenn man von den Kanaren zurückkommt, trifft einen ja fast der Schlag), brauchen das ja auch.
Also meine Bitte: differenzieren Sie. Und was es an der (ambulanten) psychotherapeutischen (nicht psychiatrischen) Versorgung zu bemängeln gibt (es gibt immer was zu bemängeln, ich habe an der Rahmenbedingungen durch den Gesetzgeber bzw. die KV einiges auszusetzen, z.B. die leidlichen Gutachterverfahren), würde mich ernsthaft interessieren,
kanarische Grüße, LE
Tja, Jürgen, da warb schon 1955 der „Werbeverbund Pfandbriefe“ mit dem Slogan: „Hast Du was – bist Du was!“…
Man kann eben nicht nur lechts und rinks verwechsern, sondern auch Pfandbriefe und Bepfinden.
Bleiben wir dran!