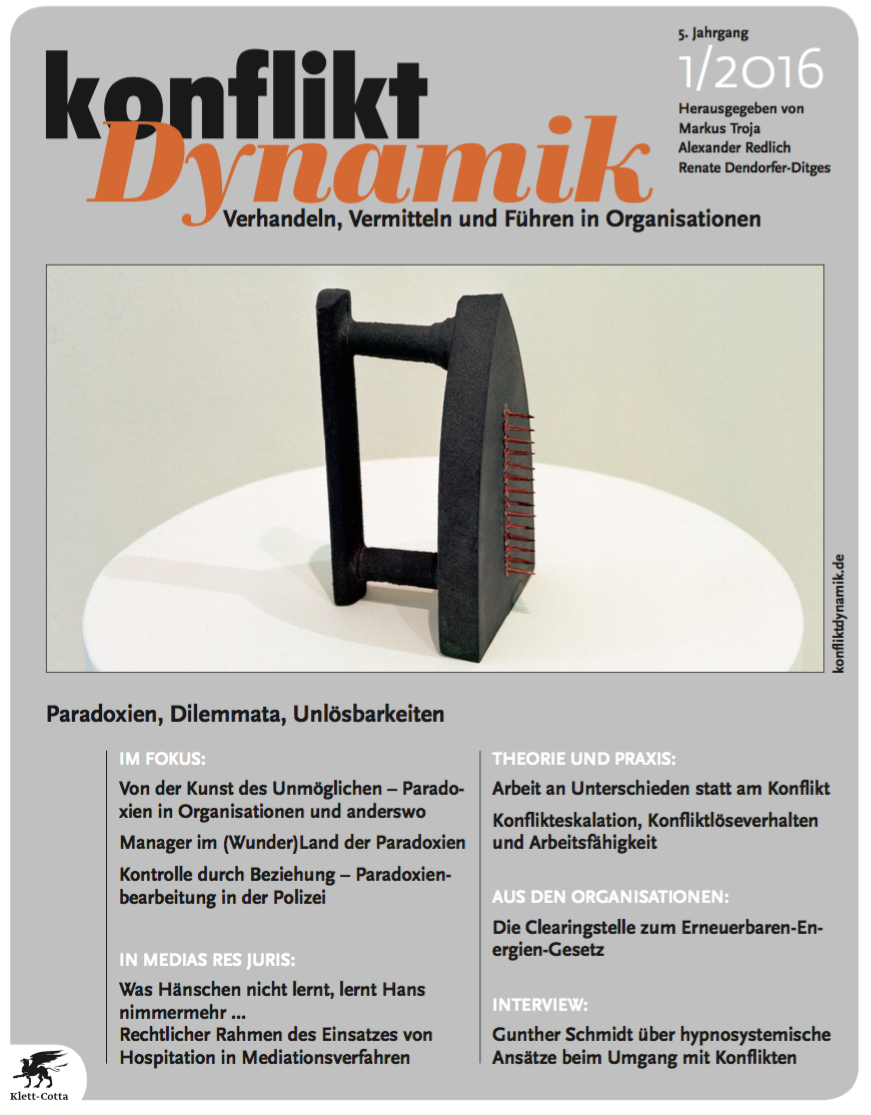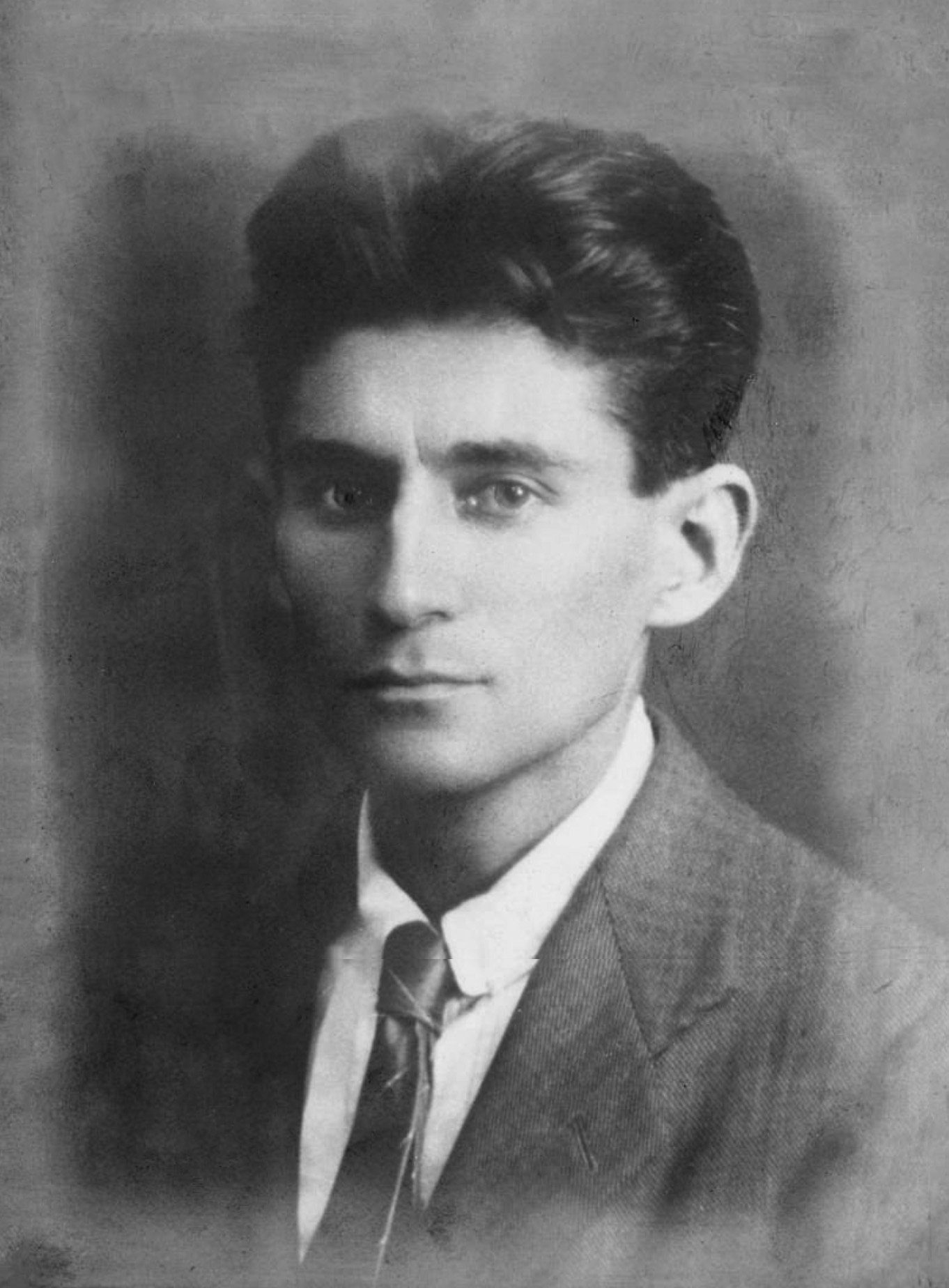H.-G. Pott
Hans-Georg Pott (Foto: www.germanistik.hhu.de) ist emeritierter Professor für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft und hatte einen Lehrstuhl an der Universität Düsseldorf inne. Für einen von Paul Geyer und Claudia Jühnke herausgegebenen Sammelband „Von Rousseau zum Hypertext“, der 2001 im Würzburger Verlag Königshausen & Neumann erschienen ist, hat er ein Kapitel zum Thema „Das Subjekt bei Niklas Luhmann“ beigesteuert, dessen Manuskript auch online zu lesen ist. Am Ende des Kapitels resümiert Pott: „Luhmann nimmt (…) nicht Abschied von der Idee selbstbestimmter Selbsttätigkeit. Ich halte Luhmanns Theorie für kompatibel mit einer materialen Hermeneutik sinnhaften Verstehens, bereichert um illusions- und ideologiekritische Aufklärung, insbesondere was den Standpunkt des Beobachters angeht. Das würde bedeuten (was ich hier nur skizzieren kann): Die Unterscheidung System/Umwelt beerbt die Unterscheidung Subjekt/Objekt. Sie ist sozusagen umweltfreundlicher. Der einzelne Mensch nimmt an den APS [autopoietischen Systemen; Tom Levold] nur vorübergehend und partiell teil, wobei er seine (selbstbestimmte) Einheit gerade deshalb behält, weil er von keinem System ganz verschluckt werden kann. (Hier ist auf den Grenzfall von totalitären Systemen und die Funktion der Folter zu verweisen; …) Wollte man den Menschen als System beobachten, so wäre er wohl als Trinitätssystem von biologischem, psychischem und sozialem Teilsystem zu konstruieren, deren strukturelle Kopplungen zu beschreiben wären. Vielleicht liegt das ja auch der Idee der heiligen Dreifaltigkeit zugrunde.“



 Hand aufs Herz: Letztlich geht es uns durchschnittlich karitativen, wohltätigen, humanitären Menschen bei unseren Ambitionen, d.h. erklärten Absichten zumindest teilweise um unseren Ehrgeiz, die andere Bedeutung von Ambition. Als ich mich 1970 als junger Mediziner von der staatlichen westdeutschen Entwicklungshilfe-Organisation, die damals noch in Klammern die Bezeichnung GAWI (Gesellschaft zur Abwicklung Wirtschaftlicher Interessen) trug, in ein westafrikanisches Land hatte entsenden lassen, geschah das in der Absicht, eine ehrenwerte Arbeit als Entwicklungs-Helfer zu leisten. Ich selbst war völlig unzureichend ausgebildet, kaum auf Afrika vorbereitet, sprach weder Wolof, noch Fulbe. Sondern nur die Sprache der (Neo-) Kolonisatoren, Französisch.
Hand aufs Herz: Letztlich geht es uns durchschnittlich karitativen, wohltätigen, humanitären Menschen bei unseren Ambitionen, d.h. erklärten Absichten zumindest teilweise um unseren Ehrgeiz, die andere Bedeutung von Ambition. Als ich mich 1970 als junger Mediziner von der staatlichen westdeutschen Entwicklungshilfe-Organisation, die damals noch in Klammern die Bezeichnung GAWI (Gesellschaft zur Abwicklung Wirtschaftlicher Interessen) trug, in ein westafrikanisches Land hatte entsenden lassen, geschah das in der Absicht, eine ehrenwerte Arbeit als Entwicklungs-Helfer zu leisten. Ich selbst war völlig unzureichend ausgebildet, kaum auf Afrika vorbereitet, sprach weder Wolof, noch Fulbe. Sondern nur die Sprache der (Neo-) Kolonisatoren, Französisch.