 Unter der Adresse systemischer-diskurs.at existiert seit kurzem eine neue Internet-Adresse für systemisch interessierte Kolleginnen und Kollegen, ins Leben gerufen von Richard L. Fellner aus Wien. Wie der Name sagt, soll die website Gelegenheit für systemische TherapeutInnen, SupervisorInnen und BeraterInnen bieten, miteinander in Austausch zu treten:„Oftmals ergeben sich im Zuge der eigenen Arbeit Fragen, man sucht Material oder Anregungen, oder möchte sich einfach nur mit anderen KollegInnen austauschen oder hören, wie diese an eine bestimmte Situation der täglichen Praxis herangehen würden“. Mit Hilfe einer Forums-Software soll dieser Austausch praktisch ermöglicht werden. Jeder registrierte Nutzer kann eigene Diskussionsthemen ins Forum stellen und kann sich in unterschiedliche Online-Diskussionen einmischen. Soweit die Theorie. Erfahrungsgemäß dauert es aber immer eine gewisse Zeit, bis ein online-Forum ausreichend„kritische“ Masse angehäuft hat, um regelmäßig frequentiert und damit wirklich interessant zu werden. Dem„Systemischen Diskurs“ sei es zu wünschen, auch wenn mit der fest etablierten systemischen Mailing-Liste die Konkurrenz groß ist (die die gleiche Grundidee verfolgt, allerdings nicht über so eine schöne Benutzeroberfläche verfügt, was das Verfolgen der zahlreichen Diskussionen ziemlich erschwert). Es bietet darüber hinaus aktuelle Nachrichten und Newsfeeds, ein Therapeuten- und Coachverzeichnis sind geplant. Die Plattform ist kostenlos und dient ausschließlich dem Ziel, die Vernetzung von Systemikern und an Systemischen Konzepten Interessierten zu fördern.
Unter der Adresse systemischer-diskurs.at existiert seit kurzem eine neue Internet-Adresse für systemisch interessierte Kolleginnen und Kollegen, ins Leben gerufen von Richard L. Fellner aus Wien. Wie der Name sagt, soll die website Gelegenheit für systemische TherapeutInnen, SupervisorInnen und BeraterInnen bieten, miteinander in Austausch zu treten:„Oftmals ergeben sich im Zuge der eigenen Arbeit Fragen, man sucht Material oder Anregungen, oder möchte sich einfach nur mit anderen KollegInnen austauschen oder hören, wie diese an eine bestimmte Situation der täglichen Praxis herangehen würden“. Mit Hilfe einer Forums-Software soll dieser Austausch praktisch ermöglicht werden. Jeder registrierte Nutzer kann eigene Diskussionsthemen ins Forum stellen und kann sich in unterschiedliche Online-Diskussionen einmischen. Soweit die Theorie. Erfahrungsgemäß dauert es aber immer eine gewisse Zeit, bis ein online-Forum ausreichend„kritische“ Masse angehäuft hat, um regelmäßig frequentiert und damit wirklich interessant zu werden. Dem„Systemischen Diskurs“ sei es zu wünschen, auch wenn mit der fest etablierten systemischen Mailing-Liste die Konkurrenz groß ist (die die gleiche Grundidee verfolgt, allerdings nicht über so eine schöne Benutzeroberfläche verfügt, was das Verfolgen der zahlreichen Diskussionen ziemlich erschwert). Es bietet darüber hinaus aktuelle Nachrichten und Newsfeeds, ein Therapeuten- und Coachverzeichnis sind geplant. Die Plattform ist kostenlos und dient ausschließlich dem Ziel, die Vernetzung von Systemikern und an Systemischen Konzepten Interessierten zu fördern.
27. November 2006
von Tom Levold
Keine Kommentare

 Anlässlich der Tatsache, dass in immer mehr Ländern Mediationsgesetze erlassen werden, die auf die gesellschaftliche Etablierung von alternativen Streitschlichtungsmöglichkeiten abzielen, und der Bemühungen der EU um die Schaffung von europäischen Mediationsrichtlininen hat die österreichische systemische Therapeutin und Mediatorin Gerda Mehta einen kurzen Text über Mediation als Lebenshaltung und soziale Einstellung verfasst, der ab heute in der Systemischen Bibliothek zu finden ist.
Anlässlich der Tatsache, dass in immer mehr Ländern Mediationsgesetze erlassen werden, die auf die gesellschaftliche Etablierung von alternativen Streitschlichtungsmöglichkeiten abzielen, und der Bemühungen der EU um die Schaffung von europäischen Mediationsrichtlininen hat die österreichische systemische Therapeutin und Mediatorin Gerda Mehta einen kurzen Text über Mediation als Lebenshaltung und soziale Einstellung verfasst, der ab heute in der Systemischen Bibliothek zu finden ist. Gemeinsam mit ihrem Mann hat Satuila Stierlin in den letzten fünf Jahrzehnten intensiven Kontakt mit FamilientherapeutInnen der ersten Stunde gehabt und aufrechterhalten. In dieser ganzen Zeit war sie, die sich immer gerne (und ohne Not) im Hintergrund gehalten hat, selbst nicht nur als Psychotherapeutin, sondern auch mit großer Leidenschaft als Leiterin zahlreicher Selbsterfahrungsseminare für angehende und erfahrene FamilientherapeutInnen tätig. Diese Leidenschaft bewog sie neben ihrem unmittelbaren persönlichen Zugang, ein Buch über die Familiengeschichten berühmter FamilientherapeutInnen zu schreiben, das 2001 im Carl-Auer-Verlag veröffentlicht wurde und für das die manchmal etwas geschichtsvergessene systemische Szene nur dankbar sein kann. Michael Wirsching schreibt in seiner Rezension:„Ein Buch von unschätzbarem Wert, wie es heute kaum noch einmal geschrieben werden könnte. Satuila Stierlin setzt ihre große Fachkompetenz, ihren historischen Überblick und ihre tiefe Menschlichkeit ein, um dieses einzigartige Dokument der Familientherapie zu schaffen, das allen praktizierenden oder angehenden oder sonst wie an der Familientherapie Interessierten aufs wärmste empfohlen wird“ Dem ist nichts hinzuzufügen.
Gemeinsam mit ihrem Mann hat Satuila Stierlin in den letzten fünf Jahrzehnten intensiven Kontakt mit FamilientherapeutInnen der ersten Stunde gehabt und aufrechterhalten. In dieser ganzen Zeit war sie, die sich immer gerne (und ohne Not) im Hintergrund gehalten hat, selbst nicht nur als Psychotherapeutin, sondern auch mit großer Leidenschaft als Leiterin zahlreicher Selbsterfahrungsseminare für angehende und erfahrene FamilientherapeutInnen tätig. Diese Leidenschaft bewog sie neben ihrem unmittelbaren persönlichen Zugang, ein Buch über die Familiengeschichten berühmter FamilientherapeutInnen zu schreiben, das 2001 im Carl-Auer-Verlag veröffentlicht wurde und für das die manchmal etwas geschichtsvergessene systemische Szene nur dankbar sein kann. Michael Wirsching schreibt in seiner Rezension:„Ein Buch von unschätzbarem Wert, wie es heute kaum noch einmal geschrieben werden könnte. Satuila Stierlin setzt ihre große Fachkompetenz, ihren historischen Überblick und ihre tiefe Menschlichkeit ein, um dieses einzigartige Dokument der Familientherapie zu schaffen, das allen praktizierenden oder angehenden oder sonst wie an der Familientherapie Interessierten aufs wärmste empfohlen wird“ Dem ist nichts hinzuzufügen. Der dritte Beitrag zum systemagazin-Special„Helfen wir unseren Klienten auch beim Widerstand?“ (s. Eintrag vom 23.11.) stammt von Tom Levold, der einige vorläufige Überlegungen für eine Positionsbestimmung von Psychotherapie in der aktuellen gesellschaftlichen und sozialen Umbruchssituation„
Der dritte Beitrag zum systemagazin-Special„Helfen wir unseren Klienten auch beim Widerstand?“ (s. Eintrag vom 23.11.) stammt von Tom Levold, der einige vorläufige Überlegungen für eine Positionsbestimmung von Psychotherapie in der aktuellen gesellschaftlichen und sozialen Umbruchssituation„ Nachdem gestern ein Vortrag von Sabine Klar zum Thema„Helfen wir unseren KlientInnen auch beim Widerstand?“ veröffentlicht wurde, der auf dem ÖAS-Kongress im September in Wien gehalten wurde, können Sie heute die Erwiderung von Kurt Ludewig unter dem Titel:„
Nachdem gestern ein Vortrag von Sabine Klar zum Thema„Helfen wir unseren KlientInnen auch beim Widerstand?“ veröffentlicht wurde, der auf dem ÖAS-Kongress im September in Wien gehalten wurde, können Sie heute die Erwiderung von Kurt Ludewig unter dem Titel:„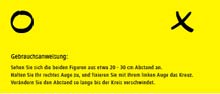 Der Jubiläumskongress des Instituts für Ehe- und Familientherapie (30 Jahre) und der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Systemische Therapie und Systemische Studien (ÖAS, 20 Jahre) am 22. und 23. September 2006 in Wien zum Thema„Blinde Flecken oder Ich sehe nichts, wo Du was siehst“ (Clemens und Danielle Stieger berichteten darüber im systemagazin) bot nicht nur einen interessanten Rückblick auf die vergangenen Jahrzehnte (mit den Vorträgen von Corina Ahlers, Joachim Hinsch und Rosmarie Welter-Enderlin), sondern stellte auch die Frage, inwiefern sich systemische PsychotherapeutInnen in aktuelle gesellschaftspolitische Diskurse einmischen sollen, die nicht selten im blinden Fleck des Nicht-Beobachteten bzw. des Nicht-Beobachten-Wollens verschwindet.
Der Jubiläumskongress des Instituts für Ehe- und Familientherapie (30 Jahre) und der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Systemische Therapie und Systemische Studien (ÖAS, 20 Jahre) am 22. und 23. September 2006 in Wien zum Thema„Blinde Flecken oder Ich sehe nichts, wo Du was siehst“ (Clemens und Danielle Stieger berichteten darüber im systemagazin) bot nicht nur einen interessanten Rückblick auf die vergangenen Jahrzehnte (mit den Vorträgen von Corina Ahlers, Joachim Hinsch und Rosmarie Welter-Enderlin), sondern stellte auch die Frage, inwiefern sich systemische PsychotherapeutInnen in aktuelle gesellschaftspolitische Diskurse einmischen sollen, die nicht selten im blinden Fleck des Nicht-Beobachteten bzw. des Nicht-Beobachten-Wollens verschwindet.  Diese Debatte wurde von Sabine Klar, Lehrtherapeutin der ÖAS, angeregt und durch einen durchaus provokativ gedachten Vortrag angestoßen, der auf dem Kongress von Kurt Ludewig, Marie Luise Conen und Tom Levold kommentiert und beantwortet wurde. In der anschließenden Podiumsdiskussion ergab sich eine angeregte Diskussion mit dem Publikum. Mit freundlicher Genehmigung der ÖAS veröffentlicht systemagazin heute den Text von Sabine Klar mit dem Titel:„
Diese Debatte wurde von Sabine Klar, Lehrtherapeutin der ÖAS, angeregt und durch einen durchaus provokativ gedachten Vortrag angestoßen, der auf dem Kongress von Kurt Ludewig, Marie Luise Conen und Tom Levold kommentiert und beantwortet wurde. In der anschließenden Podiumsdiskussion ergab sich eine angeregte Diskussion mit dem Publikum. Mit freundlicher Genehmigung der ÖAS veröffentlicht systemagazin heute den Text von Sabine Klar mit dem Titel:„ Florence Kaslow ist eine bekannte Persönlichkeit in der US-amerikanischen familientherapeutischen Szene. Der von ihr herausgegebene Sammelband„Handbook of Family Business and FamilyBusiness Consultation“ hat sich zur Aufgabe gestellt, die kulturellen und interkulturellen Besonderheiten der Beratung von Familienunternehmen in den unterschiedlichsten Teilen der Welt zu reflektieren. Diese Thematik ist angesichts der Notwendigkeit auch für Familienunternehmen, sich auf den globalisierten Märkten zu positionieren und u.U. neuen
Florence Kaslow ist eine bekannte Persönlichkeit in der US-amerikanischen familientherapeutischen Szene. Der von ihr herausgegebene Sammelband„Handbook of Family Business and FamilyBusiness Consultation“ hat sich zur Aufgabe gestellt, die kulturellen und interkulturellen Besonderheiten der Beratung von Familienunternehmen in den unterschiedlichsten Teilen der Welt zu reflektieren. Diese Thematik ist angesichts der Notwendigkeit auch für Familienunternehmen, sich auf den globalisierten Märkten zu positionieren und u.U. neuen Am 3.11. wies systemagazin auf eine
Am 3.11. wies systemagazin auf eine  Helga Brüggemann, Kristina Ehret-Ivankovic und Christopher Klütmann versuchen unter Hinzuziehung einer gastronomischen Metapher Systemische Beratung als Menü in fünf Gängen zu kredenzen. Rezensent Dennis Bohlken hat es gemundet:„In hervorragender Weise ist es dem Trio gelungen, systemische Beratung im Profit- und Non-Profit-Bereich kreativ zu gestalten. Sie gehen davon aus, dass die Zutaten (Ressourcen) schon zur Verfügung stehen, um zu entscheiden, was schlussendlich aufgetischt wird bzw. im Vorratsraum bleiben sollte.
Dieses kleine, kompakte und alltagstaugliche Buch empfehle ich besonders denjenigen, die kurz vor oder während einer Beratung anhand eines ,Schlagwortes‘ noch einmal nachschauen wollen. Es ist ein geeignetes Lernbuch. Nicht geeignet ist dieses Buch für diejenigen, die ein Fachbuch oder Lehrbuch zur Systemischen Beratung suchen“
Helga Brüggemann, Kristina Ehret-Ivankovic und Christopher Klütmann versuchen unter Hinzuziehung einer gastronomischen Metapher Systemische Beratung als Menü in fünf Gängen zu kredenzen. Rezensent Dennis Bohlken hat es gemundet:„In hervorragender Weise ist es dem Trio gelungen, systemische Beratung im Profit- und Non-Profit-Bereich kreativ zu gestalten. Sie gehen davon aus, dass die Zutaten (Ressourcen) schon zur Verfügung stehen, um zu entscheiden, was schlussendlich aufgetischt wird bzw. im Vorratsraum bleiben sollte.
Dieses kleine, kompakte und alltagstaugliche Buch empfehle ich besonders denjenigen, die kurz vor oder während einer Beratung anhand eines ,Schlagwortes‘ noch einmal nachschauen wollen. Es ist ein geeignetes Lernbuch. Nicht geeignet ist dieses Buch für diejenigen, die ein Fachbuch oder Lehrbuch zur Systemischen Beratung suchen“
 Betrachtet man die gegenwärtigen (und sicherlich gerechtfertigten) Bemühungen der systemischen Verbände um die sogenannte wissenschaftliche Anerkennung (durch den sogenannten wissenschaftlichen Beirat), die offenbar nicht anders als durch Zusammenstellungen von quantitativen outcome-Studien zu bekommen ist, muss man feststellen, dass die qualitative Forschung in der systemischen Therapie leider immer mehr ins Hintertreffen gerät. Nun ist gegen outcome-Studien nicht viel zu sagen, allerdings zeigt ein genauerer Blick doch auch, wie sehr die dem Design dieser Studien, ihren Fragestellungen und andere dieser Art der Psychotherapieforschung zugrundeliegenden Wirklichkeitskonstruktionen mehr oder weniger unhinterfragt übernommen, jedenfalls nicht mehr systematisch beobachtet werden. Damit geht aber ein zentrales Qualitätsmerkmal systemischer Theorie und Praxis verloren. In der Systemischen Bibliothek finden Sie einen Beitrag von Bruno Hildenbrand aus dem Jahre 1998 (System Familie), der deutlich macht, dass Forschung auch anders gehen kann, ohne des Etiketts„wissenschaftlich“ verlustig zu gehen. Im abstract heißt es:„Die systemische Therapieforschung leidet daran, dass die hier vorherrschende Methodologie weder der systemischen Therapietheorie noch deren Gegenstand, der therapeutischen Situation, gerecht wird. Vorgeschlagen wird die Bevorzugung qualitativer Forschungsverfahren, darunter insbesondere der fallrekonstruktive Ansatz. Dieser bietet eine Anschlussmöglichkeit an die Erfahrungen von Praktikerinnen und Praktikern und leistet so auch einen Beitrag zur Überwindung der Kluft zwischen Forschung und Praxis“
Betrachtet man die gegenwärtigen (und sicherlich gerechtfertigten) Bemühungen der systemischen Verbände um die sogenannte wissenschaftliche Anerkennung (durch den sogenannten wissenschaftlichen Beirat), die offenbar nicht anders als durch Zusammenstellungen von quantitativen outcome-Studien zu bekommen ist, muss man feststellen, dass die qualitative Forschung in der systemischen Therapie leider immer mehr ins Hintertreffen gerät. Nun ist gegen outcome-Studien nicht viel zu sagen, allerdings zeigt ein genauerer Blick doch auch, wie sehr die dem Design dieser Studien, ihren Fragestellungen und andere dieser Art der Psychotherapieforschung zugrundeliegenden Wirklichkeitskonstruktionen mehr oder weniger unhinterfragt übernommen, jedenfalls nicht mehr systematisch beobachtet werden. Damit geht aber ein zentrales Qualitätsmerkmal systemischer Theorie und Praxis verloren. In der Systemischen Bibliothek finden Sie einen Beitrag von Bruno Hildenbrand aus dem Jahre 1998 (System Familie), der deutlich macht, dass Forschung auch anders gehen kann, ohne des Etiketts„wissenschaftlich“ verlustig zu gehen. Im abstract heißt es:„Die systemische Therapieforschung leidet daran, dass die hier vorherrschende Methodologie weder der systemischen Therapietheorie noch deren Gegenstand, der therapeutischen Situation, gerecht wird. Vorgeschlagen wird die Bevorzugung qualitativer Forschungsverfahren, darunter insbesondere der fallrekonstruktive Ansatz. Dieser bietet eine Anschlussmöglichkeit an die Erfahrungen von Praktikerinnen und Praktikern und leistet so auch einen Beitrag zur Überwindung der Kluft zwischen Forschung und Praxis“ Im Wiener Springer-Verlag sind 2000 und 2005 zwei wuchtige Lexika zur Psychotherapie erschienen, zuerst im Jahre 2000 das Wörterbuch der Psychotherapie (854 S.) und 2005 das Personenlexikon der Psychotherapie (547 S.), beide von prominenten Vertretern der verschiedensten Psychotherapieschulen verfasst. Wie die Herausgeber in ihren Vorworten festhalten, ist die Erstellung von Lexika nicht nur eine immense Fleißarbeit, sondern immer auch der Kritik ausgesetzt, da die Auswahl der Beiträge immer hochselektiv ist und sich den jeweiligen persönlichen Präferenzen, den verfügbaren Informationen und der sich wandelnden Einschätzung historischer Bedeutung verdankt.
Im Wiener Springer-Verlag sind 2000 und 2005 zwei wuchtige Lexika zur Psychotherapie erschienen, zuerst im Jahre 2000 das Wörterbuch der Psychotherapie (854 S.) und 2005 das Personenlexikon der Psychotherapie (547 S.), beide von prominenten Vertretern der verschiedensten Psychotherapieschulen verfasst. Wie die Herausgeber in ihren Vorworten festhalten, ist die Erstellung von Lexika nicht nur eine immense Fleißarbeit, sondern immer auch der Kritik ausgesetzt, da die Auswahl der Beiträge immer hochselektiv ist und sich den jeweiligen persönlichen Präferenzen, den verfügbaren Informationen und der sich wandelnden Einschätzung historischer Bedeutung verdankt.  Insofern handelt es sich um eine Auswahl, die grundsätzlich auch hätte anders ausfallen können. Das mindert allerdings in keiner Weise das Vergnügen am Lesen und Schmökern. Johannes Herwig-Lempp schreibt dementsprechend in seiner Rezension:„Lexika nur als ,Nachschlagewerke‘ zu verstehen, greift zu kurz: sie sind anregend und können, nimmt man sie erst einmal zur Hand und sich dabei nur ein wenig Zeit für sie, Appetit machen auf noch viel mehr. Dies gilt in besonderem Maße für diese beiden Bände. Sollten sie Ihnen zu ,preisintensiv‘ sein, empfehlen Sie sie doch ihrer Bibliothek zur Anschaffung und gehen dann hin und wieder zum Schmökern in den Lesesaal“
Insofern handelt es sich um eine Auswahl, die grundsätzlich auch hätte anders ausfallen können. Das mindert allerdings in keiner Weise das Vergnügen am Lesen und Schmökern. Johannes Herwig-Lempp schreibt dementsprechend in seiner Rezension:„Lexika nur als ,Nachschlagewerke‘ zu verstehen, greift zu kurz: sie sind anregend und können, nimmt man sie erst einmal zur Hand und sich dabei nur ein wenig Zeit für sie, Appetit machen auf noch viel mehr. Dies gilt in besonderem Maße für diese beiden Bände. Sollten sie Ihnen zu ,preisintensiv‘ sein, empfehlen Sie sie doch ihrer Bibliothek zur Anschaffung und gehen dann hin und wieder zum Schmökern in den Lesesaal“