 Die allerorten beschriebenen dramatischen Veränderungen des Arbeitslebens in Unternehmen und anderen Organisationen haben nicht nur soziale und psychische Folgen, sondern wirken als Stressfaktoren auch direkt auf das körperliche Wohlergehen der Arbeitenden ein. Insofern wird Gesundheit bzw. ihre Förderung zunehmend zum Gegenstand von Beratungs- und Personalentwicklungsprozessen, dessen Bedeutung für die Zukunft gegenwärtig wohl erst in Ansätzen erkannt wird. Ein Pionier des Gesundheitscoachings ist Matthias Lauterbach, der als Arzt und systemischer Organisationsberater eine kompetente Doppelperspektive auf diese Thematik zur Verfügung hat und mit seinen Arbeiten zum Gesundheitscoaching derzeit auf große Resonanz stößt. In ihrer Rezension seines Buches über Gesundheitscoaching („Strategien und Methoden für Fitness und Lebensbalance im Beruf“) hält Ursel Winkler fest:„In dem vorliegenden, äußerst empfehlenswerten Buch entwickelt der Autor für die Initiierung und Begleitung dieses Prozesses ein fundiertes und in allen Punkten überzeugendes Konzept. Neben Grundlagen systemischen Coachings werden auch spezifische gesundheitsorientierte Ansätze integriert, die die Salutogenese, die Resilienz sowie die Lebensbalance bzw. Work-Life-Balance in den Blick nehmen. Zentrale Positionsbestimmungen wie gesundheitsorientierter Führungsstil, gesundheitsorientierte Arbeitsorganisationen und betriebliches Gesundheitsmanagement werden nicht wie in zahlreichen oberflächlichen Ratgebern als gehaltlose Schlagworte abgehandelt, sondern mit Inhalt gefüllt und im Rahmen des Konzeptes im ersten Teil des Buches theoretisch hergeleitet und schlüssig begründet“
Die allerorten beschriebenen dramatischen Veränderungen des Arbeitslebens in Unternehmen und anderen Organisationen haben nicht nur soziale und psychische Folgen, sondern wirken als Stressfaktoren auch direkt auf das körperliche Wohlergehen der Arbeitenden ein. Insofern wird Gesundheit bzw. ihre Förderung zunehmend zum Gegenstand von Beratungs- und Personalentwicklungsprozessen, dessen Bedeutung für die Zukunft gegenwärtig wohl erst in Ansätzen erkannt wird. Ein Pionier des Gesundheitscoachings ist Matthias Lauterbach, der als Arzt und systemischer Organisationsberater eine kompetente Doppelperspektive auf diese Thematik zur Verfügung hat und mit seinen Arbeiten zum Gesundheitscoaching derzeit auf große Resonanz stößt. In ihrer Rezension seines Buches über Gesundheitscoaching („Strategien und Methoden für Fitness und Lebensbalance im Beruf“) hält Ursel Winkler fest:„In dem vorliegenden, äußerst empfehlenswerten Buch entwickelt der Autor für die Initiierung und Begleitung dieses Prozesses ein fundiertes und in allen Punkten überzeugendes Konzept. Neben Grundlagen systemischen Coachings werden auch spezifische gesundheitsorientierte Ansätze integriert, die die Salutogenese, die Resilienz sowie die Lebensbalance bzw. Work-Life-Balance in den Blick nehmen. Zentrale Positionsbestimmungen wie gesundheitsorientierter Führungsstil, gesundheitsorientierte Arbeitsorganisationen und betriebliches Gesundheitsmanagement werden nicht wie in zahlreichen oberflächlichen Ratgebern als gehaltlose Schlagworte abgehandelt, sondern mit Inhalt gefüllt und im Rahmen des Konzeptes im ersten Teil des Buches theoretisch hergeleitet und schlüssig begründet“
Zur vollständigen Rezension
17. Oktober 2007
von Tom Levold
Keine Kommentare

 Während alle Welt die Zukunft der deutschen Universität im Bemühen um die Erlangung von Fördermitteln im Rahmen der„Exzellenzinitiative“ sieht und gleichzeitig die Mehrzahl der Universitäten sich mit der Umstellung auf Bachelor- und Mastersabschlüsse herumschlägt, frohlockte Dirk Baecker am vergangenen Samstag in der TAZ über die Gewinne, die bei diesem Prozess für die Universität als solche herausspringen könnten – nämlich die versteckte Aufwertung der Lehre:„Im Kern der ,Institution‘ Universität steht von Anfang an und bis heute die Idee einer Wissenschaft, die von der Notwendigkeit und Attraktivität der Lehre lebendig gehalten wird. Der Gang der Wissenschaft, so Wilhelm von Humboldts Argument für die Universität, also die Lehre, und gegen die Akademie, also die Versammlung der Gelehrten, sei unter kräftigen, rüstigen und jugendlichen Köpfen rascher und lebendiger. Deswegen ist die Universität bis heute und damit gegen das Interesse von Hochschullehrern, die sich ihre Reputationsgewinne aus ihren Forschungsbeiträgen versprechen, von der Lehre her zu denken. Die Universität ist primär nicht eine Stätte der wissenschaftlichen Forschung, sondern eine Sozialisationsagentur für die Heranführung des Nachwuchses an die komplexeren Fragen von Welt, Leben und Gesellschaft. Wissenschaftliche Forschung ist innerhalb der Universität, worin auch immer ihre eigenen Ziele bestehen, auf ihren Beitrag zu dieser Art von Lehre zu befragen“ Es geht dabei um nichts anderes als die methodische, theoretische und praktische Neubestimmung des Verhältnisses von Wissen und Nicht-Wissen:„Dafür braucht man den Dreischritt von Methode, Theorie und Praxis, nämlich (a) die Fähigkeit, zwischen Situationen, in denen man sich festgefahren hat, von Situationen zu unterscheiden, in denen man noch weiterkommt (,Methode‘), (b) die Fähigkeit, ein Problem nicht nur zu erkennen und gegebenenfalls zu lösen, sondern überhaupt erst einmal als ein solches zu formulieren, darzustellen und einer möglichen Lösung zuzuführen (,Theorie‘), und (c) die Fähigkeit, mit der Erfahrung umzugehen, dass Situationen von den Teilnehmern unterschiedlich definiert werden und noch lange nicht jede gelungene Problemdefinition auch begrüßt wird (,Praxis‘). Das Steckenbleiben kann den Verhältnissen, den Dingen, wie sie sind, und den Herren, wie sie herrschen, willkommener sein als das Weiterkommen; und die Problemstellung (bestenfalls auch nur eine Problemverschiebung) tritt jenen auf die Füße, die ihr Auskommen mit der bisherigen Problemvermeidung oder Problemlösung hatten. Deswegen macht es immer wieder Sinn, daran zu erinnern, dass praxis für die alten Griechen jede Tätigkeit war, die sich selbst genügt. Wollte man darüber hinaus etwas bewirken oder herstellen, sprach man von poiesis. Das ist die Herausforderung, der sich die nächste, die kleine, die dichte, die vernetzte Universität stellt: Sie bemisst die methodischen und die theoretischen Kompetenzen, die sie nur vermittelt, indem sie sie laufend erprobt, an einer Praxis, von der man weiß, dass sie sich selbst genügt, indem sie ihre eigenen Motive, Werte und Ziele hat und selbst dann auf Kontinuität hinaus will, wenn sie die Diskontinuität, den dauernden Wandel predigt“
Während alle Welt die Zukunft der deutschen Universität im Bemühen um die Erlangung von Fördermitteln im Rahmen der„Exzellenzinitiative“ sieht und gleichzeitig die Mehrzahl der Universitäten sich mit der Umstellung auf Bachelor- und Mastersabschlüsse herumschlägt, frohlockte Dirk Baecker am vergangenen Samstag in der TAZ über die Gewinne, die bei diesem Prozess für die Universität als solche herausspringen könnten – nämlich die versteckte Aufwertung der Lehre:„Im Kern der ,Institution‘ Universität steht von Anfang an und bis heute die Idee einer Wissenschaft, die von der Notwendigkeit und Attraktivität der Lehre lebendig gehalten wird. Der Gang der Wissenschaft, so Wilhelm von Humboldts Argument für die Universität, also die Lehre, und gegen die Akademie, also die Versammlung der Gelehrten, sei unter kräftigen, rüstigen und jugendlichen Köpfen rascher und lebendiger. Deswegen ist die Universität bis heute und damit gegen das Interesse von Hochschullehrern, die sich ihre Reputationsgewinne aus ihren Forschungsbeiträgen versprechen, von der Lehre her zu denken. Die Universität ist primär nicht eine Stätte der wissenschaftlichen Forschung, sondern eine Sozialisationsagentur für die Heranführung des Nachwuchses an die komplexeren Fragen von Welt, Leben und Gesellschaft. Wissenschaftliche Forschung ist innerhalb der Universität, worin auch immer ihre eigenen Ziele bestehen, auf ihren Beitrag zu dieser Art von Lehre zu befragen“ Es geht dabei um nichts anderes als die methodische, theoretische und praktische Neubestimmung des Verhältnisses von Wissen und Nicht-Wissen:„Dafür braucht man den Dreischritt von Methode, Theorie und Praxis, nämlich (a) die Fähigkeit, zwischen Situationen, in denen man sich festgefahren hat, von Situationen zu unterscheiden, in denen man noch weiterkommt (,Methode‘), (b) die Fähigkeit, ein Problem nicht nur zu erkennen und gegebenenfalls zu lösen, sondern überhaupt erst einmal als ein solches zu formulieren, darzustellen und einer möglichen Lösung zuzuführen (,Theorie‘), und (c) die Fähigkeit, mit der Erfahrung umzugehen, dass Situationen von den Teilnehmern unterschiedlich definiert werden und noch lange nicht jede gelungene Problemdefinition auch begrüßt wird (,Praxis‘). Das Steckenbleiben kann den Verhältnissen, den Dingen, wie sie sind, und den Herren, wie sie herrschen, willkommener sein als das Weiterkommen; und die Problemstellung (bestenfalls auch nur eine Problemverschiebung) tritt jenen auf die Füße, die ihr Auskommen mit der bisherigen Problemvermeidung oder Problemlösung hatten. Deswegen macht es immer wieder Sinn, daran zu erinnern, dass praxis für die alten Griechen jede Tätigkeit war, die sich selbst genügt. Wollte man darüber hinaus etwas bewirken oder herstellen, sprach man von poiesis. Das ist die Herausforderung, der sich die nächste, die kleine, die dichte, die vernetzte Universität stellt: Sie bemisst die methodischen und die theoretischen Kompetenzen, die sie nur vermittelt, indem sie sie laufend erprobt, an einer Praxis, von der man weiß, dass sie sich selbst genügt, indem sie ihre eigenen Motive, Werte und Ziele hat und selbst dann auf Kontinuität hinaus will, wenn sie die Diskontinuität, den dauernden Wandel predigt“ Heute wäre Michel Foucault 81 Jahre alt geworden. Michael White aus Australien hat seine therapeutischen Bemühungen ganz explizit in einen Foucaultschen Begründungszusammenhang gestellt – und ist dafür auch ziemlich kritisiert worden. Fred Redekop hat in einem Aufsatz im„Journal of Marital and Family“ aus dem Jahre 1995 diese Debatte skizziert und stellt sich auf die Seite Whites.
Heute wäre Michel Foucault 81 Jahre alt geworden. Michael White aus Australien hat seine therapeutischen Bemühungen ganz explizit in einen Foucaultschen Begründungszusammenhang gestellt – und ist dafür auch ziemlich kritisiert worden. Fred Redekop hat in einem Aufsatz im„Journal of Marital and Family“ aus dem Jahre 1995 diese Debatte skizziert und stellt sich auf die Seite Whites.  „White and Epston’s (1990) use of Foucault has been characterized as ’skewed‘ and ‚dubious‘, a characterization which I have argued is unjust; White in particular has developed Foucault’s problematizing practices to a high degree in his work. Rather than Foucault and White having ’nothing in common but their first names‘, it seems more accurate to say that White has closely followed a number of Foucault’s tactics, such as questioning the local use of power, examining the relationship of story to discourse, and raising the question of one’s position in a discipline, all tactics which make use of problematization“Der Artikel ist im Volltext auch im Netz zu finden.
„White and Epston’s (1990) use of Foucault has been characterized as ’skewed‘ and ‚dubious‘, a characterization which I have argued is unjust; White in particular has developed Foucault’s problematizing practices to a high degree in his work. Rather than Foucault and White having ’nothing in common but their first names‘, it seems more accurate to say that White has closely followed a number of Foucault’s tactics, such as questioning the local use of power, examining the relationship of story to discourse, and raising the question of one’s position in a discipline, all tactics which make use of problematization“Der Artikel ist im Volltext auch im Netz zu finden.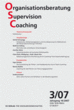 Das aktuelle Heft von OSC widmet sich dem Thema der„Fehlerkultur“. Herausgeberin Astrid Schreyögg schreibt in ihrem Editorial dazu:„Der Begriff ,Fehlerkultur‘, der Nähe zu dem der Organisationskultur aufweist, bezeichnet letztlich die Art und Weise, wie in einem System Fehler betrachtet werden: Sieht man sie als Desaster, das einfach nicht passieren darf, das mit Verachtung usw. geahndet werden muss, dann besteht bei den Mitarbeitern mit größter Wahrscheinlichkeit die Neigung, Fehler zu verleugnen oder zu vertuschen. Das aber führt dazu, dass aus Fehlern nie gelernt werden kann, und dann treten sie umso häufiger auf. Wo Menschen tätig sind, besteht aber immer die Möglichkeit, Fehler zu machen. Und mit diesen sollte möglichst realistisch und sorgfältig umgangen werden. Das also ist die zentrale Botschaft aller Beiträge zur Fehlerkultur. Und zur Entwicklung einer guten, qualifizierten oder angemessenen Fehlerkultur können in vielen Fällen Supervision und Coaching einen Beitrag leisten“ Im vorliegenden Heft von OSC befassen sich vier Beiträge mit diesem Thema, weitere Aufsätze sind dem Selbstmanagement im Coaching, Trennungsgesprächen in Unternehmen und der Rezeption der Unterscheidung von Format und Verfahren in der Beziehungsarbeit gewidmet.
Das aktuelle Heft von OSC widmet sich dem Thema der„Fehlerkultur“. Herausgeberin Astrid Schreyögg schreibt in ihrem Editorial dazu:„Der Begriff ,Fehlerkultur‘, der Nähe zu dem der Organisationskultur aufweist, bezeichnet letztlich die Art und Weise, wie in einem System Fehler betrachtet werden: Sieht man sie als Desaster, das einfach nicht passieren darf, das mit Verachtung usw. geahndet werden muss, dann besteht bei den Mitarbeitern mit größter Wahrscheinlichkeit die Neigung, Fehler zu verleugnen oder zu vertuschen. Das aber führt dazu, dass aus Fehlern nie gelernt werden kann, und dann treten sie umso häufiger auf. Wo Menschen tätig sind, besteht aber immer die Möglichkeit, Fehler zu machen. Und mit diesen sollte möglichst realistisch und sorgfältig umgangen werden. Das also ist die zentrale Botschaft aller Beiträge zur Fehlerkultur. Und zur Entwicklung einer guten, qualifizierten oder angemessenen Fehlerkultur können in vielen Fällen Supervision und Coaching einen Beitrag leisten“ Im vorliegenden Heft von OSC befassen sich vier Beiträge mit diesem Thema, weitere Aufsätze sind dem Selbstmanagement im Coaching, Trennungsgesprächen in Unternehmen und der Rezeption der Unterscheidung von Format und Verfahren in der Beziehungsarbeit gewidmet. Jan A. Fuhse, bis April 2007 Soziologe an der Abteilung für Soziologie und empirische Sozialforschung der Universität Suttgart beschäftigt und gegenwärtig Visiting Scholar an der Columbia University, hat einen spannenden Aufsatz über„Persönliche Netzwerke in der Systemtheorie“ geschrieben, der sich mit dem Status von Sozialbeziehungen beschäftigt, die keine eindeutige Innen-Außen-Differenzierungen im Sinne von System-Umwelt-Unterscheidungen zulassen. Im abstract heißt es:„Persönliche Netzwerke haben in der Luhmannschen Systemtheorie bisher keinen systematischen Stellenwert. Die vorliegende Arbeit versucht diese Lücke mit einer Diskussion bisheriger Begriffsvorschläge und dann mit einer eigenen Verortung des Netzwerkbegriffs in der Systemtheorie zu schließen. Zunächst wird überprüft, inwiefern frühere konzeptionelle Vorschläge in der Systemtheorie für die Fassung persönlicher Netzwerke geeignet sind. Diskutiert werden die Dreier-Typologie sozialer Systeme (Interaktion, Organisation und Gesellschaft) nach Niklas Luhmann, der Vorschlag einer Erweiterung um den Systemtyp der Gruppe von Helmut Willke, Friedhelm Neidhardt und Hartmann Tyrell, sowie Überlegungen zu Familie und Intimsystemen von Tyrell, Luhmann und Peter Fuchs und der Begriff des Interaktionszusammenhangs nach André Kieserling. Der zweite Abschnitt nimmt die bisherigen systemtheoretischen Arbeiten zum Netzwerkbegriff in den Blick: einige Formulierungen von Luhmann selbst, die Arbeiten von Gunther Teubner, von Eckard Kämper und Johannes Schmidt, von Veronika Tacke und von Stephan Fuchs. Abschließend wird auf den vorangegangenen Überlegungen aufbauend ein eigener Begriffsvorschlag für die systemtheoretische Fassung des Netzwerkbegriffs entwickelt. Einzelne Sozialbeziehungen werden dabei im Anschluss an Luhmann als autopoietische Systeme gesehen. Diese sind in gemeinsamen Interaktionen und in der Konstruktion von Personen (als Knoten von Netzwerken) aneinander gekoppelt. Nur in Ausnahmefällen entstehen dabei symbolisch abgeschlossene Gruppen wie Familien oder Straßengangs“ Die Arbeit ist in der Schriftenreihe des Instituts für Sozialwissenschaften der Universität Stuttgart 2005 erschienen und ist auch online zugänglich.
Jan A. Fuhse, bis April 2007 Soziologe an der Abteilung für Soziologie und empirische Sozialforschung der Universität Suttgart beschäftigt und gegenwärtig Visiting Scholar an der Columbia University, hat einen spannenden Aufsatz über„Persönliche Netzwerke in der Systemtheorie“ geschrieben, der sich mit dem Status von Sozialbeziehungen beschäftigt, die keine eindeutige Innen-Außen-Differenzierungen im Sinne von System-Umwelt-Unterscheidungen zulassen. Im abstract heißt es:„Persönliche Netzwerke haben in der Luhmannschen Systemtheorie bisher keinen systematischen Stellenwert. Die vorliegende Arbeit versucht diese Lücke mit einer Diskussion bisheriger Begriffsvorschläge und dann mit einer eigenen Verortung des Netzwerkbegriffs in der Systemtheorie zu schließen. Zunächst wird überprüft, inwiefern frühere konzeptionelle Vorschläge in der Systemtheorie für die Fassung persönlicher Netzwerke geeignet sind. Diskutiert werden die Dreier-Typologie sozialer Systeme (Interaktion, Organisation und Gesellschaft) nach Niklas Luhmann, der Vorschlag einer Erweiterung um den Systemtyp der Gruppe von Helmut Willke, Friedhelm Neidhardt und Hartmann Tyrell, sowie Überlegungen zu Familie und Intimsystemen von Tyrell, Luhmann und Peter Fuchs und der Begriff des Interaktionszusammenhangs nach André Kieserling. Der zweite Abschnitt nimmt die bisherigen systemtheoretischen Arbeiten zum Netzwerkbegriff in den Blick: einige Formulierungen von Luhmann selbst, die Arbeiten von Gunther Teubner, von Eckard Kämper und Johannes Schmidt, von Veronika Tacke und von Stephan Fuchs. Abschließend wird auf den vorangegangenen Überlegungen aufbauend ein eigener Begriffsvorschlag für die systemtheoretische Fassung des Netzwerkbegriffs entwickelt. Einzelne Sozialbeziehungen werden dabei im Anschluss an Luhmann als autopoietische Systeme gesehen. Diese sind in gemeinsamen Interaktionen und in der Konstruktion von Personen (als Knoten von Netzwerken) aneinander gekoppelt. Nur in Ausnahmefällen entstehen dabei symbolisch abgeschlossene Gruppen wie Familien oder Straßengangs“ Die Arbeit ist in der Schriftenreihe des Instituts für Sozialwissenschaften der Universität Stuttgart 2005 erschienen und ist auch online zugänglich.
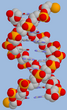 Nachdem in den letzten Monaten bereits die genetische Basis von Alkoholismus, ADHS, Schizophrenie, Rechtschreibschwäche, Lügen und außerehelichen Beziehungen entschlüsselt werden konnte, vermochten Genforscher aus fünf Ländern in einem einmaligen Selbstversuch erstmals zu beweisen, dass auch der Wunsch, Gene zu erforschen, selbst genetisch bedingt ist. So konnten sie aus der DNA von ingesamt 45 GenforscherInnen signifikant häufiger das Genforschungsgen GFG456 isolieren als bei einer Kontrollgruppe von 45 GeisteswissenschaftlerInnen mit gleichem kulturellen und biologischen Hintergrund. Nach Ansicht des Leiters der Studiengruppe, Gene Mind, der die Studie in einer Pressekonferenz in London vorstellte, ist das ein klarer Beleg für die Überlegenheit des Genforschungsansatzes. Ein weiterer wichtiger Befund, so Mind, habe gezeigt, dass – wie befürchtet – auf den Chromosomen der Geisteswissenschaftler zwar jede Menge Gene entdeckt werden konnten, aber kein Geist! Dieses für Geisteswissenschaftler ernüchternde Ergebnis sei ebenfalls ein Indiz für herausragende Bedeutung der Genforschung für die Erklärung sozialer Tatsachen. Gleichzeitig stellte Mind das bevorstehende Forschungsprojekt der Studiengruppe vor: er wies darauf hin, dass alle vorhandenen Untersuchungen von Familienstammbäumen die Hypothese nahelegten, dass sowohl Katholizismus als auch Protestantismus genetisch übertragen werden. Man stehe kurz vor der Sequenzierung des Religiositätsgens, welche entgültigen Aufschluss über die Wurzeln menschlicher Spiritualität liefern könnte. Die Untersuchung sei aber insofern nicht ganz einfach, als das besagte Gen in den unterschiedlichsten Lebensräumen vielfachen Mutationen ausgesetzt gewesen sei, die nun vom Forschungsteam rekonstruiert werden müssten, teilte der Forscher mit. Mit Ergebnissen sei nicht vor Mariä Empfängnis zu rechnen, allerdings könne man ihnen sehr hoffnungsvoll entgegensehn.
Nachdem in den letzten Monaten bereits die genetische Basis von Alkoholismus, ADHS, Schizophrenie, Rechtschreibschwäche, Lügen und außerehelichen Beziehungen entschlüsselt werden konnte, vermochten Genforscher aus fünf Ländern in einem einmaligen Selbstversuch erstmals zu beweisen, dass auch der Wunsch, Gene zu erforschen, selbst genetisch bedingt ist. So konnten sie aus der DNA von ingesamt 45 GenforscherInnen signifikant häufiger das Genforschungsgen GFG456 isolieren als bei einer Kontrollgruppe von 45 GeisteswissenschaftlerInnen mit gleichem kulturellen und biologischen Hintergrund. Nach Ansicht des Leiters der Studiengruppe, Gene Mind, der die Studie in einer Pressekonferenz in London vorstellte, ist das ein klarer Beleg für die Überlegenheit des Genforschungsansatzes. Ein weiterer wichtiger Befund, so Mind, habe gezeigt, dass – wie befürchtet – auf den Chromosomen der Geisteswissenschaftler zwar jede Menge Gene entdeckt werden konnten, aber kein Geist! Dieses für Geisteswissenschaftler ernüchternde Ergebnis sei ebenfalls ein Indiz für herausragende Bedeutung der Genforschung für die Erklärung sozialer Tatsachen. Gleichzeitig stellte Mind das bevorstehende Forschungsprojekt der Studiengruppe vor: er wies darauf hin, dass alle vorhandenen Untersuchungen von Familienstammbäumen die Hypothese nahelegten, dass sowohl Katholizismus als auch Protestantismus genetisch übertragen werden. Man stehe kurz vor der Sequenzierung des Religiositätsgens, welche entgültigen Aufschluss über die Wurzeln menschlicher Spiritualität liefern könnte. Die Untersuchung sei aber insofern nicht ganz einfach, als das besagte Gen in den unterschiedlichsten Lebensräumen vielfachen Mutationen ausgesetzt gewesen sei, die nun vom Forschungsteam rekonstruiert werden müssten, teilte der Forscher mit. Mit Ergebnissen sei nicht vor Mariä Empfängnis zu rechnen, allerdings könne man ihnen sehr hoffnungsvoll entgegensehn. Das aktuelle Heft der PID widmet sich dem Thema Coaching und Organisationsberatung. Ein psychotherapeutisches Thema? Die Herausgeber dieses Heftes, Arist von Schlippe, Julika Zwack und Jochen Schweitzer, formulieren ihre Gründe für dieses Heft in ihrem Editorial folgendermaßen:„Welche Metapher könnte das Verhältnis von Psychotherapie und Coaching beschreiben? Schwestern vielleicht – unterschiedlich alt, die eine schon erwachsen – und stolz darauf, die andere(n) gerade der Pubertät entwachsen. Sie konkurrieren, sind jeweils ,einzigartig‘ und doch einander ähnlich. Und wie Schwestern so sind, sind sie darauf bedacht, die Unterschiedlichkeit zu betonen, auch wenn, oder gerade weil die Umwelt die Ähnlichkeit hervorhebt. Manchmal werden sie verwechselt und je nach Umfeld, kommen sie auch unterschiedlich gut an. (
) Es waren vor allem zwei Gründe, die uns veranlassten, dieses Heft herauszugeben. Zum einen die unübersehbare ,Verwandtschaft‘, die sich auch darin äußert, dass eine nicht gerade kleine Zahl von Psychotherapeutinnen und -therapeuten ,nebenher‘ oder in einem späteren Laufbahnabschnitt auch in Tätigkeitsfeldern tätig ist, die nichts mit ,Heilbehandlung‘ zu tun haben. Dass sie dafür angefragt werden, lässt vermuten, dass ein Teil ihrer Kompetenzen dort nützlich verwendet werden kann. (
) Ein zweiter Anlass für dieses Heft ist die Tatsache, dass fast alle Psychotherapeuten selbst ihrerseits in organisationsförmigen Strukturen arbeiten. Für die in privater Praxis Niedergelassenen zeigt sich dies in Quartalsabrechnungen, Richtlinien und Qualitätssicherungsprozeduren. Die in Institutionen Beschäftigten merken dies in ihrer Zusammenarbeit mit Chefs, Kollegen, Verwaltungen“ Neben den üblichen Beiträgen aus unterschiedlichen Therapieschulen zum Thema finden sich diesmal eine ganze Reihe systemischer Arbeiten – was vielleicht auch damit zu tun hat, dass der Systemische Ansatz eine umfangreiche und ausgearbeitete Theorie der Organisationanzubieten hat. Neben den Herausgebern haben u.a. Fritz B. Simon, Karin Martens-Schmid, Ulrike Borst , Torsten Groth und Tom Levold systemische Perspektiven beigesteuert.
Das aktuelle Heft der PID widmet sich dem Thema Coaching und Organisationsberatung. Ein psychotherapeutisches Thema? Die Herausgeber dieses Heftes, Arist von Schlippe, Julika Zwack und Jochen Schweitzer, formulieren ihre Gründe für dieses Heft in ihrem Editorial folgendermaßen:„Welche Metapher könnte das Verhältnis von Psychotherapie und Coaching beschreiben? Schwestern vielleicht – unterschiedlich alt, die eine schon erwachsen – und stolz darauf, die andere(n) gerade der Pubertät entwachsen. Sie konkurrieren, sind jeweils ,einzigartig‘ und doch einander ähnlich. Und wie Schwestern so sind, sind sie darauf bedacht, die Unterschiedlichkeit zu betonen, auch wenn, oder gerade weil die Umwelt die Ähnlichkeit hervorhebt. Manchmal werden sie verwechselt und je nach Umfeld, kommen sie auch unterschiedlich gut an. (
) Es waren vor allem zwei Gründe, die uns veranlassten, dieses Heft herauszugeben. Zum einen die unübersehbare ,Verwandtschaft‘, die sich auch darin äußert, dass eine nicht gerade kleine Zahl von Psychotherapeutinnen und -therapeuten ,nebenher‘ oder in einem späteren Laufbahnabschnitt auch in Tätigkeitsfeldern tätig ist, die nichts mit ,Heilbehandlung‘ zu tun haben. Dass sie dafür angefragt werden, lässt vermuten, dass ein Teil ihrer Kompetenzen dort nützlich verwendet werden kann. (
) Ein zweiter Anlass für dieses Heft ist die Tatsache, dass fast alle Psychotherapeuten selbst ihrerseits in organisationsförmigen Strukturen arbeiten. Für die in privater Praxis Niedergelassenen zeigt sich dies in Quartalsabrechnungen, Richtlinien und Qualitätssicherungsprozeduren. Die in Institutionen Beschäftigten merken dies in ihrer Zusammenarbeit mit Chefs, Kollegen, Verwaltungen“ Neben den üblichen Beiträgen aus unterschiedlichen Therapieschulen zum Thema finden sich diesmal eine ganze Reihe systemischer Arbeiten – was vielleicht auch damit zu tun hat, dass der Systemische Ansatz eine umfangreiche und ausgearbeitete Theorie der Organisationanzubieten hat. Neben den Herausgebern haben u.a. Fritz B. Simon, Karin Martens-Schmid, Ulrike Borst , Torsten Groth und Tom Levold systemische Perspektiven beigesteuert. Noch ein Geburtstag! Heute wäre Ronald D. Laing 80 Jahre alt geworden. Er wurde am 7.10.1927 in Glasgow geboren und starb im Alter von 61 Jahren in St. Tropez. Ursprünglich psychoanalytisch ausgebildet, machte er sich vor allem einen Namen als Mitbegründer der Anti-Psychiatrie-Bewegung. In den 60er und 70er Jahren wurde er mit seinen Büchern„Das geteilte Selbst“,„Das Selbst und die Anderen“,„Phänomenologie der Erfahrung“ und„Wahnsinn und Familie“ sehr berühmt. 1962 besuchte er erstmals Gregory Bateson und Jay Haley in den USA, im Sammelband„Schizophrenie und Familie“ der Autorengruppe um Bateson veröffentlichte er den Beitrag„Mystifikation, Konfusion und Konflikt“. Später ließ sein Ruhm, der u.a. auch auf seinem politischen Engagement beruhte, rapide nach. Daniel Burston, der 1996 ein Buch über Laing geschrieben hat („Wings of Madness“) zeichnet in einem differenzierten Beitrag für das Online-Magazin JANUSHEAD den Lebensweg Laings nach und macht deutlich, dass Ruhm und Vergessenheit nur zum Teil Laing selbst zuzuschreiben sind, zum anderen Teil den Veränderungen in den intellektuellen Moden:„Mention Laing nowadays and most people can dimly conjure up a flamboyant rebel of the psychedelic era, a chum of Tim Leary, Ram Dass, and Allen Ginsburg — which he was, of course, off and on. But press them to describe what he stood for, what he actually thought or said, and you’ll only elicit a trickle of platitudinous sound bites, proving that serious reflection on his work has virtually halted. The lasting fame that Freud and Jung achieved, and that some predicted for Laing, eluded him, and the recent stream of books about him, (my own included), have done nothing to change that. My first book on Laing, The Wing of Madness, appeared in 1996, and since then many people have asked me why Laing’s credibility declined so dramatically over the years. By way of a reply I generally rattle on about his internal contradictions, his inability to follow through and finish his various projects, his flamboyant and provocative gestures, and so on. All true, up to a point. Laing must shoulder some of the responsibility for his current neglect — something he was apparently unwilling or unable to do. But on further reflection, the reasons for his brief fame and rapid decline are much more complex, and have less to do with his enigmatic personality than with changing climates of opinion“
Noch ein Geburtstag! Heute wäre Ronald D. Laing 80 Jahre alt geworden. Er wurde am 7.10.1927 in Glasgow geboren und starb im Alter von 61 Jahren in St. Tropez. Ursprünglich psychoanalytisch ausgebildet, machte er sich vor allem einen Namen als Mitbegründer der Anti-Psychiatrie-Bewegung. In den 60er und 70er Jahren wurde er mit seinen Büchern„Das geteilte Selbst“,„Das Selbst und die Anderen“,„Phänomenologie der Erfahrung“ und„Wahnsinn und Familie“ sehr berühmt. 1962 besuchte er erstmals Gregory Bateson und Jay Haley in den USA, im Sammelband„Schizophrenie und Familie“ der Autorengruppe um Bateson veröffentlichte er den Beitrag„Mystifikation, Konfusion und Konflikt“. Später ließ sein Ruhm, der u.a. auch auf seinem politischen Engagement beruhte, rapide nach. Daniel Burston, der 1996 ein Buch über Laing geschrieben hat („Wings of Madness“) zeichnet in einem differenzierten Beitrag für das Online-Magazin JANUSHEAD den Lebensweg Laings nach und macht deutlich, dass Ruhm und Vergessenheit nur zum Teil Laing selbst zuzuschreiben sind, zum anderen Teil den Veränderungen in den intellektuellen Moden:„Mention Laing nowadays and most people can dimly conjure up a flamboyant rebel of the psychedelic era, a chum of Tim Leary, Ram Dass, and Allen Ginsburg — which he was, of course, off and on. But press them to describe what he stood for, what he actually thought or said, and you’ll only elicit a trickle of platitudinous sound bites, proving that serious reflection on his work has virtually halted. The lasting fame that Freud and Jung achieved, and that some predicted for Laing, eluded him, and the recent stream of books about him, (my own included), have done nothing to change that. My first book on Laing, The Wing of Madness, appeared in 1996, and since then many people have asked me why Laing’s credibility declined so dramatically over the years. By way of a reply I generally rattle on about his internal contradictions, his inability to follow through and finish his various projects, his flamboyant and provocative gestures, and so on. All true, up to a point. Laing must shoulder some of the responsibility for his current neglect — something he was apparently unwilling or unable to do. But on further reflection, the reasons for his brief fame and rapid decline are much more complex, and have less to do with his enigmatic personality than with changing climates of opinion“
 Rainer Krause, Professor für Psychologie an der Universität Saarbrücken und einer der bekanntesten deutschsprachigen Affekt- und Psychotherapieforscher, wird heute 65. systemagazin gratuliert und verweist aus diesem Anlass auf eine online verfügbare Arbeit von Rainer Krause, die sich mit der Mikroebene affektiver Kommunikation in gestörten Beziehungen beschäftigt:„In der vorliegenden Arbeit wird versucht, die 25-jährigen Studien der Forschungsgruppe Saarbrücken zusammenzufassen. Es wird argumentiert und mit dem empirischen Material untermauert, dass man die Hartnäckigkeit psychischer Störungen teilweise erklären kann durch das unbewusste mikro-affektive Verhalten der seelisch erkrankten Personen, das ihre normalen Partner dazu bringt, ihre unbewussten Annahmen über sich und die Welt zu bestätigen. Die Art und Weise, wie dies geschieht, wird am Verhalten verschiedener Störungsbilder aufgezeigt. Nach Weiss und Sampson hat dieses Verhalten als Testfunktion sicherzustellen, dass sich die bedeutsamen anderen nicht den historischen Figuren entsprechend verhalten. Die Sicherheitsgrenzen sind allerdings so hoch angesetzt, dass ein Alltagsinteraktionspartner sie nicht bestehen kann. Im zweiten Teil werden die Studien dargestellt, die untersuchten, ob sich gute Therapeuten ganz unterschiedlicher theoretischer Ausrichtung dadurch auszeichnen, dass sie sich dieser unbewussten Verhaltensinduktion entziehen können. Diese Annahme konnte sehr überzeugend bestätigt werden. Die Anzahl mikroaffektiver Verflechtungen korreliert signifikant mit dem Misserfolg, wobei reziproke Verflechtungen, besonders unheilvoll sind. Darunter werden unbewusste affektive Antwortreaktionen verstanden, die im gleichen hedonischen Umfeld stattfinden, beispielsweise der Freude oder aber der negativen Affekte wie Verachtung und Ekel. Es wird eine Taxonomie des Scheiterns gut ausgebildeter Therapeuten vorgenommen, und es werden Überlegungen zur Behandlungstechnik und Ausbildung angestellt“
Rainer Krause, Professor für Psychologie an der Universität Saarbrücken und einer der bekanntesten deutschsprachigen Affekt- und Psychotherapieforscher, wird heute 65. systemagazin gratuliert und verweist aus diesem Anlass auf eine online verfügbare Arbeit von Rainer Krause, die sich mit der Mikroebene affektiver Kommunikation in gestörten Beziehungen beschäftigt:„In der vorliegenden Arbeit wird versucht, die 25-jährigen Studien der Forschungsgruppe Saarbrücken zusammenzufassen. Es wird argumentiert und mit dem empirischen Material untermauert, dass man die Hartnäckigkeit psychischer Störungen teilweise erklären kann durch das unbewusste mikro-affektive Verhalten der seelisch erkrankten Personen, das ihre normalen Partner dazu bringt, ihre unbewussten Annahmen über sich und die Welt zu bestätigen. Die Art und Weise, wie dies geschieht, wird am Verhalten verschiedener Störungsbilder aufgezeigt. Nach Weiss und Sampson hat dieses Verhalten als Testfunktion sicherzustellen, dass sich die bedeutsamen anderen nicht den historischen Figuren entsprechend verhalten. Die Sicherheitsgrenzen sind allerdings so hoch angesetzt, dass ein Alltagsinteraktionspartner sie nicht bestehen kann. Im zweiten Teil werden die Studien dargestellt, die untersuchten, ob sich gute Therapeuten ganz unterschiedlicher theoretischer Ausrichtung dadurch auszeichnen, dass sie sich dieser unbewussten Verhaltensinduktion entziehen können. Diese Annahme konnte sehr überzeugend bestätigt werden. Die Anzahl mikroaffektiver Verflechtungen korreliert signifikant mit dem Misserfolg, wobei reziproke Verflechtungen, besonders unheilvoll sind. Darunter werden unbewusste affektive Antwortreaktionen verstanden, die im gleichen hedonischen Umfeld stattfinden, beispielsweise der Freude oder aber der negativen Affekte wie Verachtung und Ekel. Es wird eine Taxonomie des Scheiterns gut ausgebildeter Therapeuten vorgenommen, und es werden Überlegungen zur Behandlungstechnik und Ausbildung angestellt“