14. November 2007
von Tom Levold
Keine Kommentare
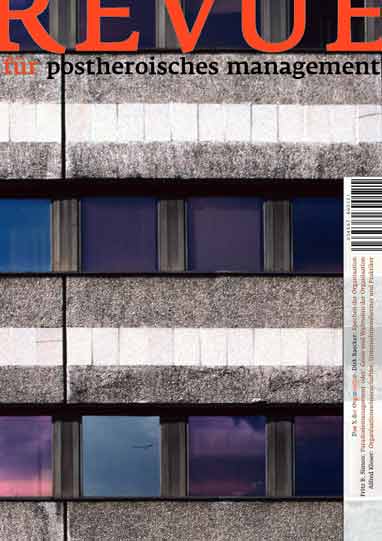
Das Management Zentrum Witten um die Gründer Dirk Baecker, Fritz B. Simon und Rudolf Wimmer hat sich in den letzten Jahren neben seinen wissenschaftlichen und beraterischen Tätigkeiten auch mit Büchern und Tagungen um die Verbreitung systemischen Denkens in Organisationen verdient gemacht. So startet z.B. morgen in Berlin die zweite X-Organisationen-Tagung des MZW, die wie auch schon ihr Vorgänger ebenso von inhaltlichen Komplexitätszumutungen wie ausgefeilter ästhetischer Präsentation gleichermaßen geprägt sein wird. Die neueste Schöpfung des Hauses MZW ist eine großformatige Zeitschrift, für die das Gleiche gesagt werden kann, eine aufwändig gestaltete„revue für postheroisches management“, die in einer mutigen 5000er-Auflage zweimal jährlich erscheinen soll. Dem Formbewusstsein, das die Einheit von Form und Inhalt im Blick hat, ist nicht nur ein ansprechendes, für ausgezeichnete Lesbarkeit sorgendes Design sowie eine entsprechend gestaltete website geschuldet (auf der auch einige Beiträge als PDFs zu lesen sind), sondern auch die jeweilige Vorstellung des (wir dürfen vermuten: postheroischen) künstlerischen Werkes eines„featured artists“, das mit ganzseitigen Abbildungen den Texten einen visuellen Kontrast verschafft. Den Anfang macht in der Startnummer Annett Zinsmeister mit (oft erst auf den zweiten Blick, dann aber sicher) atemraubenden Fotos/Montagen von Plattenbau-Fassaden, die den Betrachter auf eine Weise in visuelle Paradoxien von Oberfläche und Tiefe verstricken, als ob sie gemacht worden seien, um das Anliegen der Herausgeber zu verbildlichen.
Dieses Anliegen bestimmt Dirk Baecker in seinem Editorial folgendermaßen:„Eine Zeitschrift, die sich als Revue bezeichnet, rechnet nicht damit, mit neuen Erkenntnissen überraschen zu können. Im Gegenteil, was man hier zu lesen und zu sehen bekommt, hat man alles schon einmal gesehen. Wir möchten dazu einladen, noch einmal hinzuschauen, getreu der Aufforderung von Heinz von Foerster: »Bitte nie zu sagen, das ist langweilig, das kenne ich schon. Das ist die größte Katastrophe! Immer wieder sagen, ich habe keine Ahnung, ich möchte das noch einmal erleben.« Wir möchten dazu einladen, noch einmal hinzuschauen und dieses Mal sorgfältiger als bisher die Effekte der Organisation, des Managements und der Gesellschaft miteinander zu verrechnen. Unser Ausgangspunkt ist ein systemischer: Wer glaubt, die Sachverhalte voneinander trennen zu können, irrt; wer sie miteinander vermischt, allerdings erst recht. Wir laden mit dieser Zeitschrift dazu ein, die Differenzen bei der Arbeit zu beobachten. Das gilt für unsere Ausgangsdifferenz zwischen Organisation, Management und Gesellschaft, aber auch für alle anderen Differenzen, die uns interessieren, weil sie einen Beitrag dazu leisten können, dieser (für diese Zeitschrift) ersten Differenz auf die Spur zu kommen.
Vom postheroischen Management sprechen wir, weil das Heroische darin bestand, zugunsten des Gewinns von Tragik und von Komik an den einmal gesetzten Unterschieden festzuhalten. Held ist, wer entweder beeindrucken triumphiert oder großartig scheitert. Alle anderen sind bloß Beobachter, die dem Weltenlauf nichts hinzuzufügen haben, sondern allenfalls die anfallenden Arbeiten erledigen. Im postheroischen Management werden die Beobachter aus ihrer passiven Rolle befreit. Sie werden zu Akteuren. Jeder ihrer Arbeitsschritte ist eine Entscheidung. Helden stören dabei nur. Helden sind Leute, die den Blick für die Gegenwart scheuen und sich stattdessen auf ihre Zukunft, ihre glorreiche Zukunft, konzentrieren. Wir interessieren uns in dieser Revue für die Ressourcen der Beobachtung, um zu besseren Entscheidungen zu kommen. Wir suchen nach einem Management, das in der Lage ist, der Gegenwart und ihren strategischen Möglichkeiten nicht auszuweichen, sondern sich ihr zu stellen. Wir wissen, dass die Praxis des Managements vielfach besser ist als sein, des Managements, Ruf. Wir wissen aber auch, dass Selbstverständnis und Selbstbeschreibung dieser Praxis nur selten gewachsen sind. Mit anderen Worten, wir handeln intelligenter, als wir reden. Unter dem Stichwort des postheroischen Managements versuchen wir, die Managementlehre, das Reden über das Management, auf die Höhe seiner eigenen Praxis zu bringen“
Gut gebrüllt, Löwe! In der ersten Ausgabe findet das Reden über Management neben klugen und theoretischen Erwägungen über die Praxis von Organisationen vorwiegend in Interviews statt, die sich als Revue-Form bestens eignen. Die Lektüre ist anspruchsvoll und vergnüglich zugleich. Möge das Wagnis, in diesen Zeiten ein neues Print-Medium ohne massive Werbeunterstützung der üblichen Verdächtigen auf den Markt zu werfen, von Erfolg gekrönt sein (zumal das Jahresabonnement für ein Magazin dieser Machart mit 40,- lachhaft günstig ist). systemagazin wird auf die Inhalte der jeweils neuesten Ausgabe aufmerksam machen.
Zum Inhaltsverzeichnis



 Ein sehr schöner Text des Organisationssoziologen Stefan Kühl, der als„Arbeitsfassung“ im Internet zu finden ist, befasst sich mit der„Rationalitätslücke“ in Organisationen und ihrer Bedeutung für eine systemisch-soziologische Fundierung von Beratung. Diese Rationalitätslücke besteht darin, dass Organisationen in ihrer Selbstdarstellung dazu neigen, Entwicklungs- und Veränderungsprozesse als Ergebnisse planmäßiger, durchdachter und zweckrationaler Anstrengungen darzustellen, während die tatsächliche Praxis vor allem von der Existenz von Hindernissen, Widerständen, Unwägbarkeiten und Unvorhergesehenem geprägt ist. Klassische Berater docken an den Rationalitätswünschen der Organisationen mit einer„Ästhetisierungsstrategie“ an, in dem ein schönes und konsistentes Zukunftsbild der Organisation seitens der Berater entworfen wird, dessen Umsetzung aber ebenfalls der genannten Rationalitätslücke anheimfällt. Neben vielen anderen Aspekten ist für eine systemische Organisationsberatung der Umgang mit Latenzen interessant:“Für ein soziologisches Beratungsverständnis ist es deswegen notwendig mit einer doppelten Perspektive an eine Organisation heranzugehen. Der erste Blick ist darauf gerichtet zu verstehen, welche Latenzen in einer Organisation vorhanden sind. Hier würde von einer Fremdbeobachtungsperspektive geschaut werden, welche Aspekte in der Organisation nicht (oder nur sehr eingeschränkt) wahrgenommen werden. Es geht ganz im Sinne der systemischen Beratung darum zu beobachten, welche dominanten Muster die Organisation zur Konstruktion ihrer Realität aufgebaut hat, mit welchen Differenzen primär operiert wird, was sie mit Hilfe der Differenz zu sehen bekommt und was nicht, welche spezifischen Blindheiten sie ausbildet und welche Konsequenzen sich daraus für sie ergeben. (
). Der zweite Blick wäre darauf gerichtet zu schauen, welche Funktion die latenten Strukturen in einer Organisation haben. Hier müsste von Beratern herausgearbeitet werden, ob die latenten Struktur so stark ausgeprägt sind, dass ein Arbeiten an ihnen die gesamte Organisation verunsichern würde. Die Aussage über die Funktion der latenten Strukturen gibt dem Berater Aufschluss, wie stark er diese latenten Strukturen ins Gespräch bringen kann“
Ein sehr schöner Text des Organisationssoziologen Stefan Kühl, der als„Arbeitsfassung“ im Internet zu finden ist, befasst sich mit der„Rationalitätslücke“ in Organisationen und ihrer Bedeutung für eine systemisch-soziologische Fundierung von Beratung. Diese Rationalitätslücke besteht darin, dass Organisationen in ihrer Selbstdarstellung dazu neigen, Entwicklungs- und Veränderungsprozesse als Ergebnisse planmäßiger, durchdachter und zweckrationaler Anstrengungen darzustellen, während die tatsächliche Praxis vor allem von der Existenz von Hindernissen, Widerständen, Unwägbarkeiten und Unvorhergesehenem geprägt ist. Klassische Berater docken an den Rationalitätswünschen der Organisationen mit einer„Ästhetisierungsstrategie“ an, in dem ein schönes und konsistentes Zukunftsbild der Organisation seitens der Berater entworfen wird, dessen Umsetzung aber ebenfalls der genannten Rationalitätslücke anheimfällt. Neben vielen anderen Aspekten ist für eine systemische Organisationsberatung der Umgang mit Latenzen interessant:“Für ein soziologisches Beratungsverständnis ist es deswegen notwendig mit einer doppelten Perspektive an eine Organisation heranzugehen. Der erste Blick ist darauf gerichtet zu verstehen, welche Latenzen in einer Organisation vorhanden sind. Hier würde von einer Fremdbeobachtungsperspektive geschaut werden, welche Aspekte in der Organisation nicht (oder nur sehr eingeschränkt) wahrgenommen werden. Es geht ganz im Sinne der systemischen Beratung darum zu beobachten, welche dominanten Muster die Organisation zur Konstruktion ihrer Realität aufgebaut hat, mit welchen Differenzen primär operiert wird, was sie mit Hilfe der Differenz zu sehen bekommt und was nicht, welche spezifischen Blindheiten sie ausbildet und welche Konsequenzen sich daraus für sie ergeben. (
). Der zweite Blick wäre darauf gerichtet zu schauen, welche Funktion die latenten Strukturen in einer Organisation haben. Hier müsste von Beratern herausgearbeitet werden, ob die latenten Struktur so stark ausgeprägt sind, dass ein Arbeiten an ihnen die gesamte Organisation verunsichern würde. Die Aussage über die Funktion der latenten Strukturen gibt dem Berater Aufschluss, wie stark er diese latenten Strukturen ins Gespräch bringen kann“


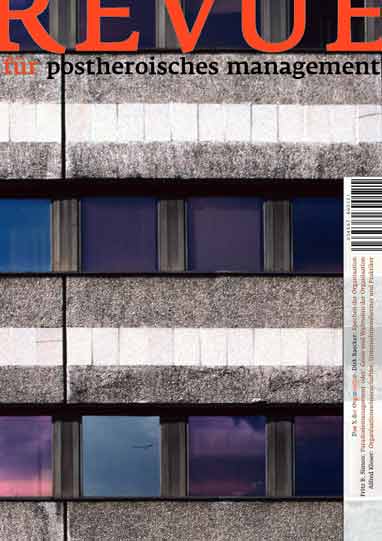
 Kenneth Gergen, einer der bedeutenden Vertreter des Sozialen Konstruktionismus, führte gemeinsam mit Lynn Hoffman und Harlene Anderson, einen„konstruktionistischen Dialog“, der 1997 in Heft 4 der Zeitschrift für Systemische Therapie und Beratung abedruckt wurde. Auf der website von Ken Gergen ist der Text auch zu lesen. In der Zusammenfassung heißt es:
Kenneth Gergen, einer der bedeutenden Vertreter des Sozialen Konstruktionismus, führte gemeinsam mit Lynn Hoffman und Harlene Anderson, einen„konstruktionistischen Dialog“, der 1997 in Heft 4 der Zeitschrift für Systemische Therapie und Beratung abedruckt wurde. Auf der website von Ken Gergen ist der Text auch zu lesen. In der Zusammenfassung heißt es:  „Für eine gewisse Zeit waren wir drei tief in der Erforschung der Implikationen einer sozialkonstruktionistischen Sichtweise von Erkenntnis für die therapeutische Praxis engagiert. Von einem konstruktionistischen Standpunkt aus werden unsere sprachlichen Mittel mit denen wir die Welt (und uns selbst) beschreiben und erklären, nicht von irgendetwas heraus abgeleitet oder erklärt. Vielmehr werden unsere sprachlichen Mittel der Beschreibung und Erklärung innerhalb menschlicher Interaktionsprozesse produziert, aufrecht erhalten und/oder aufgegeben. Ferner sind unsere Sprachen konstituierende Merkmale unserer kulturellen Muster. Sie sind in Beziehungen derart eingebettet, dass ein Wechsel der Sprache eine Änderung der Beziehung bedeuten würde. Die Konzeptionen für Romanze, Liebe, Heirat und wechselseitiger Verpflichtung zu verwerfen, würde
„Für eine gewisse Zeit waren wir drei tief in der Erforschung der Implikationen einer sozialkonstruktionistischen Sichtweise von Erkenntnis für die therapeutische Praxis engagiert. Von einem konstruktionistischen Standpunkt aus werden unsere sprachlichen Mittel mit denen wir die Welt (und uns selbst) beschreiben und erklären, nicht von irgendetwas heraus abgeleitet oder erklärt. Vielmehr werden unsere sprachlichen Mittel der Beschreibung und Erklärung innerhalb menschlicher Interaktionsprozesse produziert, aufrecht erhalten und/oder aufgegeben. Ferner sind unsere Sprachen konstituierende Merkmale unserer kulturellen Muster. Sie sind in Beziehungen derart eingebettet, dass ein Wechsel der Sprache eine Änderung der Beziehung bedeuten würde. Die Konzeptionen für Romanze, Liebe, Heirat und wechselseitiger Verpflichtung zu verwerfen, würde 

 In diesem Aufsatz von 1997 fasst Heiko Kleve, Professor für soziologische und sozialpsychologische Grundlagen der Sozialen Arbeit an der Fachhochschule Potsdam, seine Vorstellungen eines postmodernen Verständnisses von Sozialarbeit zusammen, die jetzt in der Systemischen Bibliothek zu lesen sind. In seinem„Beitrag wird Sozialarbeit mit Hilfe der konstruktivistischen Erkenntnistheorie reflektiert. Denn SozialarbeiterInnen sind bei jedem KlientInnenkontakt in erster Linie mit erkenntnistheoretischen Problemen der Beschreibung, Erklärung und Bewertung sozialer Realität konfrontiert. Diese Probleme werden in einen soziologischen und wissenschaftstheoretischen Kontext gestellt, um davon ausgehend, einige praktisch relevante Beschreibungsmöglichkeiten für eine postmodern aufgeklärte Sozialarbeit abzuleiten“. Die von Kleve hinzugezogenen„systemtheoretischen Spielarten des Konstruktivismus“ sind die Pragmatische Kommunikationstheorie, die Kybernetik 2. Ordnung, die Kognitionstheorie, die Differenztheorie und die Soziologische Systemtheorie Niklas Luhmanns.
In diesem Aufsatz von 1997 fasst Heiko Kleve, Professor für soziologische und sozialpsychologische Grundlagen der Sozialen Arbeit an der Fachhochschule Potsdam, seine Vorstellungen eines postmodernen Verständnisses von Sozialarbeit zusammen, die jetzt in der Systemischen Bibliothek zu lesen sind. In seinem„Beitrag wird Sozialarbeit mit Hilfe der konstruktivistischen Erkenntnistheorie reflektiert. Denn SozialarbeiterInnen sind bei jedem KlientInnenkontakt in erster Linie mit erkenntnistheoretischen Problemen der Beschreibung, Erklärung und Bewertung sozialer Realität konfrontiert. Diese Probleme werden in einen soziologischen und wissenschaftstheoretischen Kontext gestellt, um davon ausgehend, einige praktisch relevante Beschreibungsmöglichkeiten für eine postmodern aufgeklärte Sozialarbeit abzuleiten“. Die von Kleve hinzugezogenen„systemtheoretischen Spielarten des Konstruktivismus“ sind die Pragmatische Kommunikationstheorie, die Kybernetik 2. Ordnung, die Kognitionstheorie, die Differenztheorie und die Soziologische Systemtheorie Niklas Luhmanns.